Autonome in Berlin: Militante Managerschule
Die autonome Szene gibt sich gerne als linksradikale Avantgarde. Nach den Abenteuerjahren der Rebellion werden viele ganz bürgerlich.
Gut sehen sie aus. Schicke Turnschuhe, schwarze Windjacken, schöne Handschuhe, besser als die der Cowboys in der Marlboro-Werbung. Und so fühlen sie sich auch. Als Rebellen, mit Blick fürs Ästhetische. Jene Militanten, die ihre Gesichter hinter schwarzen Kapuzen, Tüchern und Sonnenbrillen verbergen. Brennende Luxusautos, Steine auf Polizisten, Angriffe auf Edelrestaurants – die Autonomen sind in aller Munde.
Die Vermummung des Gesichts verbirgt bei Protesten nicht nur die Identität vor dem Staat. Sie selbst ist Teil linksradikaler Identität: Ein schwarzes Tuch, eine Skimaske vor dem Gesicht macht deutlich, hier kommt ein Straßenkämpfer. Gelegentlich eine Kämpferin.
Die Militanten nennen sich seit den 80ern Autonome, in Anlehnung an die – viel politischere – italienische Autonomia-Bewegung, die Häuser besetzte und wilde Streiks unterstützte. Wo hierzulande seit dem 1. Mai 1987 in Kreuzberg, als der Supermarkt Bolle geplündert wurde, der „schwarze Block“ auftaucht, sind Kameras auf ihn gerichtet. Die zur Schau gestellte Militanz macht jeden Auftritt zum Ereignis. Dabei sind es oft nur ein paar hundert schwarz Gekleidete.
Das „empirische Wissen“ über die Szene sei gering, heißt es vom Verfassungsschutz. Von wenigen „Altautonomen“ abgesehen, seien die meisten der etwa 1000 Anhänger in Berlin zwischen 16 und 28 Jahre alt. Mehr geworden sind sie nicht. Aber in kleinen Gruppen treffen sie sich wieder häufiger. Anlass: die Krisenpolitik im Großen und die Luxussanierung der Berliner Kieze im Kleinen. Kommuniziert wird nicht nur über Internetforen, viele Aktivisten kennen sich persönlich. „Treffen werden zumeist mündlich vereinbart und sehr vorsichtig geplant und durchgeführt“, bestätigt eine Sprecherin des Verfassungsschutzes.
Jan, heute ein Mittdreißiger in Jeans und weißem Hemd, sitzt in einem Park und erinnert sich: „In den 90ern konnten Nazis ungestört Menschen totschlagen“, sagt der Ex-Aktivist, damals Stichwortgeber für linksradikale Kampagnen. „Das hat uns empört, es hat angetrieben, Mut erzwungen.“ Heute seien es die Eliten, die provozierten, indem sie selbstherrlich ihre Macht zur Schau stellten, schiebt der junge Vater schon weniger energisch nach.
Da die Krisenproteste derzeit meist friedlich bleiben, sehen sich Autonome als militante Avantgarde. Doch was wollen sie? Eine herrschaftsfreie, klassenlose Gesellschaft, sagen sie gern. Erlebnishunger und Selbstverwirklichung dürften für die meist jungen Studenten aber wichtiger sein als kühle Politikstrategie. Zwar nehmen viele auch mal an Aktionen der Gewerkschaften oder der Globalisierungskritiker von Attac teil. Doch anders als die IG Metall sind die Autonomen kein Verband, sondern ein Lifestyle, dessen Anhänger wie Jan oft nur fünf, sechs Jahre dabei bleiben.
Die Öffentlichkeit ist gespalten: Während die einen die politischen Motive – gegen Nazis, Krieg, Kapitalismus – anerkennen, unterstellen andere, dass der Krawall nur der Selbstdarstellung jugendlicher „Chaoten“ dient.
Ein strategisches Konzept hat die Szene nicht. Sie ist eine Subkultur, ihre diffusen Positionen dienen vor allem der Identitätsbildung. Das radikale Auftreten paart sich mit oft abgehobener Kritik an „banalen“ materiellen Wünschen – etwa höheren Löhnen. Was kaum verwundert: Ein Großteil der Szene kommt aus gut situierten Elternhäusern.
Die meisten Autonomen mögen mit dem spektakulären Lokführerstreik 2007 sympathisiert haben – unterstützt haben sie ihn nicht. Für Kämpfe in staubigen Betriebshallen, womöglich mit einer Belegschaft in Blaumännern, hat man in der Szene wenig übrig. Anders als marxistischen Gruppen geht es Autonomen um Abenteuer, das Gefühl etwas Krasses getan zu haben. „Bei den Autonomen lernt man all das, was man später als Manager braucht“, sagt ein Beobachter der Szene. Selbstdarstellung, Improvisationstalent, Entschlossenheit.
Trotz ihres geschlossenen Auftretens ist die Szene tief gespalten. Die Geister scheiden sich am Nahostkonflikt. Die einen solidarisieren sich mit der Dritten Welt – einschließlich der arabischen Massen. Die anderen bezeichnen sich als antideutsch und warnen überall vor Antisemitismus und Deutschtümelei. Karriere machen Letztere meist am schnellsten. Viele Hausbesetzer etwa bleiben sich dagegen lange treu. Für beide Seiten gilt: Vorbei sind die Zeiten, in denen Arbeiterkinder und Schulabbrecher so etwas wie unerschrockene Wortführer waren. Die Autonomen des 21. Jahrhunderts haben – wenn sie sich rechtzeitig aus der Szene verabschieden – vergleichsweise gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das macht es auch der Polizei schwer. Proletenkinder werden schneller erwischt. Sei es, weil sie den Tricks der Ermittler nicht gewachsen sind. Sei es, weil sie ihre Taten nach ein paar Bieren begehen. Autonome sind cleverer. Kürzlich konnten 100 Vermummte nach Krawallen am Rosenthaler Platz unerkannt entkommen.
Auch Jan, der eloquente Mittdreißiger, ist nie erwischt worden. Er hat ein, zwei mal Barrikaden gebaut und die Fensterscheiben eines rechtsradikalen Treffs eingeworfen. Nach dem Studium hat Jan seine schwarze Jacke gegen ein weißes Hemd getauscht und sein in der Szene erprobtes Organisationstalent genutzt: Die Jobs, die er bekam, wurden immer besser. Heute fährt er BMW.
(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 29.04.2009)
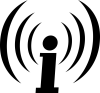
|
linksunten Archiv |
|
Militante ManagerschuleQuelle:
Erstveröffentlicht:
29.04.2009
|

traurig
ich bin traurig über den ledensweg von jan
ich will nie so werden wie er
er hatdie ideale verraten
siehe "die fetten jahre sind vorbei"