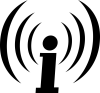Vom 6.-16. Mai 2011 wird eine Soliwoche gegen Repression stattfinden. Das bedeutet: Eine Woche feiern gegen Herrschaft und Unterdrückung. Mit der Aktionswoche soll das Thema Repression in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden; mit Infoveranstaltungen, Soliküchen, Partys und was euch sonst noch einfällt, soll über die Tierbefreiungsbewegung und staatliche Repression informiert werden. Da Repression die davon Betroffenen viel Geld kostet (AnwältInnen, Gerichtsverfahren etc.), soll der Erlös der Veranstaltungen komplett in Antirepressionsarbeit fließen und möglichst viele AktivistInnen der Tierbefreiungsbewegung unterstützen. Gerichtsverfahren und Klagen von Wirtschaftskonzernen der Tierausbeutungsindustrie werden mehr. Massive Eingriffe in die Privatsphäre durch Überwachung, Hausdurchsuchungen, bis hin zu Inhaftierungen von TierbefreiungsaktivistInnen, nehmen zu. Menschen, die sich für die Befreiung von Mensch und Tier einsetzen, sind in immer größerem Ausmaß von staatlicher Gewalt betroffen.
Staat und Tierausbeutungsindustrie arbeiten Hand in Hand, wenn es darum geht, AktivistInnen finanziell, psychisch und physisch zu ruinieren. Dem können wir nur mit Solidarität begegnen. Wenn die Institutionen von Staat und Wirtschaft glauben, mit Gewalt und Einschüchterungsversuchen die Bewegung für die Befreiung von Mensch und Tier zu schwächen, irren sie sich. Die staatliche Gewalt mag wie ein Schlag in unser Gesicht sein, Hausdurchsuchungen und Gerichtsverfahren mögen uns kurzfristig schwächen und Gefängnisstrafen einige von uns über Jahre unter totale staatliche Kontrolle bringen; stoppen können sie uns damit aber nicht. Weltweit ist der Trend der Einschüchterung und der Versuch, emanzipatorische Bewegungen zu kriminalisieren, vermehrt erkennbar. Wenn die Herrschenden und jene, die von Ausbeutung profitieren, glauben, uns damit lahmlegen zu können, täuschen sie sich. Wir lassen uns nicht einschüchtern! Wir zeigen, dass Formen von Unterdrückung vielseitig und komplex sind und nicht isoliert betrachtet werden können, sondern miteinander verschränkt sind. Für eine freie und solidarische Gesellschaft muss auf allen Ebenen und immer wieder auch gemeinsam gekämpft werden. Mit staatlicher und ökonomischer Gewalt wächst unser Widerstand. In diesem Sinne: Wir sehen uns auf den Straßen, in Mastanlagen und Pelzfarmen, vor Tierlabors und Knästen, am Tag und bei Nacht, wir sehen uns im Gerichtssaal, wir sitzen im Publikum ganz hinten oder auch mal ganz vorne, wir lachen, klatschen und schlagen Türen zu, wenn wir uns danach fühlen und freuen uns auf die nächsten Vorstellungen!
Bis jeder Knast und jeder Käfig leer ist!
Achtet im Mai auf Ankündigungen für eure Städte (z.B. hier). Wenn ihr selbst Ideen für Aktionen oder Veranstaltungen im Zuge der Antirep-Woche habt, teilt das der Koordinationsgruppe mit. Helft auch mit, die Repressionschronik zu vervollständigen.
Im Rahmen des Projektes hat die Antispeziesistische Aktion Tübingen einen Text verfasst, der sich u.a. auch auf der Aktionsseite totalliberation.blogsport.de findet. Es folgt eine Version des Textes ohne Bilder (zum Originaltext mit Bildern).
DIE TIERE ROSA LUXEMBURGS
Dieser Text ist im Rahmen des Projekts totalliberation allen Tierrechtsgefangenen gewidmet. Bleibt fest und klar und heiter; ja heiter, trotz alledem!
"COAGULA / Auch deine / Wunde, Rosa. / Und das Hörnerlicht deiner / rumänischen Büffel / an Sternes Statt überm Sandbett, im / redenden, rot- / aschengewaltigen / Kolben." - Paul Celan, 1965.
Solidarität mit den quälbaren Körpern
Rosa Luxemburg: Marxistische Theoretikerin, bedeutende Vertreterin des proletarischen Internationalismus, Antimilitaristin, Gründungsmitglied der KPD, Revolutionärin - am 15. Januar 1919 von der Reaktion ermordet. Zuvor, während des ersten Weltkriegs, hatte sie insgesamt drei Jahre und vier Monate in verschiedenen Gefängnissen verbracht, bis sie im November 1918 im Zuge der Novemberrevolution befreit wurde und nach Berlin zurückkehren konnte. Als Mitherausgeberin der Zeitung Die Rote Fahne nahm sie täglich Einfluss auf die Entwicklung der Revolution. In einem ihrer ersten Artikel forderte sie die Amnestie aller politischen Gefangenen und die Abschaffung der Todesstrafe. Denn eine ihrer Grundüberzeugungen war, wie sie einmal in einem Brief schrieb: "Ich weiß, für jeden Menschen, jede Kreatur, ist eigenes Leben das einzige, einmalige Gut, das man hat, und mit jedem kleinen Flieglein, das man achtlos zerdrückt, geht die ganze Welt jedesmal unter; für das brechende Auge dieses Fliegleins ist alles so gut aus, als wenn der Weltuntergang alles Leben vernichtete."1
Der Historiker, Philosoph und Kulturwissenschaftler Moshe Zuckermann interpretiert das Denken und Handeln Rosa Luxemburgs als visionären Kampf um Versöhnung von Mensch und Natur. Ihr Leben und ihr Tod stehen für ihn "im Zeichen einer gedachten wie gelebten Aufbäumung gegen erlittenes Leid von Mensch und Tier, der existenziellen Weigerung, sich mit den Repressionsstrukturen fehlgelaufener zivilisatorischer Entwicklung abzufinden und zu versöhnen." Ihren Kampf um Befreiung und Freiheit der Leidenden in Gesellschaft und Natur, den Kampf gegen menschgemachte Repression, habe Rosa Luxemburg mit selbsterfahrener Repression, die in der Auslöschung ihres Lebens gemündet sei, bezahlt. "Dieser Preis steht für etwas, das über das grauenvolle Ende der Revolutionärin hinausgeht: das unweigerlich mitzubedenkende Opfer, welches man der Emanzipation darzubieten hat, wenn es darum geht, ein menschliches Dasein zu schaffen, in dem Leid von Mensch und Tier historisch überwunden wären" - so der Ankündigungstext des Vortrags von Moshe Zuckermann über Rosa Luxemburg – erlebtes Leid, Mitgefühl und gesellschaftliche Revolution, den er auf dem im Oktober 2010 in Hamburg abgehaltenen internationalen Antirepressionskongress New Roads of Solidarity hielt.
Ein Ausspruch Rosa Luxemburgs lautet: "Rücksichtsloseste revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit, dies allein ist der wahre Odem des Sozialismus. Eine Welt muß umgestürzt werden, aber jede Träne, die geflossen ist, obwohl sie abgewischt werden konnte, ist eine Anklage; und ein zu wichtigem Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen." - Ihr zu entgegnen, die Revolution habe eben ihren Preis und der Mensch müsse schließlich essen, hieße nach Zuckermann nichts weniger, als die fundamentale Weigerung, Leiden in welcher Form auch immer zu akzeptieren, preiszugeben. Empathie und Leiderfahrung seien bei Rosa Luxemburg ein zentrales Moment, sie sei sogar der Überzeugung gewesen, dass es keine Emanzipation des Menschen ohne Emanzipation der Natur geben könne. Zuckermann plädiert deshalb dafür, die theoretische Forderung nach internationaler Solidarität um den Komplex umfassender Leiderfahrung zu erweitern. Bei der Entwicklung neuer sozialistischer Perspektiven muss ein Umstand Beachtung finden: Dass unsere Zivilisation "die industrielle Menschen- und Tiervernichtung zur kultur-barbarischen Perfektion getrieben hat", wie es Zuckermann in seinem Aphorismus Zertretener Wurm, den er als Solidaritätsbekundung für die in Österreich vor Gericht stehenden TierbefreiungsaktivistInnen Kevin, Sabine, Christof, Jan, Leo und für "all die anderen, die für eine wahrhaft menschliche Welt kämpfen", verfasst hat, ausdrückt. Auf den Einwand, man solle da tunlichst Mensch und Tier auseinanderhalten, antwortet er: "Wann hätte das selbstherrlich argumentierte Auseinanderhalten die Menschen je davon abgehalten, sich gegenseitig so abzuschlachten, ‚als wären sie Tiere‘?"
Unsere Bewegung beruht, wie die feministische Sozialistin Donna Haraway - die ihr selbst übrigens nicht angehört - einmal schreibt, nicht auf der irrationalen Verleugnung der Einzigartigkeit des Menschen, sondern „auf der klarsichtigen Erkenntnis einer sehr realen Verbundenheit, die quer zu dem diskreditierten Bruch zwischen Natur und Kultur verläuft.“ Die Aufgabe der politischen Tierbefreiungsbewegung als Teil der emanzipatorischen Linken muss sein, darauf aufmerksam zu machen, dass die Forderung nach Emanzipation im Zuge einer sozialen Umwälzung diejenigen nicht ausschließen darf, die in unserem Gesellschaftsbau ganz unten angesiedelt sind - in der "Tierhölle in der menschlichen Gesellschaft", wie es Max Horkheimer in seinem berühmten Text Der Wolkenkratzer von 1934 ausdrückt, in dem er als "Querschnitt durch den Gesellschaftsbau der Gegenwart" die Metapher eines Hauses benutzt, dessen Keller ein Schlachthof und dessen Dach eine Kathedrale sei. Dieses Haus "gewährt in der Tat aus den Fenstern der oberen Stockwerke eine schöne Aussicht" – wir sollten unsere Augen aber vor dem Blick nach unten nicht verschließen. Dabei kann sich unsere Solidarität nicht nur auf andere Menschen beschränken, genauso wenig, wie unser Bestreben sich nicht nur auf das Wohl nichtmenschlicher Tiere richten sollte - denn damit hätten wir jeweils lediglich Teilaspekte des Ausbeutungsapparates im Auge. Unsere Bewegung kämpft gegen Tierausbeutung, ohne dabei die Befreiung der Menschen aus dem Auge zu verlieren; sie übt damit eine umfassende "Solidarität mit den quälbaren Körpern" (Theodor W. Adorno).
Wenn es darum geht, die Solidarität mit den Unterdrückten auf die quälbaren Körper - egal, welcher Spezies sie angehören -, auszuweiten und die Befreiung der Tiere in die Forderung nach einem Ende der Ausbeutungsverhältnisse mit aufzunehmen, so kann das Denken Rosa Luxemburgs in dieser Hinsicht tatsächlich einige visionäre Impulse geben. Es gibt auch eine gewisse linke Tradition, die diese Forderung bereits explizit formulierte - hier sind etwa Leonard Nelson und der Internationale Sozialistische Kampfbund sowie die Frankfurter Schule zu nennen -, eine breitere soziale Bewegung aber, um sie durchzusetzen, bildet sich erst in den letzten Jahrzehnten. Diese ist allerdings vorwiegend aktionsorientiert; das theoretische Fundament der Tierbefreiungsbewegung befindet sich im Moment noch im Aufbau, es gibt noch keinen gefestigten politischen Rahmen, was z.B. in Bezug auf mögliche BündnispartnerInnen mitunter bis hin zur Tolerierung von Positionen führen kann, die dem emanzipatorischen Anspruch der Bewegung zuwiderlaufen. Rosa Luxemburgs Leben, Wirken und Tod können der jungen Bewegung in dieser Hinsicht Orientierung geben, denn sie symbolisieren, wie Moshe Zuckermann es in einem zuerst im März 2010 in der Tageszeitung junge welt erschienenen Artikel ausdrückte, "unbeirrbaren Humanismus, rigorosen Widerstand gegen Bejubelung von Krieg und Aggression, uneingeschränkte Insistenz auf Wahrung der Marxschen Emanzipationspostulate, konsequenten Kampf gegen Knechtung von Geist und Gewissen und eine endlose Mitleidsfähigkeit, natürliche Bereitschaft zur Wahrnehmung von Leiderfahrung und Geschundenheit menschlicher wie tierischer Kreaturen."
Rosa Luxemburgs Tiere
Eine Betrachtung, die sich der Frage widmet, welche Rolle Tiere in der Erfahrungswelt der Rosa Luxemburg gespielt haben, wäre nicht vollständig, fände die Katze Mimi keine Erwähnung. Aus der Zeit zwischen 1907 und 1915, als Rosa Luxemburg eine Liebesbeziehung zu Kostja Zetkin pflegte, gibt es kaum einen Brief an den Geliebten, in dem nicht auch über sie berichtet wird; die meisten Briefe enden außerdem mit Wendungen wie "Wir grüßen Dich" , "Wir küssen Dich beide" oder "Liebling, sei heiter, ich küsse dich auf den süßen Schnabel, Mimi auch". Im Rahmen eines solchen Briefes vom 5. Juli 1910 übt Rosa Luxemburg übrigens auch Kritik an der Jagd, indem sie sich über den Berliner Arzt Arthur Süßmann mokiert: "Denk Dir, der dumme Süßmann, der ein großer Jäger vor Jehova ist, sagte mir, als er Mimi sah, er hätte erst neulich etwa ein Dutzend Katzen erschossen [...]. Die Bauern beklagten sich über dieses Niederknallen der Katzen, aber die Herren Jäger aus Berlin glauben sich im Recht, ‚dem Wildschaden‘ zu wehren."
Als sie 1917 in der Festung Wronke (Posen) inhaftiert ist, schreibt sie ihrer Freundin Sophie Lieknecht,, der Frau von Karl Liebknecht, der im Zuchthaus Luckau als "Landesverräter" einsaß, sie habe den "heroischen Entschluß" gefasst, Mimi nicht zu sich ins Gefängnis kommen zu lassen, denn sie sei "gewöhnt an Munterkeit und Leben, sie hat es gern, wenn ich singe, lache und mit ihr durch alle Zimmer Haschen spiele, sie würde mir hier ja trübsinnig werden." Das mag wohl eine schwere, aber sicher richtige Entscheidung gewesen sein, vergegenwärtigt man sich die Lebensbedingungen in Haft. Rosa Luxemburg vergleicht ihre eigene Situation als Inhaftierte mit jener eines Tiers im Käfig oder "eines wilden Tieres im Zoo", ihr Herz sei "schon gewöhnt, zu parieren wie ein gut dressierter Hund". Dennoch betont sie ihrer Freundin gegenüber, die sie mit den Kosenamen "Sonitschka" und "Sonjuscha" anschreibt, stets, sie sei ruhig und heiter, und ermahnt auch sie: "Bleiben Sie ruhig und heiter, trotz alledem!"
Rosa Luxemburg war vom 10. Juli bis zum 26. Oktober 1916 in Berlin inhaftiert, im Polizeigefängnis am Alexanderplatz und im Frauengefängnis in der Barnimstraße. Im Herbst wurde sie nach Wronke verlegt. Der Ort, zu deutsch "Krähenwinkel", lag in dem von Preußen annektierten und dem Deutschen Reich eingegliederten polnischen Gebiet. Im Juli 1917 schließlich wurde sie in die Breslauer Gefängnisanstalt überführt. Die Briefe, die sie im Gefängnis geschrieben hat, legen Zeugnis ab von ihrer Zuversicht und Stärke, die sie sich auch in misslichen Lagen immer bewahrt hat. Darüber hinaus zeigt sich in ihnen ihre fast grenzenlose Empathie gegenüber Tieren, die sich in einer Sprache ausdrückt, die frei von speziesistischen Wendungen ist. Betrachtet man Formulierungen wie beispielsweise "Gestern, am 1. Mai, begegnete mir - raten Sie wer? - ein strahlender frischer Zitronenfalter!" wird deutlich, dass Rosa Luxemburg Tieren keineswegs als bloßes Exemplar oder als Objekt von Studien begegnet. Im Gegenteil nimmt sie sie stets als Individuen wahr. So schrieb sie auch bereits im Dezember 1914 an Kostja Zetkin: "Wir haben viele Freunde in diesem Jahr verloren: Jaurès, Faisstling und das kleine Kätzlein. Das war ein böses Jahr." Der französische Sozialist Jean Jaurès war am 31. Juli in Paris ermordet worden, der Heilbronner Rechtsanwalt Hugo Faisst war am 30. Juli gestorben, bei der Katze handelte es sich um eine der Katzen der Familie Zetkin - im November hatte Rosa Luxemburg durch Briefe von Kostja Zetkin zuerst erfahren, dass sie krank geworden, und in einem zweiten Brief, dass sie gestorben sei. Wie man aus einem Brief Rosa Luxemburgs vom 12. Juni 1916 an Clara Zetkin entnehmen kann, gab es unter den Tieren, die bei den Zetkins lebten, in der Folgezeit noch weitere Todesfälle; sie schreibt: "Wir haben in diesen zwei Jahren so viele Freunde verloren: Faisst, die Mimige, den kleinen Peterling, jetzt Wölfer; auch den lieben dummen Troll. Sie werden alle nicht vergessen."
In der Haft beschäftigt sich Rosa Luxemburg, wie sie schreibt, vor allem mit Pflanzen- und Tiergeografie. Auch ihren Freundinnen Sophie Liebknecht und Mathilde Jacob rät sie, viel im Freien zu sein, zu "botanisieren". Sie selbst kann das nur begrenzt. In ihrer Haftzeit in Wronke besteht immerhin die Möglichkeit, Zuflucht in einen kleinen Garten zu nehmen; diese nutzt sie intensiv: "Ich bin jetzt fast den ganzen Tag draußen, schlendre in den Sträuchern herum, suche alle Winkel meines Gärtleins ab und finde allerlei Schätze", schreibt sie am 2. Mai 1917. Im Garten begegnen ihr die verschiedensten Tiere. Am 5. April schreibt sie über Wespen: "Sie tun mir nie was, setzen sich mir im Freien sogar auf die Lippen, was sehr kitzelt"; am 13. April weiß sie zu berichten: "Zu uns sind jetzt viele Zwergmäuse vom Feld ins Gefängnis hineingekommen, weil es draußen naß ist"; am 15. April erzählt sie, sie besuche im Garten jeden Tag einen Marienkäfer, beobachte die Wolken und "fühle mich im ganzen nicht wichtiger als dieses Marienkäferlein und in diesem Gefühl meiner Winzigkeit unaussprechlich glücklich."
Besonders angetan aber haben es ihr Vögel; das merkt man schon daran, dass sie ihre Freundin in den Briefen stets als ein "Vögelein" bezeichnet. Mitte November 1917 beispielsweise schreibt sie: "Sonitschka, mein liebes Vöglein, wie oft denke ich an Sie; vielmehr sind Sie mir ständig gegenwärtig, und stets habe ich das Gefühl, Sie seien einsam und verweht wie ein frierender Sperling, und ich müßte um Sie sein, um sie aufzuheitern und zu beleben", und weiter: "Es ist zum Lachen und zum Weinen, daß ein so zartes Vöglein, das zum Sonnenschein und unbekümmerten Gesang geboren war, wie Sie, in eine der düstersten und grausamsten Perioden der Weltgeschichte vom Schicksal verschlagen ward. Aber wir werden jedenfalls Seite an Seite die Zeiten durchschwimmen, und es wird schon gehen." Nachdem sie über den Vogelzug geschrieben hat, dass dort verschiede Arten, die sich sonst als Todfeinde befehden, friedlich nebeneinander die große Reise südwärts übers Meer machen, ja, man sogar beobachtet habe, dass auf dieser Reise große Vögel viele kleine auf ihrem Rücken transportieren - an den Arzt Hans Diefenbach, mit dem sie befreundet ist, schreibt sie in diesem Zusammenhang: "Wenn ich so etwas lese, bin ich erschüttert und lebensfreudig gestimmt, daß ich sogar Breslau für einen Ort halte, in dem Menschen leben können" -, meint sie: "Wenn es also mal auch für uns heißt, in Sturm und Drang ‚über das große Meer‘ zu fliegen, dann nehmen wir die Sonitschka auf den Buckel, und sie wird uns dort unterwegs sorglos zwitschern".
Bereits im Dezember 1916 wusste sie Luise Kautsky in der ihr eigenen tragischen Komik zu berichten, Elstern seien ihr "einziges Auditorium hier" - sie bringe ihnen "die weltstürzendsten Ideen und Losungen bei und lasse sie dann wieder losflattern". Zu einigen Vögeln, denen sie in ihrer Haftzeit in Wronke begegnet, entwickelt Rosa Luxemburg eine besondere Beziehung - sie bezeichnet sie schnell als ihre Freunde. Am 23. Mai 1917 schreibt sie an Sophie Liebknecht, sollte sie im Herbst noch in Wronke sein, "dann werden alle meine Freunde wieder zurückkehren und an meinem Fenster Futter suchen; ich freue mich schon jetzt auf die eine Kohlmeise, mit der ich besonders befreundet bin." Im selben Brief berichtet sie von einer Blaumeise. Seit Anfang Mai sei die Meise verschwunden gewesen, um zu brüten. Aber:
"Gestern höre ich plötzlich von drüben über die Mauer, die unseren Hof von einem anderen Gefängnisterrain trennt, den bekannten Gruß, aber so ganz verändert, nur ganz kurz und eilig dreimal hintereinander: ‚Zizi bä - Zizi bä - Zizi bä!‘, dann wurde es still. Mir zuckte das Herz bei zusammen, so viel lag in diesem eiligen, fernen Ruf: eine ganze Vogelgeschichte [...]. Meine Mutter, die nebst Schiller die Bibel für der höchsten Weisheit Quell hielt, glaubte steif und fest, daß König Salomo die Sprache der Vögel verstand. Ich lächelte damals mit der ganzen Überlegenheit meiner fünfzehn Jahre und einer modernen naturwissenschaftlichen Bildung über diese mütterliche Naivität. Jetzt bin ich selbst wie König Salomo: Ich verstehe auch die Sprache der Vögel und aller Tiere. Natürlich nicht, als ob sie menschliche Worte gebrauchten, sondern ich verstehe die verschiedensten Nuancen und Empfindungen, die sie in ihre Laute legen. Nur dem rohen Ohr eines gleichgültigen Menschen ist ein Vogelgesang immer ein und dasselbe. Wenn man die Tiere liebt und für sie Verständnis hat, findet man große Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, eine ganze ‚Sprache‘."
Doch im Herbst ist Rosa Luxemburg nicht mehr in Wronke. Am 22. Juli 1917 wird sie ins Gefängnis in Breslau überführt. Dort sind die Haftbedingungen schlechter. Am 2. August schreibt sie an Sophie Liebknecht: "Was mir hier fehlt, ist natürlich die relative Bewegungsfreiheit, die ich dort hatte, wo die Festung den ganzen Tag offenstand, während ich hier einfach eingesperrt bin, dann die herrliche Luft, der Garten und vor allem die Vögel! Sie haben keine Ahnung, wie ich an dieser kleinen Gesellschaft hing." Bedrückt berichtet sie Hans Diefenbach am 13. August, in Breslau führe sie das regelrechte Dasein einer Strafgefangenen. Auf dem gepflasterten Gefängnishof gebe es nichts zu entdecken. "Der Abrutsch nach Wronke ist in jeder Hinsicht ein schroffer, aber dies nicht als Klage, sondern nur zur Erklärung, weshalb ich Ihnen vorläuftig keinen aus Rosenduft, Himmelblau und Wolkenschleiern gewobenen Brief schreiben kann, wie Sie's aus Wronke gewöhnt sind", meint sie, und weiter: "Die Heiterkeit wird mir schon noch zurückkommen - trage ich sie doch in mir selbst in unerschöpflichen Mengen". Im Hof gebe es nur zwei schmale Rasenstreifen. Immerhin habe sie bereits die vorkommenden Spezies festgestellt: Schafgarben und Habichtkräuter, um die Kohlweißlinge flatterten. Außerdem gebe es Tauben.
Zu einer der Tauben entwickelt sie eine "schweigsame Freundschaft", wie sie gegenüber Mathilde Jacob am 3. Juni 1918 berichtet: "Die braune Taube, die ich hier im Winter in meiner Zelle pflegte, als sie krank war, erinnert sich wohl meiner ‚Wohltaten‘: Sie hat mich einmal in dem Hof, wo ich nachmittags spazierengehe, entdeckt, und wartet nun jeden Tag pünktlich auf mich, sitzt neben mir aufgeplustert auf dem Kies oder läuft mir nach, wenn ich eine Runde mache." Die Tauben spazieren alsbald sogar in der Zelle herum, und am 12. September schreibt Rosa Luxemburg: "Ich war jetzt ein paar Tage bettlägerig, da kamen die Tauben - zu mir aufs Bett!"
Immer wieder bricht unter den erschwerten Haftbedingungen nun das Gefühl der Verzweiflung durch. Am 30. März 1917 schreibt Rosa Luxemburg an Hans Diefenbach:
"Ich fühle mich wie eine erfrorene Hummel; haben Sie schon mal im Garten an den ersten frostigen Herbstmorgen eine solche Hummel gefunden, wie sie ganz klamm, wie tot, auf dem Rücken liegt im Gras, die Beinchen eingezogen und das Pelzlein mit Reif bedeckt? Erst wenn die Sonne sie ordentlich durchwärmt, fangen die Beinchen sich langsam zu regen und zu strecken an, dann wälzt sich das Körperchen um und erhebt sich endlich mit Gebrumm schwerfällig in die Luft. Es war immer mein Geschäft, an solchen erfrorenen Hummeln niederzuknien und sie mit dem warmen Atem meines Mundes zum Leben zu wecken. Wenn mich Arme doch die Sonne auch schon aus meiner Todeskälte erwecken wollte!"
Auch am 5. Juni geht es Rosa Luxemburg wieder sehr schlecht. An Sophie Liebknecht schreibt sie: "Seit ich Ihnen meinen letzten Jubelbrief über die Frühlingsherrlichkeit schrieb, ist es hier plötzlich kalt und grau geworden, und ich leide Qualen. [...] ich weiß gar nichts mehr, ich verstehe nichts, nichts, als daß ich leide." Der Anblick eines sterbenden Schmetterlings wird nun zum Symbol für ihre eigene Lage: "Das halbtote Pfauenauge, das ich gerettet habe, ist in mein Zimmer zurückgekehrt, hat sich in einen dunklen Winkel mit zusammengeklappten Flügeln hingehockt und bleibt regungslos. Ich werde ebenso tun." - Am 8. Juni schließlich berichtet sie über den Tod des Pfauenauges, der sie sehr mitnimmt: "Mein kleiner Freund, den ich so hütete, ist mir doch heute nacht gestorben, und ich schicke Ihnen seine Leiche. Ich sah gerade noch nach ihm, wie es ihm gehe, als er die letzte Zuckung machte und mit ausgebreiteten Flügelchen flach auf das Fenster fiel. Sehen Sie, wie seine Beinchen krampfhaft gekrümmt und an den Körper gepreßt sind: Das ist die typische Haltung des Todeskampfes bei allen Tieren. Ich konnte heute die ganze Nacht kein Auge schließen".
In ihrer Haftzeit in Breslau hält Rosa Luxemburg im Dezember 1917 auch eine Erfahrung fest, die für Ingolf Bossenz, Redakteur bei der Tageszeitung Neues Deutschland, der in seinem Artikel Die Linke und der "Marxismus ohne Fleisch" fordert, dass die Solidarität mit den Tieren endlich integrales Element sozialistischer Programmatik und Praxis werden sollte, "zum Eindrucksvollsten, was sich in sozialistischer Literatur zum Thema ‚Solidarität mit den Tieren‘ findet", gehört: Büffel, als Zugtiere vor einen Karren gesperrt, werden von Soldaten auf dem Gefängnishof geprügelt, bis sie bluten. Dies mit anzusehen, bedeutet für Rosa Luxemburg, "einen scharfen Schmerz" zu erleben. Sie schreibt:
"Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen ... Die Soldaten, die den Wagen fuhren, erzählen, daß es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen, und noch schwerer, sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis sie begreifen lernten, daß sie den Krieg verloren hatten und daß für sie das Wort gilt: ‚vae victis‘ [wehe den Besiegten] ... An hundert Stück der Tiere sollen in Breslau allein sein; dazu bekommen sie, die an die üppige rumänische Weide gewohnt waren, elendes und karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen, und gehen dabei rasch zugrunde. - Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, daß die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, daß die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte! ‚Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid‘, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein ... Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete ... Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft, und eins, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll ... Ich stand davor, und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter - es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar, verloren die schönen freien, saftiggrünen Weiden Rumäniens! Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute der Vögel, die man dort hörte, oder das melodische Rufen der Hirten. Und hier - diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende muffige Heu mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren Menschen und - die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt ... Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumm und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht."
Der Tübinger Literaturhistoriker Walter Jens sprach einmal von "einem Höchstmaß an verläßlicher Erkundung jener äußeren Welt, deren soziale, durch die Herrschaft einer winzigen Minorität bedingte Misere die Gefangene [...] auf den Begriff gebracht" habe, als sie das Leiden des Büffels beschrieb. In ihrem Artikel über den Hamburger Antirepressionskongress in der tierbefreiung 69 interpretiert Clarissa Scherzer das Luxemburg-Zitat, mit welchem ja das Programmheft des Kongresses beginnt, folgendermaßen: "Luxemburg fühlt sich eins mit den Büffeln; sieht sich in den Büffeln, nennt sie Brüder, gefangen, ohnmächtig, voll Schmerz und Sehnsucht wie sie, als politische Gefangene in Breslau [...]. Eingesperrt wegen Aufhetzung zum Ungehorsam und Landes- und Hochverrat. Sie fühlt sich solidarisch mit dem Tier, das sie Bruder nennt; beide sind Opfer von Gewaltherrschaft."
Tatsächlich ist das Denken Rosa Luxemburgs bestimmt von einer natürlich empfundenen, grundsätzlichen Verbundenheit mit allen fühlenden Wesen; man kann von einem Solidaritätskonzept sprechen, für das Speziesgrenzen überhaupt nicht zu existieren scheinen oder jedenfalls keinerlei Rolle spielen. Am 2. Mai 1917 etwa schreibt sie, sie habe am Tag vorher über die Ursache des Schwindens von Singvögeln - die zunehmende rationelle Forst- und Gartenkultur sowie der Ackerbau, die den Vögeln die natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen entziehen - gelesen und meint: "Mir war es so weh, als ich das las. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des stillen unaufhaltsamen Untergangs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich so, daß ich weinen mußte." Sogleich stellt sie eine Verbindung her mit dem Schicksal der Indigenen Nordamerikas, die genauso "von ihrem Boden verdrängt und einem stillen, grausamen Untergang preisgegeben" würden. Sie schreibt weiter:
"Aber ich bin ja natürlich krank, daß mich jetzt alles so tief erschüttert. Oder wissen Sie? Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in mißlungener Menschengestalt; innerlich fühle ich mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als – auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja wohl das alles ruhig sagen: Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben: in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den ‚Genossen‘. Und nicht etwa, weil ich in der Natur, wie so viele innerlich bankrotte Politiker, ein Refugium, ein Ausruhen finde. Im Gegenteil, ich finde auch in der Natur auf Schritt und Tritt so viel Grausames, daß ich sehr leide."
Tatsächlich stirbt Rosa Luxemburg nicht einmal zwei Jahre später im revolutionären Kampf - nachdem sie im Hotel Eden verhört und schwer misshandelt worden ist, gibt Waldemar Pabst den Befehl, sie zu ermorden – mit Wissen und Duldung der SPD-Regierung. Erpicht auf eine finanzielle Belohnung, schlägt der am Seitenausgang bereitstehende Jäger Otto Wilhelm Runge sie mit einem Gewehrkolben nieder. Der Freikorps-Leutnant Hermann Souchon springt bei ihrem Abtransport auf den Wagen auf und erschießt die Schwerverletzte mit einem aufgesetzten Schläfenschuss. Ihre letzten Worte sind: "Nicht schießen!" Ihre Leiche wird im Berliner Landwehrkanal entsorgt.2 Ihr letzter Artikel in der Roten Fahne mit dem Titel Die Ordnung herrscht in Berlin endet mit den Worten: "Ihr stumpfen Schergen! Eure ‚Ordnung‘ ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon ‚rasselnd wieder in die Höh' richten‘ und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein!"
Der heutigen Tierbefreiungsbewegung kann die speziesübergreifende Solidarität, die Verbundenheit, die Rosa Luxemburg mit allen leidenden Wesen fühlte - an Hans Diefenbach schrieb sie am 7. Januar 1917: "Sie wissen, ich fühle und leide mit jeglicher Kreatur" -, Inspiration sein. Aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar ist, dass Rosa Luxemburg keine Verbindung herstellte zwischen dieser Empfindung und eigenem Konsum von Tierprodukten. Von Boykotten hielt sie im Allgemeinen nichts: Als während der Proteste gegen die Lebensmittelteuerung in Württemberg - am 15. September 1912 versammelten sich in Stuttgart insgesamt annähernd 10.000 Menschen, um gegen die Erhöhung der Fleischpreise zu protestieren - ein Fleisch- und Wurstboykott beschlossen wurde, kommentierte sie das in einem Brief an Clara Zetkin als "Hornidee". "Rein kleinbürgerliches Kampfmittel, individuelle Aktion statt Massenaktion" sei ein solcher Boykott. Mit Letzterem hat sie allerdings Recht: Boykotte sind in der kapitalistischen Gesellschaft tatsächlich begrenzt wirksam. Aus dieser Perspektive nimmt der Veganismus in der Tierbefreiungsbewegung einen überproportional großen Stellenwert ein. Marco Maurizi von liberazioni sagt dazu in einem Interview aus dem Jahr 2010: "Es ist eine Illusion, dass keine Tiere mehr für einen getötet werden, solange man Teil dieser Gesellschaft ist. Die kapitalistische Gesellschaft funktioniert zwar durch die Individuen, aber sie funktioniert auch auf einer höheren Ebene durch Strukturen, welche die Individuen nicht kontrollieren können, sondern diese durch die Strukturen kontrolliert werden." Allerdings glaubt Maurizi auch, dass es nicht sinnlos ist individuell so zu handeln, wie man sich eine freie Gesellschaft vorstellt: "Eine Gesellschaft, in der es keine Herrschaft über Menschen und Tiere gibt, ist eine Gesellschaft ohne Fleischindustrie, ohne Tierversuche, usw. Der Veganismus ist, meiner Meinung nach, die einzige Möglichkeit eine solche Gesellschaft vorzusehen und praktisch zu beweisen, dass sie möglich ist." Es kommt aber darauf an, nach diesem individuellen Schritt nicht stehenzubleiben. Wenn sich jemals etwas an den herrschenden Verhältnissen ändern soll, müssen wir ein politisches Programm verfolgen, das deren Umsturz zum Inhalt hat. Wir Heutigen, die wir inzwischen nur allzu gut auch um die humanen und ökologischen Katastrophen wissen, welche die Ausbeutung der Tiere mit sich gebracht hat oder mit denen sie verschränkt ist, sollten darauf hinwirken, dass sie, wie auch die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, beendet wird. Dazu ist zunächst notwendig, dass diese Forderung integraler Bestandteil linker emanzipatorischer Programmatik und Praxis wird. Dabei kann uns Solidarität, die über Speziesgrenzen hinausweist, wie sie von Rosa Luxemburg geübt wurde, Vorbild sein.
Antwort einer Unsentimentalen
Jenen, die gewöhnlich den Kampf um Tierbefreiung als "unpolitisch" abtun und in diesem Fall vielleicht die Solidarität, welche die Revolutionärin gegenüber Tieren empfand, als "sentimental" von sich weisen, sei noch mit Karl Kraus geantwortet. Kraus hatte den Brief Rosa Luxemburgs über die misshandelten Büffel im Juli 1920 in der Zeitschrift Die Fackel veröffentlicht, in seinem Geleitwort hatte er geschrieben: "Schmach und Schande jeder Republik, die dieses im deutschen Sprachbereich einzigartige Dokument von Menschlichkeit und Dichtung nicht allem Fibel- und Gelbkreuzchristentum zum Trotz zwischen Goethe und Claudius in ihre Schulbücher aufnimmt und nicht zum Grausen vor der Menschheit dieser Zeit der ihr entwachsenden Jugend mitteilt, daß der Leib, der solch eine hohe Seele umschlossen hat, von Gewehrkolben erschlagen wurde. Die ganze lebende Literatur Deutschlands bringt keine Träne wie die dieser jüdischen Revolutionärin hervor und keine Atempause wie die nach der Beschreibung der Büffelhaut: ‚und die ward zerrissen‘."3 - Daraufhin ging eine anonyme "Antwort an Rosa Luxemburg von einer Unsentimentalen" ein - inzwischen ist bekannt, dass sie von einer Adligen namens Ida von Lill-Rastern von Lilienbach stammte. Diese stellte in ihrem Brief Spekulationen darüber an, um "wie viel ersprießlicher und erfreulicher das Leben der Luxemburg verlaufen wäre, wenn sie sich statt als Volksaufwieglerin etwa als Wärterin in einem Zoologischen Garten od. dgl. betätigt hätte" und schrieb:
"Was die etwas larmoyante Beschreibung des Büffels anbelangt, so will ich es gern glauben, dass dieselbe ihren Eindruck auf die Tränendrüsen der Kommerzienrätinnen u. der ästhetischen Jünglinge in Berlin, Dresden u. Prag nicht verfehlt hat. Wer jedoch, wie ich, auf einem großen Gute Südungarns aufgewachsen ist, u. diese Tiere, ihr meist schäbiges, oft rissiges Fell u. ihren stets stumpfsinnigen ‚Gesichtsausdruck‘ von Jugend auf kennt, betrachtet die Sache ruhiger."
Der Gebrauch der Peitsche dürfte, so die Polemik weiter,
"bei Zugtieren ab u. zu unerläßlich sein, da sie bloßen Vernunftgründen gegenüber nicht immer zugänglich sind, — ebenso wie ich Ihnen als Mutter versichern kann, dass eine Ohrfeige bei kräftigen Buben oft sehr wohltätig wirkt! [...] Die Luxemburg hätte gewiß gerne, wenn es ihr möglich gewesen wäre, den Büffeln Revolution gepredigt u. ihnen eine Büffel-Republik gegründet [...] Es gibt eben viele hysterische Frauen, die sich gern in Alles hineinmischen u. immer Einen gegen den Anderen hetzen möchten; sie werden, wenn sie Geist und einen guten Stil haben, von der Menge willig gehört u. stiften viel Unheil in der Welt, so dass man nicht zu sehr erstaunt sein darf, wenn eine solche, die so oft Gewalt gepredigt hat, auch ein gewaltsames Ende nimmt."
Karl Kraus antwortete ausführlich auf diesen Brief und schrieb unter anderem:
"Was ich meine, ist, dass neben dem Brief der Rosa Luxemburg, wenn sich die sogenannten Republiken dazu aufraffen könnten, ihn durch ihre Lesebücher den aufwachsenden Generationen zu überliefern, gleich der Brief dieser Megäre abgedruckt werden müßte, um der Jugend nicht allein Ehrfurcht vor der Erhabenheit der menschlichen Natur beizubringen, sondern auch Abscheu vor ihrer Niedrigkeit [...] Was ich aber außerdem noch meine — da ja nun einmal meine Meinung und nicht bloß mein Wort gehört werden will — ist: [...] dass die Menschlichkeit, die das Tier als den geliebten Bruder anschaut, doch wertvoller ist als die Bestialität, die solches belustigend findet und mit der Vorstellung scherzt, dass ein Büffel ‚nicht besonders erstaunt‘ ist, in Breslau einen Lastwagenziehen zu müssen und mit dem Ende eines Peitschenstieles ‚Eines übers Fell zu bekommen‘. Denn es ist jene ekelhafte Gewitztheit, die die Herren der Schöpfung und deren Damen ‚von Jugend auf‘ Bescheid wissen läßt, dass im Tier nichts los ist, dass es in demselben Maße gefühllos ist wie sein Besitzer, einfach aus dem Grund, weil es nicht mit der gleichen Portion Hochmut begabt wurde und zudem nicht fähig ist, in dem Kauderwelsch, über welches jener verfügt, seine Leiden preiszugeben. Weil es vor dieser Sorte aber den Vorzug hat, ‚bloßen Vernunftgründen gegenüber nicht immer zugänglich‘ zu sein, erscheint ihr der Peitschenstiel ‚wohl ab und zu unerläßlich‘. Wahrlich, sie verwendet ihn bloß aus dumpfer Wut gegen ein unsicheres Schicksal, das ihr selbst ihn irgendwie vorzubehalten scheint! Sie ohrfeigen auch ihre Kinder nur, deren Kraft sie an der eigenen Kraft messen, oder lassen sie von sexuell disponierten Kandidaten der Theologie nur darum mit Vorliebe martern, weil sie vom Leben oder vom Himmel irgendwas zu befürchten haben. Dabei haben die Kinder doch den Vorteil, dass sie die Schmach, von solchen Eltern geboren zu sein, durch den Entschluß, bessere zu werden, tilgen oder andernfalls sich dafür an den eigenen Kindern rächen können. Den Tieren jedoch, die nur durch Gewalt oder Betrug in die Leibeigenschaft des Menschen gelangen, ist es in dessen Rat bestimmt, sich von ihm entehren zu lassen, bevor sie von ihm gefressen werden. Er beschimpft das Tier, indem er seinesgleichen mit dem Namen des Tiers beschimpft, ja die Kreatur selbst ist ihm nur ein Schimpfwort. Über nichts mehr ist er erstaunt, und dem Tier, das es noch nicht verlernt hat, erlaubt ers nicht. Das Tier darf so wenig erstaunt sein über die Schmach, die er ihm antut, wie er selbst; und wie nur ein Büffel nicht über Breslau staunen soll, so wenig staunt der Gutsbesitzer, wenn der Mensch ein gewaltsames Ende nimmt. Denn wo die Welt für ihre Ordnung in Trümmer geht, da finden sie alles in Ordnung. Was will die gute Luxemburg? Natürlich, sie, die kein Gut besaß außer ihrem Herzen, die einen Büffel als Bruder betrachten wollte, hätte gewiß gern, wenn es ihr möglich gewesen wäre, den Büffeln Revolution gepredigt, ihnen eine Büffel-Republik gegründet [...]. Leider wäre es ihr absolut nicht gelungen, weil es eben auf Erden ja doch weit mehr Büffel gibt als Büffel! Dass sie es am liebsten versucht hätte, beweist eben nur, dass sie zu den vielen hysterischen Frauen gehört hat, die sich gern in Alles hineinmischen und immer Einen gegen den Anderen hetzen möchten. Was ich nun meine, ist, dass in den Kreisen der Gutsbesitzerinnen dieses klinische Bild sich oft so deutlich vom Hintergrund aller Haus- und Feldtätigkeit abhebt, dass man versucht wäre zu glauben, es seien die geborenen Revolutionärinnen. Bei näherem Zusehn würde man jedoch erkennen, dass es nur dumme Gänse sind. Womit man aber wieder in den verbrecherischen Hochmut der Menschenrasse verfiele, die alle ihre Mängel und üblen Eigenschaften mit Vorliebe den wehrlosen Tieren zuschiebt, während es zum Beispiel noch nie einem Ochsen, der in Innsbruck lebt, oder einer Gans, die auf einem großen südungarischen Gut aufgewachsen ist, eingefallen ist, einander einen Innsbrucker oder eine südungarische Gutsbesitzerin zu schelten. Auch würden sie nie, wenn sie sich schon vermäßen, über Geistiges zu urteilen, es beim ‚guten Stil‘ anpacken und gönnerisch eine Eigenschaft anerkennen, die ihnen selbst in so auffallendem Maße abgeht. Sie hätten — wiewohl sie bloßen Vernunftgründen ‚gegenüber‘ nicht immer zugänglich sind — zu viel Takt, einen schlecht geschriebenen Brief abzuschicken, und zu viel Scham, ihn zu schreiben. Keine Gans hat eine so schlechte Feder, dass sie's vermöchte!"
Rosa Luxemburgs Empathie und ihre Solidarität mit Tieren war nicht "sentimental", sondern resultierte aus einer "realen Verbundenheit", wie Donna Haraway sagen würde. Auch ihr Leiden und Sterben soll nicht umsonst, soll nicht sinnlos gewesen sein. Wir sind dazu aufgerufen, ihr Andenken zu ehren, indem wir ihrer unablässigen Forderung nach sozialer Revolution und der Errichtung einer Gesellschaft ohne Ausbeutung folgen. Wir finden, dass ein solcher Prozess auch die Entwicklung eines anderen Verhältnisses zur Natur und die Beendigung des Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisses gegenüber Tieren erfordert.
Im Lebensrausch, trotz alledem
Auf dem SPD-Parteitag 1899 in Hannover sagte Rosa Luxemburg am 11. Oktober: "Die Genossen, die glauben, in Ruhe, ohne Kataklysmus, die Gesellschaft in den Sozialismus hinüberleiten zu können, stehen durchaus nicht auf historischem Boden. Wir brauchen durchaus nicht in der Revolution Heugabeln und Blutvergießen zu verstehen. Eine Revolution kann auch in kulturellen Formen verlaufen, und wenn je eine dazu Aussicht hatte, so ist es gerade die proletarische; denn wir sind die letzten, die zu Gewaltmitteln greifen, die eine brutale Revolution herbeiwünschen könnten. Aber solche Dinge hängen nicht von uns ab, sondern von unseren Gegnern".4 Dass der Vollzug der sozialen Umwälzung, der notwendig ist, um wahre Emanzipation zu erreichen, sehr wahrscheinlich weitere leidvolle Erfahrungen produziert, dessen war Rosa Luxemburg sich vollkommen bewusst. In der ihr eigenen Art und Weise aber verstand sie es, das Leiden nicht zu dem ihr Denken bestimmenden Faktor werden zu lassen. Sie blieb ruhig und heiter, sie lebte, wie sie schreibt, "ständig in einem freudigen Rausch", ihre grundsätzlich lebensfreudige und lebensbejahende Einstellung wurde durch missliche äußere Umstände kaum berührt. Die aus ihrem Marxismus resultierende materialistische Geschichtsauffassung, zu der das Bewusstsein gehört, als Mensch aus der Natur zu stammen, selbst Natur zu sein, und die daraus abgeleitete tief empfundene Verbundenheit mit den zahlreichen anderen Wesen, welche die Natur neben dem Menschen hervorgebracht hat, half ihr, davon abzusehen, Fragen nach dem Sinn des Leidens zu stellen und vermochte ihr Trost und Zuversicht zu spenden:
"Sonjuscha, Sie sind erbittert über meine lange Haft und fragen: ‚Wie kommt das, daß Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen. Wozu ist das alles?‘ [...] Mein Vöglein, die ganze Kulturgeschichte der Menschheit, die nach bescheidenen Schätzungen einige zwanzig Jahrtausende zählt, basiert auf der ‚Entscheidung von Menschen über andere Menschen‘, was in den materiellen Lebensbedingungen tiefe Wurzeln hat. Erst eine weitere qualvolle Entwicklung vermag dies zu ändern, wir sind ja gerade jetzt Zeugen eines dieser qualvollen Kapitel, und sie fragen: ‚Wozu das alles?‘ ‚Wozu‘ ist überhaupt kein Begriff für die Gesamtheit des Lebens und seine Formen. Wozu gibt es Blaumeisen auf der Welt? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich freue mich, daß es welche gibt, und empfinde als süßen Trost, wenn mir plötzlich über die Mauer ein eiliges ‚Zizi bä‘ aus der Ferne herübertönt."
Dennoch war sie sich der ganzen Ungerechtigkeit und des Wahnsinns des "großen Irrenhauses", das unsere momentane Gesellschaft ist, stets bewusst und verdrängte dieses Wissen und auch die Wut darüber nicht:
"Ich habe das Gefühl, daß dieser ganze moralische Schlamm, durch den wir waten, dieses große Irrenhaus, in dem wir leben, auf einmal, so von heute auf morgen wie durch einen Zauberstab ins Gegenteil umschlagen, in ungeheuer Großes und Heldenhaftes umschlagen kann [...]. Dann werden genau dieselben Leute, die jetzt den Namen Mensch in unseren Augen schänden, im Heroismus mitrasen und alles Heutige wird weggewischt und vertilgt und vergessen sein, wie wenn es nie gewesen wäre. Ich muß bei diesem Gedanken lachen, und zugleich im Innern regt sich bei mir der Schrei nach Vergeltung, nach Strafe: Wie, diese, alle Schurkereien sollen vergessen und unbestraft bleiben, und der heutige Auswurf der Menschheit soll morgen mit gehobenem Haupt, womöglich mit frischen Lorbeeren gekrönt, auf den Höhen der Menschheit wandeln und die höchsten Ideale verwirklichen helfen? Aber so ist Geschichte. Ich weiß ganz genau, daß die Abrechnung nach ‚Gerechtigkeit‘ niemals stattfindet und daß man schon so alles hinnehmen muß. Ich weiß noch, wie ich mit heißen Tränen in Zürich als Studentin einmal Professor Sibers ‚Otscherki perwobytnoi ekonomitscheskoi kultury‘ las, wo die systematische Verdrängung und Austilgung der Rothäute Amerikas durch die Europäer beschrieben ist, und ich ballte die Fäuste vor Verzweiflung, nicht nur, daß solches möglich war, sondern daß das alles nicht gerächt, bestraft, vergolten worden ist. Ich zitterte vor Schmerz, daß jene Spanier, jene Angloamerikaner längst gestorben und vermodert sind und nicht wiedererweckt werden können, damit an ihnen all die Martern, die sie den Indianern zugefügt, vorgenommen werden."
Doch dies seien "kindische Auffassungen", weist sie sich selbst zurecht - Luxemburg weiß genau, dass auch alle heutigen Ungerechtigkeiten, dass "all die Niedertracht sich in dem Wust historischer unbeglichener Rechnungen" verlieren werden. Auch wir müssen mit den uns zugefügten Ungerechtigkeiten zurechtkommen, so wie wir damit zurechtkommen müssen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht solidarisch ist, sondern sich nach dem Prinzip von Konkurrenz und Ausbeutung gestaltet, und die noch immer großenteils von dem "Stumpfsinn [...] Tieren gegenüber", den bereits Rosa Luxemburg beklagte, beherrscht ist. Der Ungerechtigkeit gegenüber gleichgültig zu werden, ist ihr nie gelungen. - Auch wir werden nicht abstumpfen, werden die Ungerechtigkeit niemals akzeptieren. Dabei können uns Kämpfe wie jener, den Rosa Luxemburg führte, inspirieren und Mut machen. Rosa Luxemburg sagte über sich: "Ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt." Inhaftiert, von der ganzen Welt isoliert, fühlte sie sich umso stärker verbunden mit allen Wesen, die des Leidens fähig sind - mit menschlichen und nichtmenschlichen Tieren:
"Ich sage mir vergeblich, daß es lächerlich ist, daß ich ja nicht für alle hungrigen Haubenlerchen der Welt verantwortlich bin und nicht um alle geschlagenen Büffel - wie die, die hier täglich mit Säcken auf den Hof kommen - weinen kann. Das hilft mir nichts, und ich bin förmlich krank, wenn ich solches höre und sehe. Und wenn der Star, der bis zum Überdruß den ganzen lieben Tag irgendwo in der Nähe sein aufgeregtes Geschwätz wiederholt, wenn er für einige Tage verstummt, habe ich wieder keine Ruhe, daß ihm was Böses zugestoßen sein mag, und warte gequält, daß er seinen Unsinn nur weiter pfeift, damit ich weiß, daß es ihm wohlergeht. So bin ich aus meiner Zelle nach allen Seiten durch unsichtbare, feine Fäden an tausend kleine und große Kreaturen geknüpft und reagiere auf alles mit Unruhe, Schmerz, Selbstvorwürfen ... Sie [Sophie Liebknecht] gehören auch zu all diesen Vögeln und Kreaturen, um die ich von weitem innerlich vibriere. Ich fühle, wie Sie darunter leiden, daß Jahre unwiederbringlich vergehen, ohne daß man ‚lebt‘. Aber Geduld und Mut! Wir werden noch leben und Großes erleben. Jetzt sehen wir vorerst, wie eine ganze alte Welt versinkt - jeden Tag ein Stück, ein neuer Abrutsch, ein neuer Riesensturz... Und das Komischste ist, daß die meisten es gar nicht merken und glauben, noch auf festem Boden zu wandeln".
- Brief an Sophie Liebknecht vom 24. November 1917. Alle Briefe sind nach folgender Ausgabe zitiert: Rosa Luxemburg: Gesammelte Briefe. 5 Bände, Dietz Verlag, Berlin 1982-1984. - Die Briefe aus dem Gefängnis an Sophie Liebknecht gibt es als gesonderte Ausgabe von verschiedenen Verlagen. [zurück]
- Zur Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts vgl. den Text über Rosa Luxemburg vom Januar: Rosa Luxemburg – Gedenken heißt: Den Kampf weiterführen! [zurück]
- Den Brief Rosa Luxemburgs zum Hören gibt es hier; die Anmerkungen von Karl Kraus zum Brief sowie die "Antwort an Rosa Luxemburg von einer Unsentimentalen" und die Stellungnahme von Kraus dazu lassen sich beispielsweise hier nachlesen. [zurück]
- Zitiert nach: Annelies Laschitza: Im Lebensrausch, trotz alledem. Rosa Luxemburg. Eine Biographie. Aufbau-Verlag, Berlin, 2. Auflage 2002, S. 134 (vgl. GW 1/1, S. 571). [zurück]
Foto: Rosa-Luxemburg-Stencil, Potsdamer Platz, Berlin. - Wer das Leben verteidigt, ist FreiheitskämpferIn, keinE TerroristIn! Unbedingte Solidarität mit von Repression betroffenen AktivistInnen!