Von Ulrike Heider
Der 7. Juli 2016 war ein denkwürdiger Tag. Angestoßen von Frauenverbänden und Opfervertretern, mit den Stimmen von SPD, CDU/CSU, den Grünen und – mit Abstrichen – der Linken, verabschiedete der Bundestag eine Reform des Paragraphen 177 zum Straftatbestand der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung.
Allen Beteiligten ging es angeblich um die gesetzliche Umsetzung des feministischen Grundsatzes »Nein heißt nein«, eine Forderung aus den 1970er Jahren. Diese hat sich allerdings seither, zumindest in den Ländern, in denen wir als Privilegierte leben, im Alltag auch ohne spezielle Gesetze weitgehend durchgesetzt. Trotz erhöhter Anzeigebereitschaft der Frauen ging die Zahl der Sexualstraftaten zurück. Warum nun der fast einstimmige Ruf nach verschärften Gesetzen? Nur weil in der zurückliegenden Silvesternacht ein Haufen besoffener fremdländischer Handyklauer und Böllerwerfer deutsche Frauen belästigt hatten? Etwas, das nur wenige mit dem üblen Verhalten deutscher »Bumsbombertouristen« gegenüber – meist minderjährigen – asiatischen Mädchen und Frauen zu vergleichen wagten. Von der AfD bis hin zur Linken dagegen lösten die kaum zu rekonstruierenden Untaten der Kleinkriminellen eine Welle der Furcht vor dem Untergang des Abendlandes und seiner Sitten aus. Alice Schwarzer spricht in ihrem neuen Buch »Der Schock« von einem »Dschihadismus von unten« und von »Scharia-Muslimen«, die »mitten in Europa Frauen aus dem öffentlichen Raum« vertreiben wollten. Der deutsch-syrische Soziologe Bassam Tibi, der großen Wert darauf legt, Adorno-Schüler zu sein, sieht, wie er in seinem Beitrag in Schwarzers Buch schreibt, in den Silvesternachtereignissen einen »kulturell verankerten Racheakt« arabischer Männer an deutschen Männern.
Dass sich sogar Vertreter von CDU und CSU, die einst gegen das Verbot von Vergewaltigungen in der Ehe waren, zu dieser Stunde in Feministen zu verwandeln schienen, legt den Verdacht nahe, dass sie dabei nicht nur das Wohl der Frauen im Sinn hatten. Vielmehr ging es wahrscheinlich um die Aushöhlung des Asylrechts und auch um eine moralistische Haltung, die das Bedürfnis nach autoritärem staatlichem Durchgreifen in allen Bereichen des Lebens unterstützt. Tatsächlich offenbart sich bei näherem Hinsehen in den Gesetzesänderungen eine Tendenz, eine Art der Moral zu dekretieren, die Justitias Unparteilichkeit ins Wanken bringt. So wurde die »besonders schwere Nötigung zu sexuellen Handlungen« durch einen extrem weitgefassten Tatbestand des »sexuellen Missbrauchs durch Ausnutzung einer Lage der Widerstandsunfähigkeit« ersetzt, z. B. dann, wenn das Opfer im Fall seines Widerstands »ein empfindliches Übel befürchtet«. Der Täter wird in diesem Fall mit mindestens zwei Jahren Gefängnis bestraft, eine »Kombination von schierer Unbestimmtheit mit unverhältnismäßiger Härte«, wie es die Rechtswissenschaftlerin Monika Frommel Ende April in einem Aufsatz für das Onlinemagazin Novo formuliert hat. Sie sieht darin die Verrechtlichung einer »beliebig einsetzbaren Moralnorm«, die zu einer »Beweislastumkehr« gegenüber dem Beschuldigten führt und die Unschuldsvermutung außer Kraft setzt. Qualität und Begleitumstände einer sexuellen Straftat, Gewalt, Drohung oder schutzlose Lage, treten zugunsten des im nachhinein schwer festzustellenden Willens des Opfers in den Hintergrund. Wie beim sexuellen Kindesmissbrauch geht die Tendenz auch hier weg von der individuellen Beurteilung eines Falles hin zur formelhaften Definition der Tat und deren moralischer Beurteilung samt der Annahme einer automatischen Traumatisierung der Opfer.
Dazu kommt, dass das neue Gesetz erwachsene Frauen ebenso schutzbedürftig erscheinen lässt wie Behinderte, Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren. Freiheit und Selbstverantwortung als Voraussetzungen nicht nur weiblicher Emanzipation, sondern auch eines erfüllten Liebeslebens werden dabei vergessen. Und es fragt sich, ob das Gesetz nicht bei weiterer Verschärfung gegen die arbeiten könnte, die es schützen soll. Eben das geschieht jetzt schon bei der neuen Regelung zur Definition von Kinderpornographie, die dazu tendiert, Jugendlichen das Recht auf Sexualität abzusprechen. Die Vorstellung von der hilflosen Frau in den Köpfen der Gesetzesveränderer wird ergänzt durch die vom Mann als einem allzeit bereiten Belästiger oder Vergewaltiger. Die Autorin Chantal Louis z. B. meint in der März/April-Ausgabe der Zeitschrift Emma, dass bei bisheriger Gesetzeslage »ein Mann, auch ein fremder« davon ausgehen kann, dass eine Frau »sexuellen Kontakt mit ihm möchte«, dass sie an den Hintern oder in den Schritt gefasst werden und mit ihm Sex haben will. Diese Definition vom Mann als einer unzähmbaren Bestie, die automatisch über jede Frau herfällt, wenn sie nicht daran gehindert wird, haben in den 1970er Jahren viele Frauen aus dem Hauptwerk der amerikanischen Feministin Susan Brownmiller, »Gegen unseren Willen«, abgeleitet.
Das Buch war bahnbrechend in seiner schonungslosen Enthüllung der Vergewaltigungen durch Soldaten in Kriegen aller Nationen, in Pogromen oder bei Überfällen von Verbrecherorganisationen wie dem Ku-Klux-Klan. Gleichzeitig transportierte es in der Annahme, dass die ursprüngliche Waffe des Mannes sein Penis sei, eine folgenreiche Ideologie. Brownmiller geht davon aus, dass die Entdeckung dieser Waffe am Anfang der menschlichen Geschichte stand und ebenso wichtig wie die Beherrschung des Feuers oder die Erfindung der Streitaxt war. Dank eines biologischen Zufalls, der Herausbildung von Penis und Vagina, sei »der Mann der natürliche Verfolger des Weibes (…) und die Frau seine natürliche Beute« geworden. Die Angst der Frau vor Vergewaltigung sei »der wirkliche Grund für ihre Unterwerfung durch den Mann«. Die Entwicklung von Privateigentum, sozialen Hierarchien, von Sklaverei und Klassenherrschaft ist, so Brownmiller, Folge der Penisherrschaft des Mannes. Dem heutigen Vergewaltiger, heißt es im Schlusskapitel, sei all das nicht mehr bewusst. Was bleibe, seien »eine gewaltige Unterschiedlichkeit im Denken« mit dem Gegenüber von männlicher und weiblicher Logik sowie »der fundamentale Kampf zwischen Mann und Frau«. Einen solchen Geschlechterkampf oder -krieg haben konservative Ideologen lange vor Brownmiller konstatiert; etwa der kulturpessimistische und antidemokratische Oswald Spengler, Autor von »Der Untergang des Abendlandes«, einem Klassiker der »Konservativen Revolution«. Spengler konstatiert in dieser Schrift einen ewigen und gnadenlosen »Urkrieg der Geschlechter«.
Schon gegen Mitte der 1970er Jahre, noch bevor Brownmillers Buch gelesen wurde, verfiel auch die »Neue Deutsche Frauenbewegung« einem Geschlechterdualismus, der in der Betonung der Ungleichheit von Mann und Frau Konservatismus in sich barg. Im Zuge genereller Dogmatisierung und Entpolitisierung der aus der Studentenbewegung hervorgegangenen politischen Gruppen begannen die neuen Feministinnen Sexualität zu ihrem Hauptthema zu machen. Alice Schwarzer behauptete 1975 in ihrem berühmten Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen«, dass das einzige Sexualorgan der Frau die Klitoris sei. Vaginal empfinde sie nichts, der Koitus sei ein reines Männervergnügen und darüber hinaus ein »in sich gewaltsamer Akt«. Verena Stefan, die Autorin des ebenfalls 1975 erschienenen Bestsellers »Häutungen«, die den Rückzug aus Männerwelt und Politik propagierte, hält alle Männer für »bedrohlich« und ihre Körper für »gefährlich«. Auch sie spricht von der Waffe Penis und vom »Geschlecht der Krieger und Vergewaltiger«.
Gespeist aus solchen Quellen, entwickelte sich vor allem unter Feministinnen aus der Spontibewegung ein simplifiziertes Gut-böse-Denken: Hier die gute, sanfte und zärtliche Frauenlust, der die Penetration von Natur aus fremd ist. Dort die böse und zerstörerische Männerbrunst, bei der die Kopulation zum Gewaltakt wird. Weibliches und männliches Genital wurden gegeneinander ausgespielt. Weibliche Sexualität wurde entsexualisiert, männliche dämonisiert. Weder Zärtlichkeit mit Koitus noch Koitus ohne Gewalt waren mehr denkbar. Hinter Mann und Penis als den neuen Hauptfeinden der Feministinnen verblassten Kapitalismus und Patriarchat. Dafür hoben die Debatten um den »Schwanzfick« unter Linken an, d. h. um die Frage nach der Zulässigkeit des Geschlechtsakts mit Penetration. Feministischer Separatismus, männerhasserische Parolen und Männerausrottungsdrohungen gediehen in diesem Klima ebenso wie antifeministische Reflexe bei Männern.
Als Reaktion auf die feministische Prüderie und unter dem Einfluss der Postmoderne erhob sich seit den 1980er Jahren ein vitalistischer Gegentrend unter dem Etikett »neue Sinnlichkeit«. Als Vorreiter eines neuen Libertinismus in der Tradition des De-Sade-Interpreten Georges Bataille glorifizierten weibliche und männliche Angehörige der zerfallenden linken Bewegung Pornographie und Bordellerotik. Sie priesen »Lüsternheit« und »Geilheit« und feierten die »Femme fatale« als neues Frauenidol. Zum Ideal erhoben und einmal mehr zur Natur erklärt wurde eben die mit Macht und Gewalt legierte Sexualität, die die Feministinnen als männlich definiert und verteufelt hatten. Diesmal allerdings für beide Geschlechter. Die beliebte Essayistin Barbara Sichtermann kritisierte in ihrem 1983 veröffentlichten Buch »Weiblichkeit« gar den »Nein heißt nein«-Grundsatz als Bestandteil der »Fiktion einer weiblich-friedlichen Sexualität«. In den Debatten löste der Sadomasochismus (SM) den »Schwanzfick« als Thema ab, und pornographische Bilder schmückten linke und linksliberale Zeitschriften.
Vor diesem Hintergrund und zweifelsohne mit humanen Intentionen startete Alice Schwarzer 1987 ihre »PorNo«-Kampagne. Sie schlug ein Gesetz vor, das Herstellung und Verbreitung von Gewaltpornographie verbieten sollte. Viele Feministinnen und etliche linksliberale Intellektuelle befürworteten dies. Andere fühlten sich an die Zensoren der 1950er Jahre erinnert. Außerdem kam Andrea Dworkin, die US-amerikanische Galionsfigur des Anti-Pornographie-Feminismus, mit der Schwarzer jetzt zusammen bei Veranstaltungen auftrat, in der BRD weniger gut an als im puritanischen Heimatland. Dort war es sogar stellenweise zur Zusammenarbeit von Feministinnen mit konservativen Saubermännern gekommen, was für die USA nichts Neues war. So hatten sich einst große Teile der Suffragetten, die in den 1860er Jahren den Kampf gegen die Sklaverei unterstützt hatten, später den Temperenz- und Sittlichkeitsvereinen angeschlossen. Dezidierter noch als Brownmiller setzte Dworkin den Koitus mit der Vergewaltigung gleich, bekämpfte die in der Neuen Linken praktizierte »freie Liebe« als allgemeine Prostitution im de Sadeschen Sinne und erklärte den grausamen Marquis zum Ahnherrn der sexuellen Revolution. Ganz ähnlich behauptete auch Alice Schwarzer in einer Emma-Ausgabe von 1987, dass die Freundinnen der 68er-Revolutionäre »im Kommunebett jedermann sexuell zur Verfügung stehen« mussten. Sie gab linken Männern die Schuld am Aufstieg der Gewaltpornographie und prophezeite einen Ausrottungskrieg der Männer gegen die Frauen.
Sowohl die libertine Vorstellung von Sexualität, die mit der Gewalt liebäugelt und den Geschlechterkampf für luststiftend hält, als auch die »feministische« mit ihrem Dogma von der Waffe Penis und dem Krieg der Männer gegen die Frauen sind heute längst im Mainstream angekommen. Gemeinsam fördern sie seither eine negative Einstellung zur Sexualität. Das zeigt der große Erfolg von Pornos wie »Feuchtgebiete« und »Shades of Grey« auf der einen Seite, die Remoralisierung der Diskurse zu Themen wie Prostitution, Sexualaufklärung und Pädophilie auf der anderen.
Als jüngster Ausdruck von feministischem Dogmatismus entstand in linksradikalen Zusammenhängen seit den 1990er Jahren eine bestimmte Form von Antisexismus, die einmal mehr Sexualität als solche unter Gewaltverdacht stellt. Unter amerikanischem Einfluss versuchen seither postautonome Feministinnen einvernehmliche Sexualität so zu garantieren wie an dem berühmten Antioch College in Ohio oder wie seit 2014 auch an allen Colleges von Kalifornien. Dort sind die Studenten per Dekret verpflichtet, alles, was sie bei einem Date miteinander machen oder nicht machen, vorher bis ins Detail auszuhandeln, d. h. vertragsähnlich festzulegen, vom Umarmen und Streicheln über Küssen bis hin zum Geschlechtsverkehr und dessen Techniken.
Hierzulande ist aus diesem »Ja heißt ja«-Grundsatz unter dem Namen »Zustimmungskonzept« ein informeller Verhaltenskodex entstanden, der in Antisexismusreadern und -flyern allen linksradikalen Szenegängern nahegelegt wird. Alles, was einer Frau unangenehm sein könnte, und sei es nur eine flüchtige Berührung oder ein anzüglicher Blick, gilt als Grenzüberschreitung, wenn nicht gar Vergewaltigung. Besonders wichtig ist es, dass nicht nur jeder einzelne Schritt der zärtlichen oder sexuellen Annäherung abgesprochen wird, sondern dass auch jeder Wiederholungsfall einer neuen Zustimmung bedarf. »Gestern stand ich auf Dirty talk, aber bitte halt die Klappe damit heute!«1 heißt es veranschaulichend in einem anarchistischen Papier. Manchmal klingen die konsensuellen Handlungsanweisungen wie eine Lektion für SM-Sex. Dann z. B., wenn statt der verbalen Zustimmung ein »Safe word« oder eine bestimmte Geste empfohlen werden. Wurde einst das Lesbischwerden als Ausweg aus sexueller Unzufriedenheit der Frauen empfohlen oder zumindest die Ächtung des »Schwanzficks« zur Bedingung für den Heterosex erhoben, so sind Genossinnen und Genossen heute offenbar flexibler. Beim Sex und schon davor sollen sie sich idealerweise wie in einer Geschäftsbeziehung verhalten. Die Partner misstrauen einander grundsätzlich, und nur ein Vertrag garantiert faires Miteinanderumgehen. Sexualität erscheint dabei als verhandelbare Ware wie in prostitutiven Verhältnissen. Fortschritt oder negative Utopie, wer weiß das zu sagen?
Eng gekoppelt an das »Zustimmungskonzept« ist dessen deutsche Erweiterung unter dem Schlagwort »Definitionsmacht«, ein, wie es heißt, politisches Kampfmittel gegen Sexismus und Patriarchat. Als linksinterne Alternative zur bürgerlichen Justiz gedacht, bedeutet »Definitionsmacht« praktisch, dass eine Frau, wenn sie ihrer Meinung nach sexuell angegriffen oder missbraucht wurde und dies innerhalb der Politszene öffentlich macht, nichts davon beweisen muss. Auch wenn sie bei Vorspiel oder Sex nur ein »komisches Gefühl«2 hatte, kann sie erklären, dass sie vergewaltigt wurde. Geglaubt wird nur ihr, niemals dem beschuldigten Mann. Dieser soll zunächst belehrt werden. Ist er uneinsichtig oder kann das Opfer seine Gegenwart nicht mehr ertragen, so drohen ihm Ausschluss aus bestimmten politischen Zusammenhängen durch Hausverbote in Wohngemeinschaften oder besetzten Häusern. Wenn Andersmeinende auf einen möglichen Machtmissbrauch von Frauen verweisen, behaupten »Definitionsmacht«-Dogmatiker, dieses Argument beweise nichts als »die Interessenlage potentieller Vergewaltiger oder sexistischer Männerinteressen«.3 Es drängt sich die Frage auf, ob die neue linke Selbstjustiz mit ihrer vollständigen und skrupellosen Missachtung der Unschuldsvermutung nicht eines Tages in Richtung Lynchjustiz abgleiten könnte. Schon jetzt scheint die Ächtung vermeintlicher Vergewaltiger in der linken Szene etwas von der mittelalterlichen Vogelfreiheit zu haben. Interne Kritiker sagen, vermutliche Täter seien verprügelt worden, und berichten vom Selbstmord eines Betroffenen.
Ähnlich wie in den späten 1970er Jahren leidet die heutige radikale Linke unter Dogmatisierung und Entpolitisierung. Die sektiererischen Prinzipien der »Critical Whiteness« drohen die verbliebene antirassistische Bewegung zu zerstören, und Antifas verfallen vereinfachenden Welterklärungsmustern. Feministinnen verabschieden sich von jeglicher Gesellschaftskritik zugunsten eines internen Kampfes gegen Sexismus. Sie überschätzen die körperliche Komponente patriarchaler Herrschaftssicherung und drängen Frauen in die Opferrolle. Vergewaltigung, heißt es auf dem Blog eines Berliner Antisexismusbündnisses, sei »gesellschaftliche Normalität«, unser aller »Status quo«.4 Die Angst davor präge das Verhalten von Frauen so sehr, dass es sich »kein Mann vorstellen und keine Frau eingestehen« könne.5
Im Unterschied zu heute richteten sich die Antivergewaltigungskampagnen der 1970er Jahre gegen fremde Männer, nicht gegen die eigenen Genossen. Die »Take back the Night«-Demonstrationen und die Forderung nach Nachttaxis für Frauen standen im Mittelpunkt. Im Frankfurter Spontimilieu, dem ich selbst angehörte, gab es einen einzigen Vergewaltigungsfall in einem besetzten Haus. Der Täter aber war kein Linker, sondern ein szenefremder Drogendealer. In heutigen besetzten Häusern, antifaschistischen und anarchistischen Zentren dagegen scheint es von Vergewaltigern nur so zu wimmeln. Bei Hausbesetzungen und Szenepartys fallen laut Schilderungen von Insiderinnen in dunklen Ecken angesoffene Kerle über wehrlose Frauen her. Feministinnen plädieren für absperrbare Schlafbereiche für Frauen und Transpersonen und bieten Selbstverteidigungskurse an. Entspricht all dies, frage ich mich staunend, der heutigen linken Realität? Hat die generell gestiegene Gewaltbereitschaft der Menschen auch vor der Linken nicht haltgemacht? Desensibilisiert die bis hin zur Produktwerbung allgegenwärtige Pornographie mehr und mehr Männer? Oder sollte hinter den düsteren Wahrnehmungen des linksradikalen Alltags auch ein pessimistisches Bild von Mensch und Gesellschaft stehen, das sich dem der Konservativen annähert?
Das Schwarzweißschema postautonomer Vergewaltigungsaktivistinnen in bezug auf Mann und Frau und die daraus folgenden Umkehrschlüsse erinnern nicht nur an den Feminismus der 1970er Jahre, sondern auch an die Moral der damaligen K-Gruppen. Da alles Proletarische gut war und alles Bürgerliche vom Bösen, glaubten die selbsterklärten Erben Lenins und Stalins, dass mit der Machtübernahme der Fabrikarbeiter alles gut würde. Radikalfeministinnen beschworen derweil die Macht der Frauen in grauen Vorzeiten und drohten mit deren Wiedereroberung. Auch in den Verlautbarungen der »Definitionsmacht«-Ideologen ist viel von der Macht die Rede. Das beginnt mit der Namensgebung ihres Konzepts. Die Frage, warum sie nicht vom »Definitionsrecht« sprechen, beantworten Angehörige des »Antisexismusbündnisses Berlin« damit, dass das Recht »eine abzuschaffende Form von Herrschaft« sei. Es gehe vielmehr um die »(Selbst-)Ermächtigung von Frauen« angesichts »sexistischer Machtverhältnisse«.6 Über das Zauberwort Selbstermächtigung hinaus, dessen schlechter Klang im Deutschen nur älteren Menschen aufstößt, findet sich in den dazugehörigen Diskursen auch eine Machtverliebtheit, die misstrauisch machen sollte. Eine Macht, die »nicht an eine einzelne Gruppe, sondern an alle Menschen«, sprich Frauen, übertragen werde, sei nichts »Autoritäres, sondern etwas Emanzipatives«,7 liest man in einem Internetdiskussionsbeitrag zum Thema. Macht scheint für die linksradikalen Kämpfer(innen) gegen den Sexismus wichtiger als Gerechtigkeit und Gleichheit zu sein, so dass trotz gegenteiliger Beteuerungen das Autoritäre hinter dem Prinzip »Definitionsmacht« deutlich wird.
Es bleibt zu hoffen, dass sich radikale Linke wieder auf die Kritik bürgerlicher Autorität und Moral ihrer Anfänge besinnen werden. Dazu gehört unverzichtbar ein kooperatives Verhältnis zwischen Frauen und Männern, das sich an der Gleichheitsforderung statt am Geschlechterkampf orientiert. Ein solcher Richtungswechsel würde auch einen Umgang mit Sexualität ermöglichen, der menschliche Lust wieder mit Genuss und Lebensfreude zusammendenkt statt ausschließlich mit Missbrauch und Verbrechen.
Anmerkungen
1 Mädchenblog 2008, http://maedchenblog.blogsport.de/2008/01/08/have-sex-hate-sexism/
2 Antisexismusbündnis 2008, http://asbb.blogsport.de/2008/03/14/ueber-definitionsmacht/
3 Antisexismusbündnis 2008, http://asbb.blogsport.de/2008/03/23/when-my-anger-starts-to-cry/
4 Ebd.
5 Antisexismusbündnis 2008, http://asbb.blogsport.de/2008/03/14/ueber-definitionsmacht/
6 Ebd.
7 linksunten.indymedia 2014, http://evibes.blogsport.de/2014/11/18/wir-arbeiten-nicht-mit-definitionsmacht/
Ulrike Heider ist freie Schriftstellerin und Journalistin und lebt in Berlin. Zuletzt erschienene Bücher von ihr:
Die Leidenschaft der Unschuldigen. Liebe und Begehren in der Kindheit. Dreizehn Erinnerungen. Berlin 2015, Bertz und Fischer, 204 Seiten, 17,90 Euro
Vögeln ist schön. Die Sexrevolte von 1968 und was von ihr bleibt. Berlin 2014, Rotbuch-Verlag, 288 Seiten, 14,95 Euro
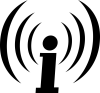
Zur Autorin des hervorragenden Textes
Ulrike Heider ist freie Schriftstellerin und Journalistin und lebt in Berlin. Zuletzt erschienene Bücher von ihr:
Die Leidenschaft der Unschuldigen. Liebe und Begehren in der Kindheit. Dreizehn Erinnerungen. Berlin 2015, Bertz und Fischer, 204 Seiten, 17,90 Euro
Vögeln ist schön. Die Sexrevolte von 1968 und was von ihr bleibt. Berlin 2014, Rotbuch-Verlag, 288 Seiten, 14,95 Euro