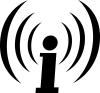1968 vor allem als die Zeit der so genannten Studentenunruhen zu begreifen, verdeckt leicht ganz andere Kämpfe, die die BRD-Regierung und ihren Repressionsapparat damals bestimmt genauso ins Schwitzen brachten wie die „Schlacht am Tegeler Weg“(1). Zwischen 1969 und 1973 fanden hierzulande eine Reihe von militanten Arbeiter_innenkämpfen statt, die die Bildzeitung titeln ließ: „Übernehmen die Gastarbeiter die Macht?“. In dieser Zeit waren Kämpfe von Arbeiter_innen in der BRD unberechenbar. Da waren es nicht die alljährlichen Tarifrundentänzchen bei denen Gewerkschafter_innen am Ende jedes Mal ein paar Cents voller Stolz präsentierten um Arbeiter_innen glauben zu machen, welch einen großartigen Sieg sie da erkämpft hätten.
Streiks gingen da nicht bescheidene Forderungskataloge voran, an denen sich mensch dann abarbeitete. Streiks hatten da etwa die zentrale Forderung „mehr Lohn weniger Arbeit“. Die Streikenden hatten sich damals aus den Kämpfen in Italien einen Begriff entlehnt und der hieß: autonomia. Autonomie hieß: Kämpfe ohne Gewerkschaften, ohne Parteien, ohne staatliche Institutionen. Alles was die Arbeiter_innen für ihre Kämpfe brauchten, das organisierten sie selbst; was sie mit ihren Kämpfen durchsetzen wollten, das entwickelte sich größtenteils im Laufe des Kampfes und das Faustpfand, das sie in Händen hielten, das war nicht ihre individuelle Qualifikation als Facharbeiter_innen oder ihre Leistungsfähigkeit, es war einfach die Fabrik, die sie besetzten und die sie den ganzen Streik über besetzt hielten. Da kam Keine_r mehr rein und erst recht kein_e arbeitswillige_r Streikbrecher_in.
Zwischen 1969 und 1973 fanden jede Menge solcher wilder Streiks in
der damaligen BRD statt, die meisten von ihnen von migrantischen
Arbeiter_innen geführt. Höhepunkt dieser Bewegung war der Streik bei Ford in Köln 1973.
Bereits bei einer Betriebsversammlung im Frühjahr hatte es bei Ford vor
allem Unmutsäußerungen der türkischen Malocher_innen gegeben, die die
Gewerkschaft aufforderten, den Tarifvertrag zu kündigen um 60 Pfennig
mehr in der Stunde durchzusetzen. Die Gewerkschaft machte natürlich
keinen Strich. Die türkischen Malocher_innen*, 1973 ein Drittel der
Belegschaft bei Ford in Köln, hatten die monotonsten und gefährlichsten Jobs und bekamen dafür am wenigsten Geld im Werkdurchschnitt.
Im Sommer kam es zur Entlassung von 300 türkischen Malocher_innen wegen
„eigenmächtigem Überziehens des Betriebsurlaubes“. Bei einer weiteren
Betriebsversammlung forderten die türkischen Arbeiter_innen die
Rücknahme der Kündigungen, während ein beträchtlicher Teil der deutschen
der Geschäftsleitung applaudierte und die Kündigungen für korrekt
hielt. Selbstverständlich stellten sich auch Betriebsrat und
Gewerkschaft hinter die Betriebsleitung. Eine Woche später schmiss ein
türkischer Malocher die Arbeit am Band hin und brüllte: „Wie lange
sollen wir uns das hier eigentlich noch gefallen lassen?“ Das ganze
erste Band schmiss die Arbeit hin und zog in einer Demo durch die
Fabrik. Am Abend fand eine Streikversammlung mit mehreren tausend
Malocher_innen statt, die spontan die Forderungen aufstellte: eine Mark
mehr für alle. Dazu kamen die Forderungen: Herabsenkung der
Bandgeschwindigkeit, Heraufsetzung des Betriebsurlaubes von vier auf
sechs Wochen, und natürlich: Wiedereinstellung der 300 entlassenen
Malocher_innen. Der Betriebsrat erklärte den Streik für illegal, weil er
innerhalb der so genannten „Friedenspflicht“ läge und das
Betriebsverfassungsgesetz in dieser Zeit Streiks verbiete. Der
Betriebsrat wurde verlacht, ausgebuht und mit Tomaten und Äpfeln
beschmissen. Gewerkschaft und Betriebsrat organisierten daraufhin
Gegendemos gegen den Streik und gewannen dafür den Großteil der
deutschen Malocher_innen. Von den Deutschen blieben nur die Azubis und
junge Malocher_innen von Sklavenhändler_innen. Am fünften Streiktag
wurde im Zuge einer solchen Demonstration von so genannten
Arbeitswilligen, die aus Belgien herangekarrt worden waren,
Schlägertrupps – bestehend aus Meistern, Vorarbeiter_innen und
Zivilbullen – allesamt bewaffnet mit Knüppeln und Schlagringen
eingeschleust. Während dessen hetzte die bürgerliche Presse:
„Türkenterror bei Ford“. Und der damalige Bundeskanzler forderte die
Streikenden auf, wieder in den Schoß der Gewerkschaft zurückzukehren.
Am Abend patrouillierten dann diese so genannten Arbeitswilligen als Werkschutzbullen durch die Fabrik und schlugen alles was sich versammelte zusammen. Der Streik scheiterte, weil die Gewerkschaft die Spaltung zwischen deutschen und türkischen Malocher_innen hervorragend hinbekommen hatte. Dabei zielte die zentrale Forderung der türkischen Malocher_innen gerade auf eine Aufhebung der Lohnspaltung: eine Mark mehr für alle, für alle! Eben keine Prozentforderung, die die Lohnspaltung ja immer aufrechterhält. Rassismus war hier ganz handfest an materielle Interessen gekoppelt. Die deutschen verdienten wesentlich mehr, waren letztlich genauso käuflich wie ihre Gewerkschaft.
Der Fordstreik war der Höhepunkt und zugleich das Ende der wilden
Streiks in den Fabrikkathedralen in der BRD. Diese Streiks waren ein
Teil von militanten Arbeiter_innenkämpfen die in den 60er und 70er
Jahren das Kapital weltweit in seine bislang tiefste Krise trieben.
Der Gegenangriff seitens der Unternehmer_innen ließ nicht lange auf
sich warten und zielte auf eine globale Umstrukturierung der Ausbeutung.
Umstrukturierung der Fabriken, Umstrukturierung der
Arbeitsorganisation, Teilung der Fabriken in einzelne Abteilungen und
deren Auslagerung, Parallelproduktion in identischen, global verteilten
Klitschen. Das Ganze verbunden durch eine massive Zunahme der
Arbeitshetze.
In der BRD verschoben sich Kampf und Widerstand gegen Arbeit und
Arbeitshetze in eine enorme Zunahme der Fluktuation aus den Fabriken;
keine_r dachte daran, mehr Zeit in der Knochenmühle zu verbringen als
nötig: Bei relativ hohen Löhnen wurde der Job einfach immer wieder
hingeschmissen und gewechselt. Eine breite mobile Schicht von
Jobber_innen arbeitete einfach nur solange, bis die Kohle erstmal für
eine Weile reichte. Danach konnte mensch sich locker wieder einen
anderen Job suchen und das war Mitte der Siebziger noch relativ einfach.
Mit den Revolten Anfang der 80er endete die Mobilität von Job zu Job.
Statt überhaupt noch einen Schritt in die Fabriken zu tun, eigneten sich
vor allem Jugendliche massenhaft Sozialknete an.
Die Arbeitsverweigerung verließ die Fabrik und verstand sich als
vereinzelte aber massenhafte Verweigerung der Arbeit, reproduziert über
damals noch beträchtlich höhere Transferleistungen wie Sozi, BAföG oder
Kohle vom Arbeitsamt, ‚aufgestockt‘ durch Klauen.
Damit waren die Revolten zuallererst eine breite Revolte und
Widerstandskultur gegen die Arbeit. Massenhafte Aneignung als Offensive
gegen Ausbeutung: zu Beginn der achtziger Jahre keineswegs auf eine
radikale Politschicht beschränkt, lebten breite Teile der Jugendlichen –
unterstützt von Broschüren zum Krankfeiern – einfach ihrer Lust, die
mensch sich von Maloche nicht versauen lassen wollte. Qualifizierungen,
Ausbildung, Studium oder sonst wie gearteter „Sinn des Lebens“
erfrischten die Gesichter bestenfalls mit einem müden Grinsen. Auf der
Straße kam diese Verweigerung zusammen. Auf der Straße radikalisierte
sie sich und vor dem 12.12.1980 machte bereits der Satz die Runde: „Die
einen klauen Lorenz und ich klau meinen Käse bei Karstadt“ (2).
Aneignung als Verweigerung aller Art von Arbeit und Arbeit allein für die Aneignung und im Sinne von kollektiver Lust. Was gelernt oder gekonnt wurde – ob LKW – Führerschein, Wissen wie eine Druckmaschine oder Funk-/Senderanlagen funktionieren, Schweißen… – für Kampf und Aneignung eingesetzt, für sonst aber nichts, außer für Lust und Vergnügen.
Der Hass auf die Arbeit und die Möglichkeit ihr auszuweichen bezog seit Anfang der Achtziger aber auch die Alternativklitschen mit ein, von nun an wurde auch in Bioläden geklaut, wurde der Sektor doch nicht mehr als utopisches Außerhalb der Verwertung gesehen, und Streiks gegen beschissene Arbeitsbedingungen begannen auch hier: etwa gegen ‚Oktoberdruck‘, gegen die ‚zitty‘ oder gegen die feministische Zeitung ‚Courage‘, wo die Frauen im Büro ihre Schreibmaschinen aus dem Fenster schmissen.
Andererseits hatte sich von den Anti-AKW-Kämpfen bis zu den
Straßenschlachten gegen die Rekrutenvereidigung in Bremen im Mai 1980
eine Massenmilitanz durchgesetzt, die in den tagelangen
Straßenschlachten im Dezember 1980 in Berlin einen neuen Höhepunkt
finden sollte.
Häuser wurden von Nichtverhandler_innen nicht besetzt um sich an der
Bausubstanz von verrotteten Hütten abzurackern. Mit dem, was die
Mieterläden als „Instandbesetzen“ bezeichneten wollte niemand von ihnen
etwas zu tun haben. Die Militanten dachten damals nicht daran, sich für
die Aneignung des Wohnraums zu rechtfertigen oder mit Arbeit dafür dann
doch wieder zu bezahlen. Oder wie es in einem Flugblatt damals hieß:
„Das haus ist enteignet. Basta.“ Aneignung als nichtverhandelbarer Bruch
mit den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen; Aneignung als
Organisation eines Lebens außerhalb von Ausbeutung und Verwertung;
Kämpfe, die zumindest für einige Monate spürbar machten, dass ein Leben
ohne kapitalistische Arbeit durchsetzbar und lebbar ist, dass es möglich
ist, sich der Maloche kollektiv zu entziehen.
Die Qualität des Aufstandes 80 lag nicht in den Aneignungen sondern in deren Kollektivität. Aneignungsaktionen wie Ladendiebstahl, Fahren ohne Fahrschein, Stromklau mit angebohrtem Zähler, bis hin zu Hausbesetzungen hatte es natürlich bereits in den Siebzigern gegeben. Mit den Revolten Anfang der 80er wurden Aneignungsaktionen nicht nur zum Massenphänomen, sie wurden nicht selten auch kollektiv organisiert: die Hausbesetzungen in Berlin, Hamburg, Freiburg, Nürnberg und… brachten Vernetzungen unter einer breiten Masse von Leuten hervor, die größere Aktionen ermöglichten: Plünderungsaktionen, die die Waren in Kollektiveigentum verwandelten. Das Geklaute zusammen gekocht, getrunken; Drucken von Fahrkarten der BVG und Verteilen dieser im Kiez; Fälschen von Bahn- wie Konzertkarten; Aufmachen von Läden und die ‚Waren‘ einfach für alle herausgeholt und auf der Straße verteilt; Klauen und Abfressen in Trupps dass keine_r abgegriffen wird; gemeinsame Besuche bei Sachbearbeiter_innen von Sozial- oder Arbeitsamt, wenn keine Kohle bezahlt wurde oder werden sollte. In einer geradezu rauschhaften Weise löste der Häuserkampf all dies ein, machte es lebbar, wurde Leben und verschenkte es zugleich in seiner Exklusivität: erst Jahre später am 1.Mai 87 sollten sich Plünderung und Aneignung und leider nur für eine Nacht tatsächlich auf die Anwohner_innen ausweiten.
Die anfänglich breite Solidarität der ‚Umwohnenden‘, von
Kämpfer_innen fälschlicherweise als Unterstützung missverstanden, zeugte
von einem klaren Gespür der Anwohner_innen für die gemeinsame
Ausbeutungslage in der sie wie die Besetzer_innen steckten, bei denen
sie mit Essen, Werkzeug, Möbeln oder dem Angebot mitanzupacken
auftauchten. Eine starke wenn auch vage Hoffnung lag darin, aus den
Kämpfen heraus könnten sich noch ganz andere Dinge erkämpfen lassen.
Sein Ende fand der Aufstand in Berlin, der mit dem begriff „Häuserkampf“
nur verkürzt gefasst werden kann, letztlich in einer Spaltung, die die
Militanten nicht überwinden konnten. Damit ist allerdings nicht die
Spaltung zwischen Nichtverhandler_innen und Verhandler_innen gemeint.
Wer seine individuelle Lösung des „schöner Wohnens“ einem breiten
gemeinsamen Kampf und Widerstand für ein ganz anderes Leben ohne Staat
und Mietvertrag vorzieht, spaltet sich selbst ab, denen muss keine Träne
nachgeheult werden. Scheiß drauf… eher ist hier die Spaltung zwischen
militanter Szene und solidarischen Anwohner_innen gemeint.
Die Aneignungen, die sich ausschließlich auf Szene bezogen, führte über die hervorragend funktionierende illegale Versorgung (Reproduktion) innerhalb der Bewegung zu einer Spaltung, die von den Bewegten in ihrem Selbstverständnis „wir kämpfen für uns und führen keine Stellvertreterkriege“ in maßloser Selbstüberschätzung gar nicht begriffen wurde. Einzig auf sich bezogen erkannte die militante Macht nicht die Chance, sich in die Kieze auszuweiten um so tatsächlich zu einer unüberwindlichen Macht zu werden. 1980 zeigte, dass Revolte nicht unbedingt Revolte bleiben muss. Sie ist nicht allein „das Feuerwerk das das Dunkel der Macht für einen Moment erhellt“. Im Aufstand steckte auch durchaus das Potential, eine ganz andere Wucht und Breite zu entfalten. Kaum wurden aber etwa ernsthafte Versuche unternommen, Mietstreiks zu organisieren, die Hausbesetzungen als militante Mietstreiks auszuweiten und fortzuführen. Die militante Macht wurde nicht genutzt um Zwangsräumungen zu verhindern, Zwangsräumungen, die ja trotz Besetzungen vollkommen unbehelligt weitergingen. Die Organisation eines Stromboykotts wurde angegangen als die Bewegung bereits bröckelte und eben auch nur aus der Defensive heraus. Selbst 1982, zu einer Zeit, als der Angriff des Staates in breiter Front bereits angelaufen war, wurde mit Plakat- und Flugblattaktionen, die inhaltlich sowohl den Gegenangriff wie dessen vereinheitlichende Dimension durchaus präzise analysierten, noch immer im Jargon des wir und ihr gesprochen.
Wie tief der Riss zwischen Bewegung und malochenden Menschen klaffte, sollte, als die Aneignungen 82 nicht mehr so wie bisher erkämpft werden konnten, allzu deutlich beim ‚Heinzelmännchenstreik‘ (studentische Jobvermittlung) werden, als der Streik für mehr Kohle, Ablehnung von Jobs mit miesen Arbeitsbedingungen sowie Jobs, die rassistisch und/oder sexistisch ausgrenzten, von militanten Häuserkämpfern mit der Begründung, man brauche jetzt aber mal Kohle, kurzerhand abgebrochen wurde, nachdem allerdings die Streikposten autonom verpennt hatten.
(1) Solidarisierungsdemo im November 1968 gegen eine Gerichtsverhandlung die sich aus Student_innen, Jungarbeiter_innen, Jugendlichen und Rocker_innen zusammensetzte.
(2) Peter Lorenz; ehemaliger Landesvorsitzender der CDU und zu der Zeit von der Bewegung 02. Juni zur Befreiung einiger gefangener Genoss_innen entführt.
Komm heute (Samstag 17.11.) um 13:00 zum Mehringplatz (bln) und lass deiner Wut freien Lauf !!