Eine Kritik am Aktivismus am Beispiel der Interventionistischen Linken. Im Artikel schreiben wir, warum wir glauben, dass das Führen von Alltagskämpfen in milieuübergreifenden, dialogorientierten, proletarischen Organisierungen eine Notwendigkeit ist, wenn es mit der Revolution noch was werden soll.
Zwei Genoss*innen fragten sich in der arranca! #48, „warum wir neben der Arbeit in Basisinitiativen noch eine IL brauchen“. Wir wussten es im Sommer 2014 auch nicht mehr – und sind deshalb nach sieben Jahren aus der Interventionistischen Linken (IL) ausgetreten. Klar, die IL ist stark darin, Demonstrationen zu organisieren, Bündnisse zu schmieden oder medienwirksame Aktionen durchzuführen. Beim Anbahnen und Führen sozialer Kämpfe rund um Wohnraum, Arbeit und Prekarität stand sie uns allerdings eher im Weg.
Wir waren hauptsächlich damit beschäftigt, Gremien zu besetzen, Bündnistreffen zu besuchen, bei Demonstrationen und Kampagnen zu unterstützen, Projekte anderer Arbeits- und Ortsgruppen abzunicken und eigene Projekte im Plenum zu präsentieren. Soziale Kämpfe wurden zu einer Nebenbeschäftigung. Was dsan1 in der arranca! #48 vermutet, wurde für uns zur Gewissheit: Wir führen soziale Kämpfe nicht wegen, sondern trotz unserer Mitgliedschaft in der IL. Kosten und Nutzen standen in keinem vernünftigen Verhältnis mehr.
Raus aus dem Hamsterrad – Eine Organisierung gegen die Angst
Was wir eigentlich wollten, war eine Praxis, die Leistungszwang, Armut und Ausgrenzung angreift und solidarische Alternativen entwickelt. Eine Organisation, die durch Selbstorganisation und direkte Aktion die Probleme ihrer Mitstreiter*innen löst. Ein Projekt, in dem wir kontinuierlich unsere Konflikte diskutieren und analysieren können, um unsere Angst zu verlieren und das Kämpfen im Alltag zu erlernen.
Wir begannen zu überlegen, welche Strukturen wir hierzu schaffen müssen. Was bedeutet es konkret den „Widerstand im Herzen der Bestie“ zu organisieren? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein und welche Denkweisen und Überzeugungen überprüft und eventuell abgelegt werden? Was hält uns davon ab, Widerstand zu leisten?
Wir alle neigen dazu, Konflikte im Alltag nicht zu suchen, sondern zu umgehen. Das ist verständlich, schließlich besteht ein Risiko für diejenigen, die sich als erstes wehren. Der Kampf kann verloren werden. Die darauffolgenden Sanktionen – Verlust von Job, Wohnraum, Ersparnissen, sozialen Kontakten – können verheerend sein. Ist man in dieser Situation auf sich allein gestellt, überwiegt die Angst vor der Strafe, die uns an die bestehenden Verhältnisse bindet. Wir schließen uns der Analyse der Autor*innen von „Maulwurf statt Adler“ in der arranca! #48 an, die den „strategischen Kern des neoliberalen Angriffs“ in der „Universalisierung von Angst und Verunsicherung“ ausmachen. Auch wenn sie die immer noch herrschende Disziplinierung unterschätzen, die zunimmt, je proletarisierter man ist, haben sie Recht: Angst verhindert effektiv Widerstand. Man muss sich nur den Unterschied zwischen dem Bild, das radikale Linke von sich selbst als rebellische Minderheit zeichnen und dem, was sie im eigenen Alltag tun, vor Augen führen. Wir kennen kaum Linke, die gegenüber ihrem Chef den Mund aufmachen oder an vorderster Stelle stehen, um sich zu wehren, wenn im eigenen Haus eine Mieterhöhung ansteht – also auch im Alltag das tun, was sich auf Demonstrationen schon heute viele trauen.
Was unserem Erachten nach radikale Linke von radikalen Laberbacken unterscheidet, ist genau diese Fähigkeit. Bereit zu sein, als erstes den Kopf hinzuhalten, einen Kampf aufzunehmen und solidarisch zu sein. Denn es gibt genug Menschen, die sich wehren würden, wenn sie wüssten, dass sie nicht alleine sind. Es fehlt allerdings an materiellen Strukturen, die diese Kämpfe ermöglichen und eventuelle Rückschläge und Niederlagen abfedern.
Damit sich die Angst davor, im Hamsterrad nicht mehr mithalten zu können, nicht nur in Empörung oder Wut ausdrückt, sondern in Widerstand verwandelt, muss die Welt als ungerecht und veränderbar wahrgenommen werden. Das geschieht aber nur zum allerkleinsten Teil durch Diskurse. Der klügste Text und die schönste Demonstration entlassen uns nach wenigen Stunden wieder in den Alltag, wo wir uns tagtäglich als Subjekte konstituieren und sich die herrschende Ideologie reproduziert. Wenn es aber der Alltag ist, der unsere Vorstellungen und Praxen prägt, muss es auch der Alltag sein, in dem wir andere Vorstellungen und Praxen entwickeln. Das passiert viel zu selten, was sich daran zeigt, dass es oft keine Ideen gibt, wie Kämpfe geführt werden könnten. Am frappierendsten haben wir das im Bereich der Lohnarbeit erlebt. Ein beträchtlicher Teil der Linken hat kaum Kenntnisse über die eigenen Rechte und keine Idee davon, wie Organisierung am Arbeitsplatz jenseits von „Ich rufe die Gewerkschaft, und die macht dann was“ stattfinden könnte. Das Wissen um Bummelstreiks, Sit-Ins und Überstundenverweigerung muss ebenso wieder verbreitet werden, wie die Erfahrung, dass diese Taktiken von Menschen wie dir und mir angewendet werden können. So kann das Repertoire an möglichen Antworten auf unsere alltäglichen Probleme wachsen.
Dabei geht es nicht um sozialarbeiterische Befriedung von Konflikten, sondern um eine radikale Praxis, die uns durch Kollektivität in die Lage versetzt, uns frei verfügbare Zeit und Lebensqualität anzueignen. Das gelingt nur, wenn wir die Dinge, die uns betreffen, selbst entscheiden und auch selbst in die Hand nehmen wollen. Daraus folgt, dass wir in einem kontinuierlichen Dialog mit anderen Menschen stehen müssen, die bereit sind, sich zu wehren. Nicht nur, weil wir in den alltäglichen Konflikten die Vorstellung verankern müssen, dass sich niemand ein gutes Leben erst durch Lohnarbeit oder Kindererziehung verdienen muss – Leistungszwang also rundweg abgelehnt wird. Sondern auch, weil wir zur Entwicklung einer solchen Praxis viel von anderen zu lernen haben. Wir sind überzeugt davon, dass Befreiung nur so entsteht. IL-Politik setzt dagegen eher auf Agitation, als selbst Teil der sozialen Prozesse zu werden. Historisch gesehen ist das eines der größten Probleme der Linken, verfestigt man doch so die Trennungen zwischen denen, die die Ideen haben und denen, die sie umsetzen, zwischen Führenden und Geführten, zwischen Helfenden und Bedürftigen.
Unsere Erfahrungen mit solidarischen Alltagskämpfen
Wir beteiligen uns seit über einem Jahr an Wilhelmsburg Solidarisch, einem Projekt, das versucht diese Trennungen zu überwinden. Zweimal im Monat gibt es einen offenen Anlaufpunkt für alle Menschen mit Fragen rund um Arbeit, Aufenthalt, Jobcenter und Wohnen. Wir beraten uns gegenseitig, bilden uns weiter, begleiten uns zu Ämtern, unterstützen uns im Alltag oder machen öffentlichkeitswirksame direkte Aktionen.
Unsere Organisierung basiert auf gemeinsamen Interessen und Bedürfnissen. So entwickeln wir Schritt für Schritt Strukturen, die es uns ermöglichen, Kämpfe zu führen. Wir reflektieren unterschiedliche Taktiken und Strategien am Arbeitsplatz oder auf den Ämtern. Wir bieten finanziellen und emotionalen Rückhalt, wenn sich jemand für unsere Ideen und Ideale einsetzt und dadurch Nachteile erleidet. Zehntausende Euro verpulvert die Linke alljährlich für schicke Mobiclips und Plakate irgendwelcher abstrakten Kampagnen. Brauchen wir nicht eher einen Fonds für Menschen, die sich gegen ihre Zwangsräumung wehren? Oder eine Solidaritätskasse für Erwerbslose, die Flugblätter mit Widerstandstechniken gegen ihre Bewerbungstrainings verteilen und dafür sanktioniert werden? Statt eine gemeinsame Identität als Mieter*innen, Nachbarschaft oder Arbeiter*innen eines bestimmten Sektors zu entwickeln, versuchen wir ein Gefühl umfassender Klassensolidarität zu erzeugen. So rücken proletarische Alltagserfahrungen in das Zentrum unserer politischen Praxis. Wilhelmsburg Solidarisch hat deshalb das Potenzial zu einem Ort zu werden, an dem wir ein Leben lang immer wieder zusammenkommen. Denn Alltagskämpfe lassen sich zwar nicht auf Dauer stellen – eine Auseinandersetzung mit Chef*in, Vermieter*in oder Behörde kann sich über lange Zeit hinziehen, ist aber auch irgendwann beendet. Allerdings tauchen solche Konflikte ein Leben lang immer wieder auf und sind meistens ohnehin miteinander verwoben. Wenn das Amt nicht zahlt, kriegt auch mein*e Vermieter*in keine Kohle.
Hinzu kommen die Momente, in denen wir uns gemeinsam entschließen, den Konflikt zu suchen. Die Frage, was uns zum Kämpfen befähigt, steht im Zentrum unserer strategischen Überlegungen. Lasst uns das am Beispiel eines Arbeitskampfes verdeutlichen: Wir haben es geschafft, Verbesserungen im Betrieb zu erzielen. Der Preis war allerdings, dass diejenigen, die entschieden zum Erfolg beigetragen haben, wie so häufig entlassen wurden. Jetzt haben wir den Vorteil, ein Kollektiv zu sein, das weiß, wie man mit Arbeitsagentur und Jobcenter umgeht. Und zwar so, dass man Kohle, aber keinen Stress bekommt. Dadurch wird der Jobverlust weniger existenzbedrohend. Unsere Organisierung endet im Gegensatz zu einer rein gewerkschaftlichen nicht mit dem Konflikt oder am Werkstor. Dadurch können sich alle Beteiligten in Zukunft wieder trauen, sich für ihre Sache einzusetzen. Das meinen wir ganz praktisch, wenn wir von der Notwendigkeit einer Organisierung gegen die Angst sprechen.
Um eine möglichst große Offenheit gegenüber unterschiedlichsten Lebenslagen herzustellen, versuchen wir viele „Andockpunkte“ zu schaffen. Dabei sollen unsere Strukturen wachsen können und leicht adaptierbar sein, um sich ausbreiten zu können. Neben dem Anlaufpunkt haben wir regelmäßig stattfindende Kneipenabende, die für einige Genoss*innen zu einem wichtigen Ort der Vernetzung geworden sind. Manche kommen ausschließlich zu Treffen, auf denen Aktionen oder Strategien besprochen werden. Und es gibt Menschen, die vorwiegend an Veranstaltungen und Workshops teilnehmen. Statt eines Plenums als Zentrum haben wir viele Punkte, an denen wir je nach Interesse und verfügbarer Zeit partizipieren – oder eben auch nicht. Wir versuchen uns gegenseitig zu vermitteln, dass wir auch dann Teil von Wilhelmsburg Solidarisch sind, wenn wir mal ein halbes Jahr nicht da sind. Phasen von Aktivität und Nicht-Aktivität zu thematisieren, ohne Rechtfertigungsdruck aufzubauen, ist wichtig, um darüber sprechen zu können, warum jemand keine Zeit oder Kraft hat. Erst so entsteht die Möglichkeit, die politische Dimension scheinbar individueller Entscheidungen – wie den legendären Rückzug ins Private und die Arbeit – offen zu legen.
Das ist notwendig, weil politische Organisierung für uns kein Hobby ist, das wir uns leisten, sondern eine Selbstverteidigungsmaßnahme. Wir finden es zunehmend irritierend, wie in Flyern von „den Lohnabhängigen“ oder „den Arbeitslosen“ gesprochen wird, als ob die Verfasser*innen der Texte mit ihnen nichts zu tun hätten und außerhalb der Gesellschaft stünden. Wir zumindest, als Menschen ohne großes Vermögen und Eigentum an Produktionsmitteln, haben ein Eigeninteresse an einem kämpferischen Kollektiv, in das wir unsere vermeintlich privaten Konflikte tragen können und das uns unterstützt. Die IL-Strukturen, in denen wir früher aktiv waren, konnten das nicht leisten. Und da viele Leute aus anderen Politgruppen zu uns kommen ist dieses Problem offensichtlich in der Linken weit verbreitet.
Aber auch Menschen, die bislang keinen Kontakt zu linken Inhalten und Strukturen hatten, weil sie durch Flugblätter und Demonstrationen nicht erreicht werden, kommen zu Wilhelmsburg Solidarisch. Das ist nicht verwunderlich, weil wir die gleichen Probleme teilen und ein materielles Interesse daran haben, uns gemeinsam zu organisieren. Unsere Radikalität bestimmt sich folglich durch die Art, wie wir Konflikte bearbeiten und welche Mittel wir in unseren Kämpfen wählen. So glauben wir, eine breite soziale Basis herstellen zu können, die für eine gesellschaftliche Transformation unabdingbar ist und unter vielen Menschen linke Praxen und Ideen bekannt zu machen – nicht als Theorie oder Lifestyle, sondern als gelebte Renitenz. Weil wir eine Kultur etablieren, die jeden willkommen heißt und ernst nimmt, haben wir das Gefühl, zum ersten Mal in einer Organisation zu sein, in die wir jeden Interessierten einladen können, ohne Angst zu haben, dass unser Milieu und die Themen abschreckend wirken.
Sind politische Gruppen also überflüssig?
Natürlich nicht. Sie haben ihre Berechtigung als Assoziation der Gleichgesinnten. Hier sind nicht die Interessen, sondern die Ideen das Verbindende. Sie dienen als Ort der Entwicklung neuer Strategien sowie der Analyse und Interpretation sozialer Kämpfe. Ihr Maßstab ist nicht zuerst das Erzielen von Erfolgen, sondern die Frage, ob die Kämpfe uns dem Ziel einer revolutionären Veränderung der Verhältnisse näher bringen. Schließlich neigen alle erfolgreichen Organisationen, die für ihre Interessen kämpfen, ab einer bestimmten Größe dazu, konservativ zu werden, wie ein Blick in die Geschichte anarcho-syndikalistischer Gewerkschaften zeigt. Unsere Aufgabe als radikale Linke besteht demzufolge darin, Tendenzen zu bekämpfen in denen Partikular- über Allgemeininteressen gestellt werden. Mit dem Einfordern von Solidarität alleine kommt man da nicht weiter. Es gibt ja faktische Interessengegensätze zwischen Lohnabhängigen. Etwa wenn Festangestellte ihre Interessen auf Kosten von Leiharbeiter*innen durchsetzen wollen, oder dem alleinerziehenden Vater der Jobverlust droht, weil er sein Kind während des Kita-Streiks nicht alleine lassen kann.
Wenn wir nicht wollen, dass diese Interessengegensätze zu Ungunsten der schwächeren Gruppe aufgelöst werden, müssen wir uns in diesen Kämpfen für eine umfassende Solidarität einsetzen, die auch das Zurückstellen eigener Privilegien notwendig macht. Das lässt sich dann aber nicht mehr mit kurzfristigen Interessen oder Bedürfnissen begründen, sondern nur durch unsere politische Perspektive. Wenn dieser Standpunkt eine Chance haben soll, geteilt zu werden, muss er da artikuliert werden, wo eine neue Gesellschaft erkämpft wird: im Handgemenge der sozialen Kämpfe.
Unsere Erfahrung ist allerdings, dass viele IL-Genoss*innen Basiskämpfe theoretisch super finden, dann aber schnell abwinken: „Können das nicht andere erledigen?“ Sich mit den Problemen der Leute zu beschäftigen oder den ganzen trockenen Rechtskram zu lernen, sollen die Basisaktivist*innen übernehmen. Man selbst kümmert sich lieber um die Vernetzung, bündelt die Akteure, stellt Ressourcen zur Verfügung oder spitzt Forderungen zu. Dahinter steckt auch die Vorstellung, dass im vorpolitischen Klein-Klein der Alltagskonflikte der Blick für das große Ganze, die Theorie und die echte Politik verloren geht.
Wir beobachten es genau anders herum. Erst in der direkten Auseinandersetzung mit Herrschaft an den Orten ihrer Realisation – in den Arbeitsstätten, Amtsstuben, Gerichten, Wohnanlagen – im Interesse an ihren todlangweiligen bürokratischen Abläufen, im Dialog über die Gefühle, die Unterdrückung in uns erzeugt, kann Theorie wertvoll werden – für die Unterdrückten versteht sich. Das ist der Hintergrund, weshalb Linke, die sich das erste Mal in sozialen Kämpfen tummeln, sich mit einer „komplizierten Gemengelage“ (IL Recht auf Stadt AG in arranca! #48) konfrontiert sehen und bemerken, dass der Großteil linker Theorie in der konkreten Praxis keinen Vorteil bringt. Aber nicht weil linke Theorie per se nutzlos wäre, oder Kämpfe am besten instinktiv und ohne theoretische Hintergedanken ablaufen, sondern weil sie heute hauptsächlich von Menschen produziert wird, die an der Seitenlinie der Kämpfe stehen.
Als wir vor einem Jahr mit dem Versuch begannen, eine andere Praxis zu entwickeln, ist das aus dem Bedürfnis heraus entstanden, nicht weiter Politik vom Feldherrnhügel aus zu betreiben. Wir wollten mehr, als revolutionäre Prosa zu produzieren, die auch dann noch Zeugnis unserer eigenen Ohnmacht ist, wenn sie auf einer Großdemonstration verlesen wird. Dafür mussten wir unsere Komfortzone verlassen und uns dem Aufbau alltäglicher Gegenmacht widmen. Wir finden, es hat sich gelohnt.
Dieser Artikel wurde von Zweiter Mai im Dezember 2015 verfasst und erschien im April 2016 in der Ausgabe Nr. 49 der Zeitschrift arranca!.
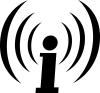
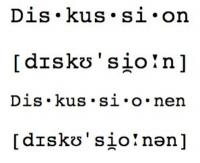
Basisarbeit
Schöner Artikel und richtige Entscheidung eurerseits.
Lässt sich in vielerorts beobachten, dass ein Großteil des politischen Aktivismus geprägt ist von Plenas, Bündnisarbeit und Orgatreffen, mit dem Ziel Demos oder ähnliche Aktionen zu organisieren. Das dadurch bei einigen Akteur*innen der Blick für das Wesentliche verloren geht, die Basisarbeit mit den Menschen vor Ort, die nicht unbedingt etwas mit der "Szene" zu tun haben ist erfahrene Realität.
Toller Kritik und Text
toller text aus wilhelmsburg!!! denke auch, dass sich viele gruppen zu wichtig nehmen und oftmals auch keinen bezug mehr zum antikapitalismus haben. da geht es oftmals darum, seinen/ihren eigenen arsch zu retten. fleißig wird studiert, geflüchtete nur unterstützt, wenn sie regelmäßig zu den plenas kommen. zu verhandlungen von genossen_innen oder asylrechtsangelegenheiten wird oftmals nicht gegangen, weil sie denn lieber ne uni-vorlesung besuchen oder arbeiten gehen. so kannste keinen blumentopf gewinnen - geschweige denn irgendwie aus der bedeutungslosigkeit wieder auftauchen. wenn man/frau etwas verändern möchte, denn auf die karriere pfeifen und alles auf die ideale setzen, die mensch zumindest in der theorie so gut vertritt, denn klappt es auch im stadtteil und irgendwann vielleicht sogar in der ganzen stadt...
Warum ...
... das, was ihr da macht, nicht Bestandteil der Politik der Interventionistischen Linken sein kann, das verstehe ich nicht.
Nixdestotrotz finde ich den Ansatz völlig okay. Nur, um die Verhältnisse wirklich umzukrempeln, benötigen wir eine verbindliche überregionale und internationalistische Organisierung. Die selbstredend bei Alltagsproblemen präsent sein muss und nicht im eigenen Saft schmort.
Theorie und Praxis
Die Ideen der IL mögen zum Teil ja gar nicht schlecht sein. Sie schliessen sich ja zum großen Teil auch nicht mit euren Ideen aus. Das Problem der IL ist, zumindest in Norddeutschland (und da kommen die Autor_innen dieses Texts ja auch her) ein strukturelles. Die IL stellt kein Zusammenschluss der jeweils am besten vernetzten Politgruppen der einzelnen Städte hin, sondern ist das Auffangbecken für die politisch in der Bedeutungslosigkeit verschwundenen Ortsgruppen von Avanti. Die Hoffnung ist also, die mangelnde lokale Verankerung in politischen Kämpfen durch bundesweites Bewegungsmanagement zu überwinden. Das führt automatisch zu einer weiteren Entfremdung von der Realität in den jeweiligen Städten. Viel schöner wäre gewesen, wenn sich jeweils vor Ort relevante Gruppen bundesweit vernetzen würden. Dann würde "think global, act local" auch klappen. Aber der Zug ist nun abgefahren, da mit dem marginalisierten Altherrenclub mit Dominanzanspruch Avanti ja kein Mensch (dauerhaft) zusammenarbeiten will...
Solidarity Networks und Syndikalismus
Ahoj,
erstmal ganz viel dito, wenns mich auch nie in die IL verschlagen hat, lässt sich das je leider auf fast alle größeren linsradikalen Zusammenschlüsse beziehen. Die Arbeit die ihr macht klingt auch super.
Da ihr ja die nicht die einzigen seid und aktuell ja auch diverse Texte und Häft zum Konzept der "Solidarity Networks" bestehen, stellt sich mir eine Frage: Ich bin aus ganz ähnlichen Beweggründen vor ein paar Jahren in die FAU gegangen. Ich bin in einem Syndikat das stetig wächst und aus den selben Gründen wie ihr sie beschreibt dabei geblieben.
Nun erwähnt ihr die anarchosyndikalistischen Gewerkschaften ja eher mit einem Seitenhieb und auch da würde ich euch zustimmen: Große Organisationen entwickeln einen Hang zum Konservatismus. Grund dafür ist aber m.M.n., dass sich in einer großen Organisation einfach mehr Querschnitt der gesellschaftlich vorhandenen Positionen finden lässt, als in einer kleinen, wo entweder eh schon alle radikal sind oder aber eben mensch schnell Sachen miteinander ausdiskutieren kann. Ich würde mutmaßen, es wird eurem Netzwerk auch nicht anders gehen, wenn erstmal 1000-2000 Leute mitmachen. Wichtig ist m.M.n. deshalb das Weiterbildung und Diskussion beim Größerwerden solcher Organisationen und Netzwerke immer mitdenken muss und mensch sich Konzepte überlegen muss, damit nicht Teile der Mitgliederbasis/ der Netzwerkenden von solchen Diskussionen abgehangen werden oder anders herum ein politischer Bekenntniszwang entsteht.
Für mich daher noch mal die Frage: War die FAU, als eine Struktur die ganz ähnliche Arbeit leistet, aber noch den Vorteil hat bundesweit vernetzt zu sein und damit auch mehr Kassen in der Hinterhand zu haben, für euch eine Option als ihr angefangen habt? Wenn nein, warum nicht? Was hat euch abgeschreckt, was erscheint nicht plausibel etc..
Ich denke über solche Dinge müssen wir viel öfter sprechen, wollen wir gemeinsam weiterkommen mit sozialer Bewegung in diesem Land.
Danke für eure Arbeit, den Artikel etc. und lieben Gruß!