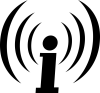Die Occupy-Bewegung hat es gezeigt: Viele der jüngst in den Blick geratenen sozialen Bewegungen sind durch anarchistische Ideen geprägt. Ist nach dem Scheitern des Sozialismus der Anarchismus die linke Utopie der Zukunft?
Als der russische Wissenschaftler Timofey Pnin, die Hauptfigur des gleichnamigen Romans von Vladimir Nabokov, 1940 mit dem Schiff in den Vereinigten Staaten anlangt, wird ihm bei der Einreise eine ultimative Frage vorgelegt. Ob er Anarchist sei, will der Zollbeamte wissen. Pnin, aus einem Heimatland der Bewegung stammend, erkundigt sich beflissen, welche Form des Anarchismus gemeint sei - der „praktische, metaphysische, theoretische, mystische, abstrakte, individuelle oder der soziale“? In jungen Jahren habe das alles Bedeutung für ihn gehabt.
Der Beamte verkürzt die „interessante Diskussion“ und lässt den harmlosen Gelehrten zur politischen Ausnüchterung erst einmal zwei Wochen auf Ellis Island schmoren. Der hinter dieser Maßnahme stehende „Anarchist Exclusion Act“ stammt aus dem Jahr 1918.
Zwei Jahre zuvor, 1916, denkt Mohandas Karamchand Gandhi, gerade als erfolgreicher gewaltloser Rebell aus Südafrika nach Indien zurückgekehrt, in einer Rede zur Einweihung der Hindu-Universität von Benares ebenfalls laut über verschiedene Formen des Anarchismus nach. Für die Radikalität einiger seiner Landsleute, die durch Attentate versucht hatten, die Unabhängigkeit Indiens zu erzwingen, zeigt er zwar Verständnis, verurteilt die Gewalttaten aber als unehrenhaft und „Zeichen für Angst“. Als sich Gandhi, ein Verehrer Leo Tolstois und Henry David Thoreaus, in der Rede schließlich selbst als „Anarchist, aber von einer anderen Art“ bezeichnet, bricht Protest unter den anwesenden englischen Honoratioren los, die Rede wird abgebrochen.
Heute, hundert Jahre später, gilt öffentliches Nachdenken über den Anarchismus in vielen institutionellen Zusammenhängen noch immer als politischer Selbstmord. Die Bewegung mit den vielen Adjektiven und Ausprägungen, die auf das griechische „an-archia“ zurückgeht, also Herrschaftslosigkeit bedeutet, wird intuitiv meist mit Ordnungslosigkeit gleichgesetzt und in die Nähe terroristischer Gewalt gerückt - eine Spätfolge der Bombenattentate und Umsturzversuche zur Jahrhundertwende. Und auch im jüngsten Verfassungsschutzbericht wird der „Traditionelle Anarchismus“ zwar als lediglich kleine Gruppe aufgeführt, doch sei der Linksextremismus insgesamt durch teils „diffuse . . . anarchistische Ideologiefragmente“ geprägt.
Dass damit der Anarchismus unserer Tage nicht vollständig erfasst ist, zeigt die von breiter Sympathie getragene internationale Demonstrationswelle der letzten Monate. Vor allem mit der Occupy-Bewegung ist eine junge Protestkultur abseits des Linksextremismus entstanden, die sich zwar nicht anarchistisch nennt, mit ihrer Kapitalismus- und Globalisierungskritik, Werten wie „Dezentralität“, „Zwanglosigkeit“ und „Basisdemokratie“ sowie ihrer horizontalen Organisationsstruktur einen anarchistischen Kern aber nicht leugnen kann. Viele Beteiligte scheinen sich dessen nicht einmal bewusst zu sein, was die Bewegung zum einen vor dem herkömmlichen Anarchismus-Verdikt schützt, zum anderen aber auch eine benennende Bündelung und Anknüpfung an Vorhandenes verhindert.
Naturgesetz der „gegenseitigen Hilfe“
Als bevorzugte Methode horizontal-demokratischer Praxis hat sich dabei - lässt man die Krawalle von Tottenham und die griechischen Tumulte einmal beiseite - der gewaltlose Widerstand durchgesetzt. Wie sonst auch sollte der Widerspruch vermieden werden, einen herrschaftslosen Idealzustand mit autoritären Mitteln herbeiführen und kontrollieren zu wollen, ein Widerspruch, den schon anarchistische Vordenker wie Michail Bakunin gegen Marx oder Pjotr Kropotkin gegen Lenin in Stellung gebracht hatten. Befragt man die letzten verbliebenen Occupy-Aktivisten zum Beispiel in Frankfurt nach ihren Vorbildern, antworten sie, sich am ehesten wohl auf Gandhi einigen zu können - eine Inspirationsquelle, die neben Slavoj Zizek in seiner New Yorker Occupy-Rede auch Kommentatoren etwa des englischen „Guardian“ der Bewegung ans Herz gelegt haben. Eine späte Genugtuung für den „anderen Anarchisten“ Gandhi.
Schnittmengen wie diese veranschaulichen das eigentlich Erstaunliche an der neuen Bewegung: Obwohl sie scheinbar voraussetzungslos auftauchte und ihre Forderungen auffällig zurückhaltend formuliert, ist sie in ihren Basiswerten überraschend gleichgerichtet, als werde in ihr tatsächlich ein menschliches Naturgesetz der „gegenseitigen Hilfe“ abgerufen, von dessen Nachweis schon Kropotkin träumte. Oder ist es schlicht das Internet, das diesen massiv horizontalen Geist erzeugt? Ästhetisch vorweggenommen wurde die wie aus dem Nichts mobilisierbare Interessengemeinschaft in jüngster Zeit vor allem von den Massenszenen des Kinofilms „V wie Vendetta“, in dem zahlreiche anarchistische Symbole verwendet werden, was der Bewegung zum Beispiel auch die Guy-Fawkes-Maske zuspielte.
Dass der Anarchismus im Begriff steht, eine neue linke Bewegung zu überwölben und zum Marxismus des neuen Jahrtausends zu avancieren, hatte bereits 2001 Barbara Epstein, eine Gründungsredakteurin der „New York Review of Books“ und Kennerin der amerikanischen Protestkultur, in der „Monthly Review“ vorausgesagt. Ausgegangen war sie von den sogenannten globalisierungsfeindlichen WTO-Protesten 1999 in Seattle, in denen sich, so Epstein, allerdings eher eine „anarchist sensibility“ denn ein originärer Anarchismus geäußert habe.
Neue Anarchisten bei der Arbeit
Epstein bezweifelt, dass die Protestler ihren Bakunin gelesen hatten, und erblickt die Wurzeln der Antiglobalisierungsbewegung im nuklearfeindlichen „nonviolent direct action movement“ der siebziger Jahre, das, so Epstein, von den spanischen Anarchisten der dreißiger Jahre das Konzept der „affinity group“, von der Bürgerrechtsbewegung den zivilen Ungehorsam und von den Quäkern das Konsensprinzip übernommen hatte. Gegenüber den Vorgängern zeichneten sich die Globalisierungskritiker der späten Neunziger allerdings durch eine stärkere „ideologische Kreativität“ aus, ihre Maßstäbe seien derart „soft and fluid“, dass viele der neuen Anarchisten nicht einmal mehr bestimmte Formen staatlicher Gewalt ablehnten und das Kooperationsprinzip für so dehnbar hielten, dass es sogar den Kapitalismus umfassen könne.
Auf die Protestformen des Jahrs 2011 könnte Epsteins Vorhersage nicht besser zutreffen. Das veranschaulicht eine fast willkürlich herausgegriffene Ereigniskette aus dem Dezember des vergangenen Jahres in Deutschland. Während am 8. des Monats Josef Ackermann von italienischen Anarchisten eine Briefbombe zugeschickt bekam, kampierte einige Meter entfernt eine Gruppe von Occupy-Aktivisten friedlich vor der Europäischen Zentralbank. Deren Hamburger Verbündete wiederum hatten Ackermann einige Tage zuvor mit charakteristischer Guy-Fawkes-Maske aufgelauert und seine Rede vor der städtischen Handelskammer unterbrochen. Auf engstem Raum konnte man hier verschiedenen Formen des Anarchismus bei der Arbeit zusehen: einem gewaltbereiten von vorgestern, kontrastiert von einem passiven neuen, der wiederum flankiert wurde von einem provokativ-aktionistischen, aber nicht im engeren Sinne gewalttätigen. Die Zielscheibe war in allen drei Fällen die gleiche: das Bankenwesen, gegen das am Rosa-Luxemburg-Geburtstag 2012 aber zum Beispiel auch eine unverbundene Allianz von Anhängern der Partei „Die Linke“ mit Protestgruppen um das Bündnis Attac und Occupy Berlin in unterschiedlichen Ecken der Hauptstadt demonstrierte.
Es wäre aber falsch, auf den Gedanken zu verfallen, anarchistische Ideen seien lediglich eine Art kleinster gemeinsamer Nenner einer jeden Protestbewegung und damit wegkürzbar. Dem widerspricht schon, dass die bewusst führungslose Organisation der neuen Bewegungen ihre Wirksamkeit eher behindert. Und außerdem sind einige der anerkanntesten Impulsgeber der Occupy-Bewegung dann doch bekennende Anarchisten: Auf Micah White, der sich als „mystischer Anarchist“ bezeichnet und zusammen mit Kalle Lasn die Zeitschrift „Adbusters“ herausgibt, gehen zum Beispiel Name und Auftaktdatum der Occupy-Wall-Street-Bewegung zurück; ihr E-Mail-Verteiler mit 90 000 Adressaten brachte, diese Vorgeschichte erzählt das Magazin „New Yorker“, die Bewegung erst in Gang, und es war eine Gruppe von „Transgender- Anarchisten“, welche die Website „OccupyWallSt.org“ eröffnete.
Moderiert wurde die erste „general assembly“ von dem Anarchisten David Graeber, einem in London lehrenden amerikanischen Anthropologen, dessen Einfluss auf die Bewegung und ihre Außenwahrnehmung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. In seinem neuen Buch „Debt - The First 5000 Years“ entlarvt er die schon in Mesopotamien aufkommende Schuldenkultur als seither verfeinertes Herrschaftsinstrument der Besitzenden und trifft damit die Sorge vor allem der amerikanischen Studenten, ihre Ausbildungsschulden niemals zurückzahlen zu können, ebenso wie die verbreitete Wut gegenüber den ungleichen Besitzverhältnissen, die zu dem Slogan „Wir sind die 99 Prozent“ führte.
Riecht der publizistische Anarchismus sonst nach modernem Antiquariat und haftet vielen Anarchismus-Einführungen noch ein veraltet wirkender, revolutionsfixierter Ton der sechziger Jahre an, gelingt es Graeber, in seiner bereits 2007 auf Deutsch im Hammer-Verlag erschienenen Einführung „Frei von Herrschaft - Fragmente einer anarchistischen Anthropologie“ (englische Fassung der „Fragments“) jene Fluidität zu erzeugen, die ganz unterschiedliche basisdemokratische Konzepte zu binden imstande ist.
Sind wir alle Freizeitanarchisten?
Mit anthropologisch-ethnologisch geschärftem Blick versucht Graeber hier, dem Anarchismus einen neuen Horizont zu eröffnen. Die Pariser Kommune von 1871 und die Arbeiterselbstverwaltung im Spanischen Bürgerkrieg, klassische Beispiele anarchistischer Großverbünde, kommen bei ihm nur am Rande vor; Graeber verfolgt anarchistische Gemeinschaften bis in den afrikanischen Regenwald, blickt auf den 1994 von mexikanischen Zapatisten begonnenen Konflikt in Chiapas oder die Staatenlosigkeit Madagaskars in den frühen neunziger Jahren. Dort zum Beispiel hatte sich, Graeber berichtet das aus eigener Anschauung, nach der Finanzkrise der achtziger Jahre die Zentralregierung aus den meisten ländlichen Gemeinden einfach zurückgezogen, die Polizei stellte die Arbeit weitgehend ein, und den örtlichen Organisationen blieb nichts anderes übrig, als lokale Entscheidungen selbst zu treffen. Schildbürgerartig erhielten die Insulaner einen staatlichen Eindruck aufrecht, um ansonsten in ihrer Selbstverwaltung in Ruhe gelassen zu werden. Brav erschien die Bevölkerung regelmäßig auf Ämtern, um irgendwelche Formulare auszufüllen, dabei zahlte, so Graeber, im Grunde niemand mehr Steuern.
Die Kriterien für revolutionäre Bestrebungen hängt Graeber auffällig niedrig. Für ihn genügt schon „der passive Widerstand gegen staatliche Einrichtungen“, verbunden mit der „Herausbildung autonomer und verhältnismäßig egalitärer Formen der Selbstverwaltung“. Eine Definition, die zur Folge hat, dass man dem revolutionären Anarchismus eine fast grenzenlose Verbreitung zuschreiben muss.
Im Grunde sind wir dann alle zumindest Freizeitanarchisten: Wir amüsieren uns über Querulanten und Saboteure der herrschenden Verhältnisse wie die Schwejk-Figur des bekennenden Anarchisten Jaroslav Hasek, uns wird ganz brüderlich zumute, wenn wir unentgeltlich und in freiwilliger Eigenregie mit anderen zum Aufbau von Spielgeräten für Kindergärten beitragen, und wir meistern täglich aus voller Überzeugung den Anarchismus moderner Kleinfamilien.
Schwäbische Kampfrentner reißen die Zäune um den Stuttgarter Bahnhof ein, in ländlichen Gebieten gedeihen Nachbarschaftshilfe und Schwarzarbeit, für den Lebensabend liebäugeln wir mit rüstigen Selbstversorgerkommunen. Wenn es aber darum geht, unsere moderne Welt ohne Herrschaftsstrukturen zu denken, strecken wir, plötzlich wieder ganz Realisten, die Waffen.
Wie ist diese Phantasielosigkeit zu erklären, warum können wir uns so richtig keine „Bürgerschaft außerhalb des Staates“ vorstellen? Unser Problem ist, dass wir Gesellschaft immer gleich als Staatengebilde denken, meint David Graeber und umreißt eine mögliche Utopie der Staatenlosigkeit als „unendliche Vielfalt von Gemeinschaften, Vereinen, Netzwerken, Projekten in jeder denkbaren Größenordnung“, die sich „auf jede uns vorstellbare Art und Weise“ überlappen und überschneiden. Graeber weiß, dass das abstrakt und unrealistisch klingt, für Konkretheit könne nur die Praxis sorgen.
Den Anarchismus der Gegenwart beschreibt er als Projekt, offene Entscheidungsfindungsprozesse zu etablieren, ein Vorhaben, in das Techniken der „facilitation“ - der Anleitung zur besseren Ermöglichung erfolgreicher Gruppenprozesse - sowie jener Konsensfindung einfließen müssten, die historischen und bestehenden anarchistischen Verbünden abzuschauen sei. Bei der ersten „general assembly“ der New Yorker Occupier hat Graeber versucht, diese nicht allzu üppigen Vorgaben umzusetzen.
Symbol des Horizontalismus
Dort nämlich ließ sich, wie die Augenzeugenberichte in der gerade bei Suhrkamp erschienenen Dokumentation „Occupy! Die ersten Wochen in New York“ zeigen, das Bedürfnis nach ordnenden anarchistischen Konzepten in fast jeder Phase spüren. Die Gruppe meist junger Menschen, die sich nach der Adbuster-Initiative im September 2011 im New Yorker Zuccotti-Park zusammenfindet, nimmt die Eroberung des öffentlichen Raums als ganz bewussten Akt wahr - als ginge es darum, die von Alexis de Tocqueville beschriebene demokratische Eroberung Amerikas von unten nach oben nachzustellen. „Empörung“, der Leitbegriff von Stéphane Hessels Streitschrift und der spanischen Bewegung der „Indignados“, beschreibt die Stimmung der schnell anwachsenden Gruppe am besten und findet sich als Leitmotiv auf zahlreichen Plakaten wieder. Die Demonstranten drückt die Aussichtslosigkeit, in einen „sinnvollen“ Beruf eintreten zu können, verbunden mit hohen Ausbildungsschulden, die im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen.
Das Grußwort des libertären Sozialisten Noam Chomsky lässt nicht lange auf sich warten, doch obwohl die Gruppe anarchistischen Idealen anhängt, das Bankenwesen beschränken, Konzerngelder in der Politik verbieten, Generationengerechtigkeit und „wirtschaftliche Gerechtigkeit“ (über eine Reichensteuer) herstellen will, betrachtet sie die meist schwarzgekleideten Anarchisten unter sich als Binnengruppe mit Randfiguren wie dem „Chassidim-Anarchisten“ oder dem „Anarchokapitalisten“. Bei öffentlichen Diskussionen wird zwischen dem Flügel der Sozialisten und dem der Anarchisten unterschieden, die aber beide für die gleiche Zeitung schreiben.
Obwohl die Theorielastigkeit einzelner Anarchisten gerade die Gelegenheitsdemonstranten zu befremden scheint, gelten Standards wie „offene, partizipative Strukturen“ als nicht verhandelbar. In den „general assemblies“ wird ein gemeinsamer Konsens angestrebt, standardisierte Hand- und Armbewegungen ermöglichen ein permanentes Feedback der Zuhörer; das menschliche Mikrofon, mit dem wegen des permanenten Trommlerlärms die Rednerbeiträge durch Echoisierung der Zuhörer weitergereicht werden, wird zum augenfälligsten Symbol der Horizontalität. Gelegentlich aufkommende Forderungen, einen Anführer zu wählen, werden zurückgewiesen, allerdings macht viele Zuhörer ein Auftritt des Philosophen Slavoj Zizek nachdenklich, der darauf hinweist, „dass selbst führerlose Bewegungen eigentlich immer Anführer haben, die sich allerdings im Hintergrund halten“.
Recht auf Faulheit
Genau dieser Eindruck verfestigt sich bei vielen Demonstranten schon nach wenigen Tagen. Sie haben das Gefühl, nicht die „general assembly“, sondern kleine Hinterzimmergruppen seien das Zentrum der Entscheidungsfindung. Parallel werden die Organisationsprobleme immer größer, die Bewegung fragt sich, wie sie trotz der Expansion transparent bleiben könne. Eine Aufspaltung in Untergruppen nach spanischem Vorbild und ein Sprecherratmodell werden erwogen.
Inzwischen nagt an vielen auch der Zweifel, ob die Bewegung wirklich zielgerichtet genug vorgehe und ausreichend Forderungen stelle. Selbst die ihnen gegenüberstehenden Polizisten, welche die radikal-anarchistische Ablehnung staatlicher Institutionen auf sich ziehen (“Scheiß auf die Polizei, aber sei nett zu den individuellen Beamten“), wirken gelangweilt. Selbstkritisch schreibt die Filmemacherin Astra Taylor am 23. September: „An dieser Stelle muss ich sagen, dass mich die allgegenwärtige historische Unwissenheit (über vergangene Bewegungen sowie effektive Strategien und Taktiken) deprimiert.“
Erheben einige die Forderung nach einem Gesetz, „dass jeder Job sinnvoll sein muss“, und andere nach Vollbeschäftigung, machen Dritte ein ebenfalls traditionell-anarchistisches „Recht auf Faulheit“ geltend: Vollbeschäftigung sei überflüssig, die Amerikaner arbeiteten ohnehin zu viel. Überlegungen zur Institutionalisierung eines Zieleinkommens - ein anarchistisches Vorzugsprojekt, das schon auf die mittelalterliche Handwerkerschaft zurückgeführt wird - unterbleiben; pauschal wird erwogen, die Banken sollten ein Mindesteinkommen zahlen.
Angesichts dieser immer wieder ausbrechenden, die Ratlosigkeit nicht verbergenden Kakophonie erweist sich die von vielen verfochtene Enthaltsamkeit bei konkreten Forderungen als wirksamstes Protestmittel. „Es gibt Zeiten, da ist das Dümmste, was man tun kann, das Schwingen einer roten oder schwarzen Fahne und die Veröffentlichung von Erklärungen“, hatte Graeber in seinen „Fragmenten“ geschrieben. Und tatsächlich war es die eindrucksvollste Geste des inzwischen aufgelösten Zeltplatzes im Zuccotti-Park, dass eine Generation Praktikum/Ausbildungsschulden dem servilen Funktionieren im bestehenden System eine entschiedene Absage erteilte - stumm, aber präfigurativ, ein gewünschtes Gesellschaftsmodell vorwegnehmend.
Horizontaler Parlamentarismus
In die derzeitige parlamentarische Demokratie jedenfalls schien, wie einige Kommentatoren feststellten, kaum einer der Protestierenden mehr Energie stecken zu wollen. Die Occupy-Bewegung machte augenfällig, dass die „projektbezogene Bezugsgruppe“ dem Parteieintritt den Rang abgelaufen hat. Wie es mit der Bewegung weitergeht, ist offen.
Umso interessanter ist ein Blick auf die institutionalisierte Variante des neuen Horizontalismus, die in Deutschland gerade am Beispiel der Piratenpartei zu studieren ist. Aussetzen kann sie die Lösung der komplexen Probleme ihrer Zeit jedenfalls nicht, den tendenziellen Widerspruch eines angestrebten Horizontalismus innerhalb eines parlamentarischen Systems mit eingespielten Entscheidungsprozessen hat sie tapfer zu tragen.
Hundert Tage nach dem Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus hat die Partei viel Zeit mit der Raumverteilung und der Vergabe von Parteiämtern verloren. Sie spricht sich für das bedingungslose Grundeinkommen und Volksabstimmungen aus, gestaltet Parteitage als graswurzelartige Generalversammlungen, erleichtert die Mitsprache durch Computerprogramme wie „Liquid Feedback“, lässt aber vor allem ein konsistentes sozialpolitisches Konzept vermissen, das sich, allein wegen der vielen strukturellen Ähnlichkeiten zwischen anarchistischen Organisationsprozessen und solchen des Internet (dem Leibthema der Piraten), in der Auseinandersetzung mit dem Anarchismus schärfen könnte.
Der Anarchismus wäre momentan, den gezeigten Schwächen zum Trotz, ein vorzügliches Instrument, um zu erklären, warum Erscheinungen wie der Berufspolitiker oder die Parteidisziplin zunehmend als veraltet und oft peinlich erscheinen. In puncto faire und flexible Arbeitsbedingungen erhebt der Anarchist die höchsten Ansprüche; für Politiker, die dem Einfluss der Wirtschaft unterliegen, muss er auch nicht das geringste systemische Verständnis aufbringen. Wie keine zweite politische Philosophie verpflichtet der Anarchismus auf basisdemokratische Ideale und Transparenz.
Die größte Angst vor dem Anarchismus und zeitgemäßen Forderungen in seinem Namen scheint momentan allerdings der ihm nahestehende parteigebundene Horizontalismus zu haben. Dabei zeigt zum Beispiel Obamas jüngste reichtumskritische Rede zur Lage der Nation oder eine Reihe von Bemerkungen Angela Merkels in den vergangenen Wochen, dass die Annäherung an die neuen sozialen Bewegungen bereits auf höchster Ebene begonnen hat. Wie ernst es den Regierenden damit ist, wird sich zeigen. Der Grad der Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit dem Anarchismus erweist, für wie gerecht sie ihre parlamentarische Demokratie hält.