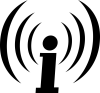Deutschland gilt als Land des sozialen Friedens. Das hat eine lange Tradition, deren nationalistischer Gehalt sich in der Krise besonders deutlich zeigt.
Manchmal schafft die Wirklichkeit Bilder von solcher Symbolkraft, wie sie die einfallsreichste Literatur nicht erfinden könnte. Während sich im November 1918 Arbeiter in den Straßen Berlins hinter Barrikaden verschanzten, tagten in derselben Stadt Gewerkschaftsfunktionäre und Unternehmer, um ein Abkommen zu schließen. Wahrscheinlich zogen sie die schweren Vorhänge zu, damit der Lärm der Schießereien ihre Gespräche nicht allzu sehr störte. Unbeirrt vom Fall der Monarchie und revolutionären Umtrieben brachten Carl Legien, Hugo Stinnes und Carl Friedrich von Siemens ihre Verhandlungen mit der Unterzeichnung des »Arbeitsgemeinschaftsabkommens« zu Ende, heute besser bekannt als Stinnes-Legien-Pakt.
Der soziale Frieden, während des »Burgfriedens« im Ersten Weltkrieg herangereift, war geboren. In kaum einem anderen Land sollte diese Form der sozialen Konfliktvermeidung derart die Arbeitsbeziehungen prägen wie in Deutschland. Heute, im Verlauf der weltweiten Wirtschafts- und europäischen Schuldenkrise, tritt der regressive Charakter dieser vermeintlich harmonieorientierten Tradition voll zu Tage. Denn gerade die Negation der sozialen Konflikte erweist sich als sozioökonomisch brisant, auch und gerade im internationalen Zusammenhang.
Der aktuelle Arbeitskostenbericht der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Schluss, dass die Lohnkosten hierzulande so gering gestiegen sind wie sonst nur in den krisengeschüttelten EU-Staaten Griechenland und Irland. Eine unlängst von der OECD vorgelegte Studie zur Einkommensverteilung weist außerdem darauf hin, dass die Schere zwischen Vermögenden und Geringverdienern weltweit immer mehr auseinandergeht, besonders stark jedoch in Deutschland (siehe Jungle World 50/11). Zusehends entwickelt sich Deutschland zum Billiglohnland. Diese besonderen deutschen Verhältnisse sind auch im europäischen Ausland spürbar. Im vergangenen Jahr kritisierte Christine Lagarde, damals noch französische Wirtschafts- und Finanzministerin, öffentlich die deutsche Wirtschaftspolitik als eine Strategie, die auf Kosten der Nachbarstaaten gehe. Deutschland verschaffe sich mit Billiglöhnen im Außenhandel einen Wettbewerbsvorteil, dem es entgegenzuarbeiten gelte.
Was die jetzige Direktorin des Internationalen Währungsfonds damit meint, ist klar: Die Löhne in Deutschland müssten stärker und schneller steigen. Denn der umgekehrte Ansatz, das Abbremsen von Lohnzuwächsen in Frankreich und anderen führenden Volkswirtschaften der Euro-Zone, wäre nur schwer denkbar. Dort gibt es nämlich Gewerkschaften, die ihre Aufgabe als Konfliktakteure wahrnehmen und die Durchsetzung von Unternehmerinteressen zumindest erschweren. In Deutschland herrscht hingegen sozialer Frieden. Hier bestimmt der Leitgedanke von der Sozialpartnerschaft das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es ist kein Wunder, dass nur in einem einzigen europäischen Land weniger Streiktage anfallen. Und dabei handelt es sich um Österreich, dessen Arbeitsbeziehungen von einer ähnlichen Gewerkschaftstradition wie in Deutschland geprägt sind.
Wenn heute von sozialem Frieden gesprochen wird, oder von Frieden ganz allgemein, wird die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes zumeist übersehen. Im Kern handelt es sich nicht um einen idyllischen, harmonischen Zustand, sondern vielmehr um einen Vertrag, in dem sich beide Seiten auf Regeln zur Konfliktbewältigung einigen. Wer sich an diese Regeln hält, wahrt den Frieden, wer nicht, bricht ihn. Daher wird heute etwa noch vom Landfriedensbruch gesprochen. Nicht zuletzt dieses Friedensverständnis erklärt die starke gesetzliche Reglementierung von Arbeitskämpfen in Deutschland. Während etwa die französische Verfassung das Recht auf Streik garantiert, gelten in der Bundesrepublik strenge Richtlinien, wann wer wofür streiken darf. Politische Streiks sind ebenso verboten wie Solidaritätsstreiks.
Eine deutsche Gewerkschaft darf nur für eigene, im Wesentlichen tarifliche Interessen eintreten. Und wurde ein Tarifvertrag geschlossen, gilt während seiner Laufzeit die Friedenspflicht, sprich ein Streikverbot. In Frankreich dagegen sind Unterstützungsstreiks ein wichtiges Druckmittel, Betriebsbesetzungen relativ normal und der politische Streik ist ein übliches Element der Demokratie. Es mag nur auf den ersten Blick paradox erscheinen, dass französische Gewerkschaften juristisch schlechter gestellt, also ihre Rechte weniger geregelt sind als die deutscher Gewerkschaften, und sie doch agiler und kämpferischer auftreten. Denn auch sie selbst sind dadurch weniger reguliert. Nicht zuletzt rührt ihre Praxis aus einer anderen Gewerkschaftstradition her.
Während in Ländern wie Frankreich, Spanien und Italien die Beziehung zwischen Unternehmern und Arbeiternehmern nach wie vor als strukturelle Gegnerschaft verstanden wird, suchen in Deutschland Gewerkschaften und Unternehmerverbände stets nach gemeinsamen Interessen. Da es den Standort Deutschland zu bewahren gelte, werden diese immer wieder gefunden. Nicht von ungefähr erinnert dies an die Parole des Kaisers bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, er kenne keine Parteien mehr, sondern »nur noch Deutsche«. Der berüchtigte »Burgfrieden« wurde nicht nur mit der SPD, sondern auch mit den Gewerkschaften geschlossen. Der daraus hervorgegangene soziale Frieden, das Konzept von Sozialpartnerschaft und sozialer Konfliktvermeidung, ist seinem Wesen nach nationalistisch. Es appelliert an patriotische Gefühle anstatt an die internationale Solidarität der Lohnabhängigen. Und das bis heute.
Ein Blick nach Österreich verdeutlicht den Charakter des sozialen Friedens. Die Sozialpartnerschaft ist dort nicht einfach eine ritualisierte Interaktion, sondern sogar förmlich institutionalisiert. Bis ein Streik überhaupt legal durchgeführt werden kann, müssen zunächst so viele Instanzen der vier Kammern (Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Arbeiterkammer sowie der Gewerkschaften) durchlaufen werden, dass es fast unmöglich wird, zu streiken. Österreich weist denn auch eine Streikquote auf, die noch unter der von Deutschland liegt, vergleichbar mit despotischen Staaten Afrikas oder Asiens. Und die österreichische Sozialpartnerschaft, von den österreichischen Sozialdemokraten und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (DGB) unerschüttert als Errungenschaft gefeiert, steht in unübersehbarer Tradition des ständisch ausgerichteten Korporatismus der dreißiger Jahre. Dieses Konzept band Arbeiter- und Unternehmerverbände in ein starres gemeinsames System ein, welches dem patriotisch gesinnten Interessenausgleich und der Streikvermeidung diente. Vorbild dafür war das Arbeitsbeziehungsmodell des faschistischen Italien, an dem sich der Austro-Faschismus orientierte.
Österreich ist oft ähnlich wie Deutschland, nur schlimmer. Wie der DGB folgt auch der ÖGB dem Prinzip der entpolitisierten Einheitsgewerkschaft, das seine Wurzeln in der sozialdemokratischen Arbeitsteilung von Partei und Gewerkschaft hat. Wobei der ÖGB nicht einmal dem Grundsatz der Industriegewerkschaft folgt, also sich nicht nach Branchenzugehörigkeit organisiert, sondern ständische Berufsgewerkschaften einschließt. Rückständiger ist kein anderer Gewerkschaftsdachverband der EU. Immer wieder wird argumentiert, die Einheitsgewerkschaft sei eine Errungenschaft, denn Gemeinsamkeit mache stark. Faktisch jedoch stellt die deutsche beziehungsweise österreichische Einheitsgewerkschaft weniger die Einheit der Beschäftigten her, als dass sie Arbeitskämpfe erschwert, marginalisiert oder regelrecht unterbindet. Dabei verwirft sie auch den demokratischen Pluralismus zugunsten eines nationalen Konsenses, der euphemistisch sozialer Frieden genannt wird.
Die Wahrung des sozialen Friedens ist zu einem Schlagwort in der Politik geworden. Gerne wird dabei mahnend auf das Ausland verwiesen, auf brennende Vororte in Frankreich und Großbritannien, eskalierende Demonstrationen in Griechenland und Spanien. Aber selbst wenn auch hierzulande Neubausiedlungen an den Stadträndern von tagelangen Unruhen erschüttert werden sollten, hätte dies kaum etwas mit sozialem Unfrieden gemein und würde ihn sicherlich nicht ernsthaft in Frage stellen. Die Angst, die das deutsche Bürgertum vor fast 100 Jahren umtrieb, war weniger die vor einem unberechenbaren Mob als die vor einer organisierten Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, die an den Grundfesten der ökonomischen Ordnung hätte rütteln können.
Doch die eigentliche Bedrohung geht vom sozialen Frieden selbst aus. Als Gegenentwurf zum Klassenkampf steht er für eine Masse entmündigter Lohnabhängiger, die ihre Interessen bloß nicht selbstbewusst artikulieren sollen. Wenn Menschen, die sich nicht über ihre eigene ökonomische und politische Lage im Klaren sind, aus einem diffusen Gefühl sozialer Ängste heraus aufbegehren, gefährden sie nicht die marktwirtschaftliche Ordnung, sondern nur sich gegenseitig. Am Ende stehen entweder aufständische Strohfeuer, die hysterische Reaktionen bewirken oder bestenfalls im Nichts verpuffen, oder die Hinwendung zu autoritären Losungen und Bewegungen. Das bedroht nicht nur die Demokratie, sondern am Ende den einen, großen Frieden. Den nämlich, der das Gegenteil von Krieg bedeutet.