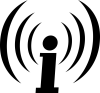Die Revolutionäre haben sich im Zuccotti-Park eingerichtet, ähnlich wie man sich den Kairoer Tahrir-Platz vor ein paar Monaten vorstellt. „Besetzt die Wall Street“ lässt in New York Protestformen der 60er-Jahre aufleben. Nur die Ziele sind nicht so ganz klar.
New York –
Jonathan Gregano sieht müde aus. Er hat Ringe unter den Augen, seine Haare sind verklebt und seine Jeans verschmiert. Auf dem Pappteller, den er sich in der improvisierten Feldküche mitten im Zuccotti-Park im Finanzdistrikt von Manhattan voll geladen hat, liegt ein Gemisch aus Gummibärchen und kalten Nudeln, das er gierig verschlingt.
So ernährt sich die Revolution. Gregano war von Anfang an dabei, als vor drei Wochen das Internet-Netzwerk Anonymous dazu aufrief, die Wall Street zu besetzen. Seither campiert der 29-jährige Hip-Hop-Produzent aus Brooklyn mit Hunderten anderer Unzufriedener hier auf einer schmucklosen Betonfläche am Trinity Place, wo sonst das Bürovolk aus den umliegenden Wolkenkratzern in der Mittagspause seine Sandwiches mit Starbucks-Kaffee herunter spült.
Es war der einzige Ort im Bezirk, der den jungen Unzufriedenen offenstand. Die Wall Street selbst wurde abgeriegelt. Die New Yorker Polizei hatte die Twitter-Updates auch gelesen und sich in Hundertschaften rund um die Börse postiert. Die panzersicheren Barrikaden, die man nach dem 11. September in der Straße versenkt hatte, waren ausgefahren und Einsatzwagen blockierten die Zufahrten. Das symbolische Zentrum des Finanzkapitalismus wurde bewacht wie die Goldreserven von Fort Knox.
Also haben sich die Revolutionäre hier im Zuccotti-Park eingerichtet. Es ist ein gut organisiertes Lager mittlerweile, ähnlich wie man sich den Kairoer Tahrir-Platz vor ein paar Monaten vorstellt. Es gibt ein Medienzentrum unter einer Plane, wo ein Generator aufgestellt wurde und wo nun fleißig gebloggt wird. Einer der Demonstranten hat sich einen schlecht sitzenden Anzug angezogen und steht als Pressekontaktmann zur Verfügung. Drei Mal pro Tag wird Essen ausgegeben, an der Ecke zum Broadway ist sogar eine kleine Bibliothek mit politischer Literatur aufgebaut.
Es herrscht Woodstock-Atmosphäre im Kleinen. Auf Gitarren und Banjos werden Protestlieder geschrummelt, überall finden sich spontane Diskussionsrunden zusammen. Die guten alten Organisationsformen der 60er-Jahre leben wieder auf: Sit-Ins, Teach-Ins, Be-Ins. Doch am Rand des Parks lässt die Polizei mit ihrer ständigen Präsenz und ihren Überwachungskameras nie vergessen, dass dem Treiben enge Grenzen gesteckt sind.
So wie am Samstag, als die Demonstranten versuchten, über die Brooklyn Bridge zu marschieren. Sie hatten keine offizielle Genehmigung, 700 der 1500 Marschierer wurden verhaftet. Darunter war auch Jonathan Gregano, der die Nacht in einem Untersuchungsgefängnis verbrachte, wie er mit einer Prise Galgenhumor erzählt. Eine Anklage gab es nicht.
Gregano ist ein typischer Wall-Street-Besetzer, wenn es so etwas denn gibt. Er hat 2008 Barack Obama gewählt, hat für ihn sogar Wahlkampf gemacht. Doch dann kamen die Enttäuschungen: Die Tatsache, dass weder das Gefangenenlager Guantanamo geschlossen noch der Irak-Krieg rasch beendet wurde; die immer offenkundigere Verstrickung auch der Regierung Obama mit der Finanzwelt der Wall Street; die grassierende Armut und wachsende soziale Ungerechtigkeit in Amerika; die Erkenntnis, dass sich auch unter Obama nichts grundlegend ändern wird. So kam schließlich das Gefühl, etwas tun zu müssen.
Was ihn konkret hierher führt, was er damit bewirken will, kann Gregano freilich nicht so genau sagen. „Klar, wir können uns alle darauf einigen, dass wir gegen die Gier der Finanzindustrie und die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit im Land sind“, sagt er. Ihm persönlich sei es jedoch eigentlich wichtiger, über den Afghanistan-Krieg zu sprechen, den er beendet sehen will. Doch dafür kann er bislang kaum Mitstreiter gewinnen.
Dass sie keine klare Agenda haben, ist der größte Kritikpunkt an den Protesten. Am Anfang hat man sich das im Zuccotti-Park auch zu Herzen genommen. Bei den ersten Sit-Ins wurde heftig über Ziele gestritten. Manche wollten die höhere Besteuerung der oberen Einkommen sowie bezahlbare Krankenversicherung für alle als Forderungen festschreiben. Andere fanden, man dürfe keine Ziele formulieren, weil man sonst im polarisierten öffentlichen Diskurs in den USA sofort wieder in eine Schublade gestopft werde.
Doch mittlerweile sind die Strategie-Debatten weitgehend verstummt. Man fühlt sich mit dem wohl, was man ist, ohne es genauer definieren zu müssen. „Ich glaube sogar, es ist eine Stärke, dass wir kein konkretes Programm haben“, sagt Jonathan Gregano. „Wir sind eine riesige Bandbreite an Leuten, die miteinander darüber reden, was nicht stimmt in diesem Land.“
Was die Bandbreite angeht, hat Gregano an diesem Oktobernachmittag eindeutig Recht. Die Karikatur, die Gegner der entstehenden Bewegung zeichnen, und nach der es sich mehrheitlich um Studenten und andere Vollzeitmeckerer handelt, die genug Zeit haben, sich auf der Straße herumzutreiben, ist schlicht nicht wahr.
So steht an einer Ecke des Zuccotti-Parks ein adrett gekleideter Mittdreißiger umringt von einer Gruppe und hält eine leidenschaftliche Rede über die Ursachen der Immobilienkrise. „Ich weiß wovon ich rede, weil ich zu dem einen Prozent der Privilegierten gehöre“, schreit er. Um sich als Angehöriger der profitierenden Klasse auszuweisen hält er sein iPhone mit einem Foto seines Ferraris in die Luft. Dann ergeht er sich in einer Tirade über die Schamlosigkeit, mit der die Banken faule Kredite vergeben und wie sie das Risiko in den berüchtigten Derivaten weitergegeben hätten; eine Tirade darüber, wie Finanzminister Geithner „die Schuldigen rausgehauen hat aber nicht die, die am meisten gelitten haben“; und dass niemand die Banken zur Verantwortung ziehe.
Neben ihm steht ein älterer Schwarzer im Blaumann und stimmt ihm zu. „Wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft“, sagt der Mann, der Hausmeister ist und eindeutig zu den unteren 99 Prozent gehört, welche die Demonstranten hier zu repräsentieren behaupten. „Für manche gelten andere Regeln als für den Rest von uns.“
Gegenüber dem Eingang zur Hausnummer eins Liberty Plaza, einem pechschwarzen Wolkenkratzer am Rand des Zuccotti-Parks, der die Nasdaq-Börse und das Bankhaus Goldman Sachs beherbergt, hat sich unterdessen eine dichte Traube gebildet. Der Filmemacher Michael Moore ist vorbeigekommen, um seine Solidarität kundzutun. Für Moore sind Ziele und Stoßrichtung der Proteste klar. „Das hier ist das Volk, dem allzu lange die Macht, die ihm gebührt, verwehrt wurde“, predigt er in die TV-Kameras. „Die Leute haben endgültig genug und nun stehen sie auf.“ Bald, so prophezeit Moore, werde sich ihr Zorn über das ganze Land ausbreiten. Für einen Moment liegt Revolution in der Luft am Zuccotti Place. Dann entschwindet Moore am Broadway in einem Taxi.
Jonathan Gregano hat sein Gummibärchen-Nudel-Gemisch aufgegessen und lehnt an einem improvisierten Stand, an dem ein Psychologe kostenfrei Demonstranten Hilfe anbietet, um ihre Motivation und ihre Rolle bei den Protesten für sich zu klären. Gregano braucht solche Hilfe nicht, schon gar nicht jetzt, nachdem er Michael Moore gesehen hat. „Ich bleibe so lange es sein muss“, sagt er voller Entschlossenheit. Und wie lange ist das? Gregano zuckt mit den Schultern, er weiß es nicht. Aber wenn es so weit ist, da ist er sich sicher, wird er es schon merken.