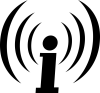Rassistische Gewalt im kollektiven Gedächtnis von Migrant*innen türkischer Herkunft
Im Roman »Chronik eines angekündigten Todes« des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García Márquez ermorden zwei Brüder den jungen Santiago Nasar in aller Öffentlichkeit. Außer Nasar wissen alle Einwohner*innen des Dorfes Stunden vorher über den Racheplan der Brüder Bescheid, versuchen aber nicht, das Verbrechen zu verhindern. Das Raster des Ressentiments macht den jungen Nasar zum Sündenbock für die ihm vorgeworfene »amoralische« Tat: unehelicher Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau. Die Dorfmitglieder haben Verständnis für seine Mörder und deren Straftat. Eine vergleichbare Empathie mit dem Opfer und seiner Familie fehlt. Implizit wird im Roman die angebliche moralische Unschuld der Dorfgemeinschaft zur Disposition gestellt, da sie eine kollektive Verantwortung für Nasars Tod trägt. Die Brüder scheinen einem kollektiven Wunsch gehorcht zu haben.
Chronik rassistischen Terrors
Als wir über die NSU-Morde und türkische Migrant*innen nachdachten, haben uns die Parallelen zwischen dem Schicksal Nasars und dem Schicksal der vom NSU Getöteten erschüttert. Der rassistische Terror des NSU hinterließ eine verhängnisvolle Zerstörung: bei den Familien, aber auch an einer pluralen, demokratischen Gesellschaft. Die Gewalttaten wiederholen sich musterhaft: Menschen sterben »angekündigt« in aller Öffentlichkeit, ein paar Individuen werden später als Täter festgenommen, die Gesellschaft wäscht sich rein, die Politik fühlt sich erleichtert. Die Hinterbliebenen werden mit den Folgen des Verlustes alleine gelassen.
In unseren Gesprächen mit türkeistämmigen Migrant*innen über den NSU sind wir häufig mit einer Darstellung konfrontiert, die auf eine historische Kontinuität verweist: »Wir haben Solingen, Mölln erlebt; wir haben brennende Häuser und Flüchtlingsheime gesehen; wir haben viel Rassismus erlebt, auf der Straße, am Arbeitsplatz; ebenso unsere Kinder in den Schulen.« Die türkischen »Gastarbeiter*innen« nannten Deutschland die »bittere Heimat«. Entsetzlich ist das: sich selbst als dem Terror ausgeliefert zu begreifen, nicht mehr Sicherheit und Schutz genießen zu können. Meltem Kulaçatan verweist darauf, dass diese traumatischen Ereignisse einen wichtigen Teil des kollektiven Bewusstseins türkeistämmiger Migrant*innen konstituieren.
Es ist daher unabdingbar, die politische Situation und den gesellschaftlichen Umgang mit dem NSU-Komplex mit den rassistischen Brandanschlägen von Solingen, Mölln und Rostock-Lichtenhagen in den 1990er Jahren zu vergleichen. Eine spezifische gesellschaftliche Atmosphäre, in der das Leben der Geflüchteten, der Migrant*innen nicht als wertvoll und schützenswert gilt, lässt sich als gemeinsamer Nenner der beiden Epochen ausmachen.
In ihrer Verletzlichkeit werden die verachteten, entrechteten und fremdgemachten Migrant*innen gegenüber dem überwältigenden Hass und der Verachtung alleine gelassen und aus der gesellschaftlichen Solidarität und Empathie ausgegliedert. Die Geschichte dieser Ausgegrenzten findet keinen Platz im Selbstbild des Erinnerungsweltmeisters Deutschland. Die Frage, was erinnert wird, hängt wesentlich von der Wirkmächtigkeit des »Gedächtnisregimes« ab, welches die kollektive Erinnerungskultur durch die Macht staatlicher Akteure reglementiert.
Die 1960er und 1970er Jahre waren die Ära der kollektiven Aktion der organisierten Arbeiterschaft. Viele Arbeitsmigrant*innen beteiligten sich an Mobilisierungen zum Arbeitskampf, als die westeuropäischen Staaten im Zenit ihrer Industrialisierung standen. Doch diese Teilinklusion hatte signifikante Begleiterscheinungen: Assimilation, Paternalismus und Instrumentalisierung. Die Diskriminierung der »Gastarbeiter*innen« war selbst in den Gewerkschaften weit verbreitet. Die wilden Streiks der 1970er Jahre in den Fabriken und die sozialen Kämpfe um besseren Wohnraum in den Städten der 1980er Jahre, an denen Migrant*innen sehr stark beteiligt waren, zeichneten sich in dieser Periode als dominante Formen einer antirassistischen Praxis aus. Diese Kämpfe zielten wohlgemerkt nicht nur auf die gerechtere Umverteilung materieller Ressourcen, sondern auch auf die egalitäre Produktion der Sozialität.
Strukturwandel in den 80er Jahren
Die 1980er Jahre markierten einen Strukturwandel: zunehmende Arbeitslosigkeit und Armut insbesondere unter Arbeitsmigrant*innen. Zugleich zeigten die Statistiken die ersten tödlichen Fälle rassistischer Gewalt. Die einstigen Gastarbeiter*innen türkischer Herkunft wurden nun für »überflüssig« erklärt.
Im Jahr 1981 war der 45-jährige Seydi Battal Koparan das »erste« Opfer eines rassistisch motivierten Mordes mit türkischer Herkunft. Der erste dokumentierte Brandanschlag auf ein Mehrfamilienhaus erfolgte in Schwandorf 1988 auf ein Haus, in dem überwiegend türkische Migrant*innen wohnten. Leyla Kellecioğlu verlor ihre Familie sowie einen deutschen Nachbarn. Ein offizielles Gedenken ließ bis 2009 auf sich warten.
Anfang der 1980er Jahre machten Neonazis bundesweit Jagd auf türkische Migrant*innen. Im Jahr 1985 wurden innerhalb von fünf Monaten wiederum in Hamburg Mehmet Kaymakçı und Ramazan Avcı totgeschlagen. »Wir wollten den Türken fertigmachen«, erklärte einer der Täter später seine Motivation. Das war der Anfang einer Reihe weiterer rassistischer Angriffe auf Migrant*innen.
Die Straftaten beschäftigten die deutsche Öffentlichkeit auch aufgrund zivilgesellschaftlicher Proteste vor allem von türkeistämmigen Migrant*innen. Im Januar 1986 fand in Hamburg eine große Trauer-Demonstration mit 15 000 Teilnehmer*innen statt. Der tödliche Rassismus und die fehlende Reaktion in den Medien und von politischen Verantwortlichen empörte Migrant*innen türkischer Herkunft, die ihre Trauer und Wut auf die Straße trugen. In diesem Zusammenhang wurden auch Forderungen nach gleichen Rechten, nach Bleiberecht, dem Wahlrecht und dem Recht auf eine doppelte Staatsbürgerschaft gestellt. Auf vielen Plakaten waren Parolen zu sehen wie: »Wir wollen Bleiberecht«, »Nieder mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit«, »Wir sind im Recht, wir sind stark«, »Wir wollen gleiche Rechte«.
Viele Migrant*innen hatten im Vergleich zum Mainstream, aber auch zu radikalen Kreisen einen scharfen Blick auf das Problem des Rassismus und artikulierten das in der Öffentlichkeit. Sie hatten eine Stimme, sie konnten sprechen, wurden aber nicht gehört. Sicherlich wurde mit dem Protest das empathische Einfühlungsvermögen der Gesellschaft adressiert. Die Forderungen auf den Plakaten gingen allerdings über die Suche nach Toleranz hinaus und bestimmten legale und politische Rechte als Voraussetzung von Gleichheit. Und Gleichheit erfordert institutionelle Garantien, um dauerhaft zu sein.
Migrant*innen, auch italienische und jugoslawische etc., machten andere Erfahrungen als der mehrheitsdeutsche Mainstream. Sie wurden gezielt als »Ausländer« angegriffen. Viele trauten sich nicht mehr auf bestimmte öffentliche Plätze. Für viele markierte die Tat eine Zeitenwende, die direkte Auswirkungen auf die Organisation ihres Alltags hatte. In Hamburg schlossen sich mehrere Verbände zusammen und forderten eine Änderung der Einwanderungspolitik.
Zur Selbstverteidigung und als Ausdruck kollektiver Bewältigungsstrategie formierten viele migrantische Jugendliche in den 1980er Jahren Jugendbanden, lernten Kampfsport und patrouillierten in »ihren eigenen Stadtteilen«. Das Versagen der Polizei, rassistische Angriffe zu bekämpfen, goss Öl ins Feuer. Die mediale Darstellung der (eher multikulturellen) Streetgangs als gewalttätige Jugendkriminalität der Ausländer*innen vor dem Hintergrund ihrer sensationstauglichen Auftritte in öffentlichen Räumen, Parks, Straßen, Nachbarschaften etc. verklärte die politischen Zusammenhänge der Exklusion und Inklusion. Die sozialen Ansprüche der marginalisierten und frustrierten Jugendlichen auf gesellschaftliche Teilhabe wurden auf ihre destruktive Gewalt und Männlichkeit reduziert und aus ihrem kulturellen Kontext gerissen. Die rechte Gewalt erschien so nicht als Ursache, sondern als eine bloße Reaktion.
1990er Jahre
Ende der 1980er Jahre nahm der rassistische Terror enorm zu, nicht nur die Todesfälle, sondern auch ein allgemeiner Alltagsrassismus stiegen an. Die Popularität der Partei Die Republikaner zeigte, dass Rassismus zunehmend salonfähig wurde. Die Volksparteien bedienten sich unbekümmert der bis dahin als rechtsextrem geltenden Ideen und Parolen. Mit dem Mauerfall war schließlich jeder Maßstab verloren gegangen. Die Wiedervereinigung ließ dem völkischen Wahn freien Lauf.
Die beiden Anschläge in Mölln (1992) und in Solingen (1993) fanden in einer Pogromstimmung statt, die durch Politik und Medien zu einer biopolitischen Dramatik des Schicksals des Kollektivs überspitzt wurde: Entweder wird das Asylrecht abgeschafft, oder Deutschland geht zugrunde. Als Notwehr, als Widerstand erscheint so die eigene Aggression. Drei Tage nach der de facto Abschaffung des Asylrechtes erfolgte der Anschlag von Solingen mit fünf Toten und zahlreichen Schwerverletzten.
Die Bundesregierung unter Kohl war die politische Instanz, die mit allen möglichen Mitteln, z. B. einer Rückkehrprämie, der Abschaffung des Asylrechts etc. gegen die Migration kämpfte. Die Neonazis fühlten sich dadurch als zur Arbeit gerufene Patrioten. Sie führten diese nationale Mission mit Vergnügen aus, taten das, was die Politik sich nicht trauen konnte zu tun: Eine Säuberung des Landes von »Ausländern«. Das Ausbleiben einer rechtsstaatlichen Verurteilung des rechten Terrors ermutigte die potenziellen Täter.
Solingen stellte den Höhepunkt der rassistischen Anschläge auf Migrant*innen türkischer Herkunft dar. Hatice Genç, die beim Solinger Brandanschlag ihre nur neun- und fünfjährigen Töchter Hülya und Saime verlor, kritisierte unmittelbar nach dem Brandanschlag die Politik: »Sie - die Neonazis - fühlen sich stark wegen Kohl und greifen weiterhin Menschen an.« Ohne Zweifel bleiben die Brandanschläge von Mölln und Solingen zentral im kollektiven Gedächtnis der türkischen Migrant*innen. Wenn seither bei Anschlägen auf von Migrant*innen bewohnte Häuser Ermittler*innen bei der Untersuchung von Brandursachen ein rassistisches Tatmotiv nicht erkennen und die Fälle unaufgeklärt bleiben, beunruhigt das Migrant*innen türkischer Herkunft.
Von Solingen zum NSU
Die Verbrechen des NSU, denen acht türkeistämmige und ein griechischer Migrant sowie eine deutsche Polizistin zum Opfer fielen, wurden bei den türkeistämmigen Migrant*innen ein »zweites Solingen« genannt. Hinterbliebene, die ihre Angehörigen durch Rassismus verloren haben, gehen damit sehr unterschiedlich um. Abdulkerim Şimşek, der Sohn des ermordeten Enver Şimşek, sagt beispielsweise: »Ohne meine Religion wäre ich nach allem, was passiert ist, in tiefen Hass versunken.« Seine Schwester Semiya Şimşek verließ das Land, in dem sie aufgewachsen war und das sie einstmals als ihre Heimat beschrieben hatte. Sie lebt inzwischen in der Türkei. Jedoch muss man ihren Weg nicht als ein bloßes »Exit« betrachten, im Sinne von Albert Hirschmans Erklärung der Reaktionsmöglichkeiten auf unakzeptable Situationen. Bevor sie wegging, hat Şimşek ein Buch geschrieben. Sie klagt darin nicht nur die Strafverfolgungsbehörden an, sondern auch die Medien und die Gesellschaft.
Andere Hinterbliebene tragen ihren Kampf auf eine differente Art in die Öffentlichkeit. Nach dem Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel und dem Mord an Mehmet Kubaşık am 4. April 2006 in Dortmund organisierten Familienangehörige und Betroffene in Kassel und Dortmund zwei Demonstrationen unter dem Motto: »Kein 10. Opfer!« Die Erfahrungen mit dem tödlichen Rassismus und der Pogromstimmung im Alltag beeinflussten zunehmend die Denkweisen der Migrant*innen. Aufgrund ihrer Erfahrungen vermuteten die Betroffenen, dass hinter den Morden Rassismus als Motiv stecken könnte. »Ich kenne meine Feinde«, sagt Mehmet Demircan, ein Freund von Familie Yozgat und Anmelder der Demonstration. Die Demonstrant*innen riefen zur Aufklärung der Morde an ihren Ehemännern, Lebensgefährten, Vätern, Söhnen, Brüdern, Verwandten und Freunden auf. Sie baten, ja flehten um Aufklärung, damit es kein weiteres Opfer gäbe.
Der entschlossene Auftritt der Familienangehörigen und deren Unterstützer*innen und ihr Kampf um Gerechtigkeit zielten nicht nur darauf, die Familien zu rehabilitieren, indem das Verbrechen aufgeklärt wird, mit allen möglichen personellen und institutionellen Verstrickungen. Es müssen nicht nur die Verbrecher bestraft werden, sondern es müssen auch institutionelle Reformen durchgeführt werden. Familie Yozgat stellt die Forderung nach der Umbenennung der Straße, in der Halit Yozgat geboren und ermordet wurde, in Halit-Straße. Dies zielt darauf, dass die Opfer rassistischer Verbrechen nicht in die Vergessenheit geraten.