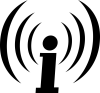Erst zog die AfD in den Landtag, dann die Pegida durch die Altstadt: Das Anti-Islam-Bündnis hat Dresden verändert - und in eine Identitätskrise gestürzt. Wie soll es weitergehen?
Scharf rechts biegt der kleine Protestzug in Richtung Altmarkt ab, dann bricht die Menge ihr minutenlanges Schweigen. "Merkel muss weg", grölt es nun aus Hunderten Kehlen. "Merkel muss weg", elfmal hintereinander. Am Straßenrand knipsen Touristen Erinnerungsfotos, an den Tischen der bürgerlichen Cafés drehen sich ein paar Gäste um - aber nur kurz, das Gegröle kennen sie zur Genüge.
Es ist Montag in Dresden, Pegida-Tag.
In der Mitte des Altmarkts versammeln sich die Demonstranten um einen zur Bühne umfunktionierten Lastwagen, auf dem neben Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann der Blogger Michael Stürzenberger steht. Der 48-Jährige beschwört in seiner kaum 15-minütigen Rede die globale Terrorgefahr und attestiert Finanzminister Wolfgang Schäuble "geistige Toleranzbesoffenheit".
Nach Stürzenberger sprechen noch zwei weitere Pegidisten, bevor direkt im Anschluss eine AfD-Kundgebung beginnt. Das Publikum bleibt dasselbe, die Demonstranten schwenken Fahnen der "Identitären Bewegung" und des deutschen Kaiserreichs, statt zu klatschen brüllen sie Beifall: "Widerstand, Widerstand, Widerstand!"
Im Oktober 2014, kurz nach der Landtagswahl in Sachsen, ging Pegida erstmals auf die Straße - und schon drei Monate später, nachdem sich in der ganzen Republik Mini-Ableger mit Namen wie "Bärgida" oder "Thügida" gegründet hatten, versammelten sich laut Polizei 25.000 Anhänger in der Dresdner Altstadt.
So groß ist Pegida schon lange nicht mehr, aber verschwunden ist die Gruppierung nicht. 115 Demonstrationen gab es bislang, zu jeder Jahreszeit. Der ritualisierte Protest gegen Islam, Politik und Medien ist ein Dresdner Markenzeichen geworden. Was macht das mit dieser Stadt?
Im Gespräch mit Politikern und Flüchtlingshelfern, mit Geistlichen, Kulturschaffenden und Fußballfans entsteht das Bild einer mit sich ringenden Stadt - einer Stadt, die aus der Sicht vieler Beobachter und Beteiligter eine Opferrolle einnimmt. Für manche ist Dresden ein Opfer unfairer Berichterstattung und politischer Vernachlässigung, für andere leidet die Landeshauptstadt unter den im Umland lebenden Rechtsextremisten und den Pegida-Sympathisanten in ganz Sachsen.
Vor einem Kiosk in der Dresdner Neustadt steht ein drahtiger Typ mit graumeliertem Wuschelhaar. Axel Steier steckt sich eine Zigarette nach der anderen an - und erzählt: wie er schon in den Neunzigern gegen Neonazis demonstrierte, wie er vor einem Jahr die Rettungsorganisation Mission Lifeline gründete, wie er gegen Lutz Bachmann vor Gericht zog, weil der die Hilfsinitiative als Schlepperorganisation verunglimpft hatte.
"Dresden", seufzt Steier, "ist ein piefiges Provinznest, eine total braune Stadt." Schon kurz nach der Wende, er war gerade 14, sei seine Mauerfall-Euphorie verschwunden - vor allem wegen des Rechtsextremismus, den kaum jemand bekämpft habe. Pegida hält er für das Ergebnis dieses Wegschauens. Anfangs sei er noch auf Gegendemos gegangen, sagt Steier, inzwischen konzentriere er sich auf die Flüchtlingshilfe: "Man erlebt ja lieber Solidarität und Dankbarkeit als Hass."
Heinrich Timmerevers sitzt im Obergeschoss des katholischen Bistumssekretariats, durchs Fenster kann der weißhaarige Niedersachse auf die Kuppel der Frauenkirche blicken. "Was wir Westdeutschen nicht sehen", sagt der Bischof: "Es gibt hier viele Verlierer der Einheit." Der Strukturwandel habe viele Sachsen hart getroffen, die Enttäuschung darüber sei wohl ein Grund für die Ausdauer von Pegida.
Mit Kritik an den Demonstrationen hat Timmerevers sich bislang zurückgehalten. Einerseits wohl, weil er erst im August ins Amt eingeführt wurde und Dresden noch nicht allzu gut kennt. Andererseits bangt er um den Zusammenhalt seiner ohnehin kleinen Gemeinden: Nur vier Prozent der Sachsen sind katholisch, in etlichen Pfarreien gibt es Pegida-Sympathisanten, ein gewaltiges Konfliktpotenzial. "Wir müssen miteinander reden, reden, reden", sagt der Bischof. Darüber hinaus könne die Kirche nur wenig bewegen: "Wir sind ziemlich machtlos."
"Dieses Gefühl kann ich gut nachvollziehen", sagt ein anderer Geistlicher: Sebastian Feydt lehnt an einem massiven Kalksteinaltar im Untergeschoss der Frauenkirche. Auch er tue sich schwer mit Pegida, sagt der 52-Jährige, der seit zehn Jahren Pfarrer des symbolträchtigen Gotteshauses ist. Gerade in dieser Symboltracht sieht Feydt ein großes Problem: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke etwa habe die wiederaufgebaute Kirche in seiner berüchtigten Holocaust-Rede als Ausdruck "deutschen Selbstbehauptungswillens" beschrieben.
"Das steht im totalen Widerspruch zu dem, wofür die Frauenkirche wiederaufgebaut wurde", sagt Feydt. Er nennt sie "ein Mahnmal gegen Krieg", "einen Ort der Auseinandersetzung", "ein Zeichen für Toleranz und Frieden". Warum so viele Sachsen lieber in patriotischer Verklärung versinken? "Es gibt hier ein großes Selbstbewusstsein", sagt Feydt. "Also größer geht's eigentlich nicht."
Feydt will dieses Selbstbewusstsein in etwas Positives verwandeln. Mit Gottesdiensten und Vorträgen, Gegendemos und sozialen Projekten. Um alle Dresdner am Dialog zu beteiligen, bräuchte die Stadt aber auch einen runden Tisch der Kneipiers, sagt er. "Die Frage ist ja: Worüber und wie reden die Leute im Feierabend?"
In einem Flachbungalow am Straßburger Platz ist an diesem Abend Pegida das Thema. "Acki's Sportsbar" ist der vielleicht wichtigste Treffpunkt von Dynamo-Dresden-Fans - von denen offenkundig viele enge Verbindungen zu der Protestbewegung pflegen. Kneipier René Ackermann, Spitzname Acki, sitzt mit ein paar Stammgästen im Biergarten und schüttelt den Kopf. "Bei uns in Dresden ist jeder willkommen", sagt er. "Aber an uns hängt jetzt dieser miese Ruf, dass es hier nur Nazis gibt. Blödsinn."
Die Stadt, sagt er, sei ein Opfer ihres schlechten Images. Ackis Sitznachbarn nicken.
Paul: "Pegida, das sind ja nicht nur Rechtsradikale."
André: "Genau, das sind auch Familienväter, normale Leute halt."
Paul: "Die wollen nur auf was aufmerksam machen."
André: "Ja, weil nun mal manches schiefläuft."
Dann erzählt Paul, wie er anfangs mitdemonstriert habe, sich inzwischen aber nicht mehr traue. "Man wird ja sofort als Nazi abgestempelt", sagt er. Viele hätten Angst, wegen einer Demo ihren Job zu verlieren und blieben daher montagabends zu Hause. André nickt energisch, Paul sagt: "Da gehen nur noch Rentner hin, weil die nichts mehr zu verlieren haben."
Viele Dresdner fühlen sich unfair behandelt - vor allem von Politikern, Journalisten, Geistlichen. Das Selbstbewusstsein kollidiert offenbar mit dem Frust über Strukturwandel, sozialen Abstieg und Globalisierungseffekte. In Einzelfällen mag der Unmut berechtigt sein, beunruhigend hingegen ist eine erschreckend populäre These: Wegen der verheerenden Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg sei Dresden selbst gewissermaßen ein Opfer der eigenen Geschichte.
Wie schwierig es ist, diesen Mythos zu durchbrechen, weiß auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Auf einer Gedenkfeier im Februar hatte der FDP-Politiker im Februar gesagt, dass in der Nazi-Zeit auch in Dresden "Täter am Werke waren". Er erhielt daraufhin Morddrohungen und wüste Beschimpfungen - nicht zum ersten Mal.
Hilbert bemüht sich zwar, gegenüber Pegida entschlossen aufzutreten. Aber das Problem lässt sich gar nicht in Dresden allein lösen. Ein Großteil der Demonstranten reist aus der ganzen Region an - auch aus Orten, die mit rechten Übergriffen in Verruf gerieten: Freital, Bautzen, Arnsdorf, Heidenau. In dieser Hinsicht ist Dresden also wohl tatsächlich ein Opfer seines eigenen Umlands.
Warum sind Frust und Fremdenhass in Ostsachsen so groß? Studien haben das Phänomen untersucht, Parlamente und Ausschüsse das Thema diskutiert, herausgekommen ist eine Gemengelage verschiedener Faktoren.
- "Für mich ist Pegida eine Sammlungsbewegung der Unzufriedenen", sagt Valentin Lippmann, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag. Das Problem seien weniger die Hunderten Demonstranten als die Millionen Sympathisanten.
- "Die Flüchtlingskrise wirkte wie ein Brandbeschleuniger", sagt Stadtsprecher Kai Schulz. Dabei sei die angebliche "Islamisierung des christlichen Abendlands" nur vorgeschoben: "Da spricht christliche Nächstenliebe nur eine untergeordnete Rolle."
- Der schwer zu greifende Protest im Internet sei ein Problem, sagt Markus Blocher, der Chef des Bürgermeisteramts. "Wir müssen erst mal lernen, damit umzugehen."
- "In Sachsen sind viele Kümmer-Strukturen weggebrochen", sagt Christian Demuth, Berater der SPD-Fraktion. Der Abbau sozialer Einrichtungen habe den Frust vor allem im ländlichen Raum befördert.
- In der DDR habe die SED den Dresdner Opfermythos zementiert, sagt Linken-Landeschef Rico Gebhardt. Anschließend habe die CDU unter Ministerpräsident Kurt Biedenkopf einen "Sachsen-Chauvinismus" etabliert.
Ministerpräsident Stanislaw Tillich beschreibt Pegida als diffuse Protestbewegung einer kleinen Minderheit: "Da ging's mal um Griechenland, mal um die Rundfunkgebühren, mal um Russlandsanktionen", sagt der CDU-Politiker.
Ein zentraler Grund für die Unzufriedenheit sei die Schrumpfung des Politik- und Geschichtsunterrichts nach dem Mauerfall gewesen. "Das war ein Fehler", räumt Tillich ein. "Die Bürger wissen heute gar nicht mehr, wie demokratische Prozesse zustandekommen." Er wolle nun alles tun, um schnellstmöglich "ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, in dem sich jeder verantwortlich fühlt".
Das ist bitter nötig. Zwar scheint die Zeit der Massenproteste vorbei, aber noch immer ziehen regelmäßig zwischen 1200 und 2500 Wutbürger durch Dresden. Die Bewerberzahlen an den Hochschulen sind zurückgegangen, die Touristenzahlen zwischenzeitlich abgesackt, die ganze Region weltweit vor allem wegen Pegida bekannt.
Was kann man da noch machen?
Eine ganze Menge, findet Susanne Springer. Die 53-Jährige ist Marketingchefin bei der Semperoper - und beschäftigt sich mit Pegida, seit im Herbst 2014 erstmals eine der Demos direkt auf dem Theaterplatz endete. "Tja, das war sehr frustrierend für uns", sagt sie und rollt mit den Augen. "Plötzlich so viele Menschen direkt vor dem Haus zu haben, die zu keinem Dialog oder einer vernünftigen Auseinandersetzung bereit waren." Springer und ihre Kollegen haben es trotzdem versucht - mit einer Reihe sozialer und kultureller Projekte.
Seitdem habe sich ein Netzwerk aus Institutionen und Engagierten in ganz Dresden entwickelt, sagt Springer. "Den harten Kern der Pegida-Mitläufer werden wir damit nicht erreichen", räumt sie ein. "Aber zumindest wecken wir vielleicht eine neue Gesprächskultur in der Stadt."
Damit wäre schon viel gewonnen.