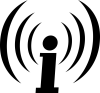Berlin - Eine von der Ostbeauftragten der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), in Auftrag gegebene Studie über Rechtsextremismus in Ostdeutschland kommt zu dem Ergebnis, dass die neuen Länder aufgrund zweier aufeinander folgender Diktaturen, der Homogenität der DDR-Gesellschaft und der Transformation nach 1989 in besonderer Weise dafür anfällig sind, warnt aber vor einem Generalverdacht.
Die Autoren des Göttinger Instituts für Demokratieforschung schreiben: „Es wäre verfehlt, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und fremdenfeindliche Übergriffe als ein primär ostdeutsches oder gar vor allem sächsisches Problem zu verorten.“ Vielmehr zeige die Untersuchung, „dass es neben spezifisch ostdeutschen Ursachen auch bedeutsame regionale Spezifika zu beachten gilt, die erst in der Summe ein Klima schaffen, in dem Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit gedeihen können“.
Zwei Regionen herausgegriffen
Die Forscher haben keine flächendeckende empirische Untersuchung gemacht, sondern zwei Regionen heraus gegriffen, die durch asylfeindliche Proteste aufgefallen waren: die Region Dresden mit den Städten Freital und Heidenau sowie Erfurt mit dem Stadtteil Herrenberg. Dort führten sie 2016 knapp vierzig Einzelinterviews mit Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft.
Zwar betonen die Forscher, dass es „eine deutliche Ost-West-Divergenz hinsichtlich der Neigung zur Fremdenfeindlichkeit“ gebe. „Die Sozialisation in einer buchstäblich geschlossenen Gesellschaft wie der DDR kann als ein Faktor für die Erklärung nicht stark genug betont werden: Ethnozentrische Weltbilder, die von der modernen extremen Rechten vertreten werden, sind auch deshalb vor allem bei den älteren Befragten weit verbreitet, weil die Migrationspolitik der DDR auf genau solchen ethnozentrischen Prinzipien basierte: Völkerfreundschaft ja, aber alle Migrantinnen sind als Gäste zu betrachten.“ Hinzu kämen die erlebte Vereinzelung nach 1989 und die aus der DDR ererbten überzogenen Erwartungen an den Staat. „Die Überhöhung des Eigenen, Sächsischen, Ostdeutschen, Deutschen in Bezug auf die krisenhaft wahrgenommene Aufnahme von Flüchtenden, aber auch auf Migrantinnen im Allgemeinen, hat in all unseren Fokusgruppeninterviews eine wichtige Rolle gespielt“, heißt es.
Nicht nur ein Ost-West-Problem
Trotzdem sei Rechtsextremismus „nicht ausschließlich ein Ost-West-Problem, sondern auch ein Zentrum-Peripherie-Problem, das befördert werden kann durch spezifische regionale Faktoren, die in Ostdeutschland stärker ausgeprägt sind“. So hätten strukturschwache ehemalige Industriestädte wie Freital und Heidenau die Abwanderung qualifizierter Menschen mit besonderer Härte zu spüren bekommen.
Im Plattenbaugebiet Herrenberg hingegen ballten sich wegen der in kapitalistischen Gesellschaften üblichen Segregation die sozialen Probleme Erfurts. In Erfurt gebe es zwar starke bürgerliche Kräfte, die sich gegen den Rechtsextremismus wehrten. Freilich sei das Interesse an dem Stadtteil Herrenberg nicht sehr ausgeprägt. Die Autoren der Studie schreiben schließlich: „Unsere Befragten haben das Gefühl, dass die als überheblich wahrgenommenen Bewohner der alten Bundesländer sie noch immer geringschätzen; vor allem aber sind sie darüber verärgert, dass westdeutsche Journalisten und Politiker den Eindruck erwecken, Rechtsextremismus sei in den neuen Ländern weiter verbreitet als in den alten Bundesländern.“ Dies wirke sich negativ auf die Bereitschaft zur Auseinandersetzung aus. So wie die Göttinger Forscher vor einem Generalverdacht warnen, so warnen sie auch davor, der „Diagnose einer ostdeutschen Spezifität“ auszuweichen.