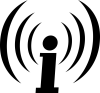- Deutsche Kriminalisten wollen DNA-Spuren am Tatort in größerem Umfang nutzen als bisher.
- Ein Gesetzentwurf zur erweiterten Erbgutanalyse sieht vor, dass "Feststellungen über das Geschlecht, die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter" künftig anhand von DNA-Proben getroffen werden sollen.
- Doch das Verfahren kann auch auf falsche Fährten führen. Einige körperliche Merkmale lassen sich zudem kaum aus dem Erbgut herauslesen.
Von Christina Berndt
Verbrecher-DNA am Tatort ist besser als jeder Augenzeuge, so klingt es beim ersten Hören. Unbestechlich scheint Erbgut verlässliche Aussagen über Täter zuzulassen. Während sich Zeugen oft widersprechen oder Erinnerungslücken haben, könnte DNA, die aus Blutspuren eines Verbrechers, seinem Sperma oder Geweberesten unter den Fingernägeln des Opfers gewonnen wird, einen klaren Blick auf den Täter bieten.
Deutsche Kriminalisten fordern denn auch seit langem, endlich wie ihre Kollegen in England, Wales und den Niederlanden DNA-Spuren am Tatort in größerem Umfang nutzen zu dürfen als bisher. Und wenn die DNA aus einem Haar tatsächlich bezeugt, dass der Täter männlich und etwa 20 bis 25 Jahre alt ist, schwarze Haare, braune Augen, einen dunklen Teint hat und aus Asien kommt, hätten Polizisten etwa nach der tödlichen Vergewaltigung der Studentin Maria in Freiburg da nicht den Täterkreis schnell eingrenzen können und wären nicht auf die Aufnahmen angewiesen gewesen, die sie zufällig von der Videoüberwachung einer Straßenbahn erhalten hätten.
Das Credo der Befürworter: Was technisch machbar ist, soll auch eingesetzt werden
? So einfach hört sich die Sache mit der DNA-Forensik an, wenn man den Gesetzesentwurf für eine erweiterte Erbgutanalyse zur Verbrechensbekämpfung liest, den Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) Anfang Februar unter dem Eindruck des Mords an Maria in den Bundesrat eingebracht hat. Am Dienstag fand dazu eine Anhörung von Experten im Bundesjustizministerium statt. Dem Gesetzesentwurf zufolge sollen aus Spuren künftig auch "Feststellungen über das Geschlecht, die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter" des Täters getroffen werden können, denn zu diesen ließen sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit verlässliche Aussagen" treffen.
Verfassungsrechtliche Bedenken hat das Justizministerium in Stuttgart dem Gesetzesentwurf zufolge nicht: Schließlich werde mit solchen Untersuchungen der geschützte Kernbereich der Persönlichkeit nicht berührt, betont Minister Wolf. Es handle sich nur um Merkmale, die auch jeder Augenzeuge erkennen könne.
Sein bayrischer Kollege Winfried Bausback (CSU) will noch weitergehen: Er möchte auch die "biogeographische Herkunft" eines Menschen aus der DNA herauslesen. Dabei muss man aber bedenken, dass diese Herkunft nichts mit der ethnischen Zugehörigkeit zu tun hat, wie der Direktor des Gerichtsmedizinischen Instituts an der Universität Innsbruck, Richard Scheithauer, betont: Manche DNA-Fragmente kommen in bestimmten Regionen häufiger vor, über das Aussehen des Täters sage das "absolut nichts" aus.
Das Credo der Befürworter lautet jedenfalls: Was technisch machbar ist, müsse auch in der Kriminalistik eingesetzt werden. Warum sollten Polizisten nicht wissen, was sich über den Täter sagen lässt? Viele Kriminaler unterstützen den Vorstoß denn auch: Derzeit müssten Ermittler noch "bildlich gesprochen mit der Fußfessel Verbrecher jagen", monierte zum Beispiel Freiburgs Polizeichef Bernhard Rotzinger kürzlich in einem Interview.
Doch die Anhörung im Justizministerium am Dienstag warf Zweifel auf: Ganz so einfach und unproblematisch, wie sich die DNA-gestützte Verbrecherfahndung zunächst anhört, ist sie nicht. Mehrere Fachleute wiesen auf ethische, soziale und juristische Risiken hin, "die jeden einzelnen Bürger treffen können". Eine zu schnelle und unbedachte Ausweitung der Technologie könne schwerwiegende Folgen haben, warnte die Wissenschaftsforscherin Veronika Lipphardt vom University College Freiburg. In einem Offenen Brief hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern um Lipphardt schon im Dezember auf die Gefahren einer erweiterten DNA-Forensik hingewiesen: "Die Anwendung von DNA-Technologien in der Ermittlungsarbeit ist weder einfach noch trivial", warnen sie darin.
Viele Körpermerkmale können aus dem Erbgut bislang nicht herausgelesen werden
Die Probleme beginnen schon damit, dass Eigenschaften wie Haar-, Haut- und Augenfarbe aus der DNA eben oft nicht gelesen werden können wie aus einem Buch. Auch wenn die Vorhersagewahrscheinlichkeiten hoch sind, bleibt viel Potenzial für Irrtümer. "Das hat vor allem Folgen für Minderheiten, die bei solchen Irrtümern überproportional oft ins Visier der Ermittler gelangen", warnt das interdisziplinäre Team um Lipphardt. Denn wenn eine Täter-DNA etwa auf einen hellhäutigen Täter hindeutet, kommt eine Fokussierung der Ermittlungen auf eine Tätergruppe eben kaum in Frage - dazu gibt es zu viele hellhäutige Personen in deutschen Orten. Der Hinweis auf eine dunkelhäutige Person aber kann eine Reihenuntersuchung unter diesen Menschen in Gang setzen: Sie ist angesichts der geringen Anzahl der Betroffenen praktikabel.
Bei genauem Hinsehen schmilzt zudem die Vorhersagekraft der DNA-Analysen zusammen, wie die Naturwissenschaftler in Lipphardts Gruppe herausfanden: In einem Dorf mit 1000 hellhäutigen Einwohnern und 20 dunkelhäutigen würde der Fund einer Täter-DNA, die auf eine dunkle Hautfarbe hindeutet, die 20 dunkelhäutigen Bewohner zu Verdächtigen machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die DNA richtig gelesen wurde, beträgt bei der Hautfarbe aber höchstens 98 Prozent. Somit bleiben zwei Prozent Fehlerquote; auch das entspricht bei rund 1000 hellhäutigen Einwohnern etwa der Zahl 20. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter tatsächlich dunkel pigmentierte Haut hat, bleibt trotz dunkel getesteter Tatort-DNA in einem solchen Dorf am Ende 50:50.
Im Fall Maria hätte die Ermittler sogar ein korrektes Ergebnis der Haaranalyse nicht weitergebracht, betonen die Forscher in ihrem offenen Brief. Es gebe schließlich viele schwarzhaarige Personen: Entscheidend sei vielmehr gewesen, dass das Haar am Ende blondiert war und dass der Täter eine ungewöhnliche Frisur hate. "Nur so konnten Videoaufnahmen und Haardaten zusammenwirken. DNA hätte diese Umstandsdaten niemals liefern können", so die Wissenschaftler.
Die Wattestäbchen waren mit dem Erbgut einer Mitarbeiterin kontaminiert
Wie sehr DNA-Daten Ermittler in die Irre führen können, zeigt der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn im Jahr 2007, zu dem die Kulturanthropologin Anna Lipphardt von der Universität Freiburg seit mehreren Jahren forscht. Dort suchte die Polizei "im Zigeuner-Milieu" nach einer Täterin, wie es Kripo-Beamte immer wieder ausdrückten, und fand am Ende deutsche Neonazis. Die gesuchte Täterin, so dachte man lange, hatte nicht nur die Polizistin ermordet, ihre DNA-Spuren fanden sich zudem an zahlreichen weiteren Tatorten im In- und Ausland. Österreichische Rechtsmediziner kamen nach einer biogeographischen Herkunftsanalyse der vermeintlichen Täter-DNA, wie sie der bayerische Justizminister fordert, zu dem Schluss, dass die Täterin wahrscheinlich aus Osteuropa stammt. Sie sei bestimmt "eine Angehörige einer Reisenden Familie", meinten die deutschen Fahnder. Dies erschien ihnen aufgrund der hohen Mobilität und der außergewöhnlichen Kriminalität der gesuchten Person plausibel.
Erst nach mehr als zwei Jahren stellte sich heraus, dass die DNA-Proben an den vielen Tatorten des "Heilbronner Phantoms" mit Wattestäbchen genommen wurden, die mit dem Erbgut einer polnischen Fabrikmitarbeiterin verunreinigt waren. Der Polizistinnenmord wird mittlerweile dem NSU zugeschrieben.
Bevor die DNA-Forensik ausgeweitet werde, betont Veronika Lipphardt daher, sei eine strenge Regulierung nötig. "Die wichtigste Frage ist nicht, ob es eine Ausweitung der Technologie geben soll", betont die Bioethikerin Barbara Prainsack vom King's College London, "sondern wie wir diese Ausweitung gestalten sollen." Die Institutionen, die diese Technologien anwenden, müssten gut geschult sein. Sie müssen wissen, dass DNA-Spuren immer nur Wahrscheinlichkeiten und keine Sicherheiten ergeben, und sie müssen selbstkritisch mit ihren Ermittlungsergebnissen und ihren Vorurteilen umgehen.