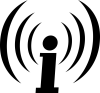Ein Mord an einer jungen Frau in Freiburg dient der Politik als Anlass, die erweiterte DNA-Analyse in der Polizeiarbeit zu fordern. Doch der Erfolg der Ermittler im Fall Maria kam mehr durch Zufall und Fleißarbeit zustande, als durch Erbgutspuren am Tatort.
Es gibt neuerdings mehr Polizisten in Freiburg, und in der Stadt finden das die allermeisten gut. Der spektakuläre Mordfall Maria hat Eindruck hinterlassen. Sogar unter seinen grünen Parteifreunden gebe es niemanden mehr, der die erhöhte Polizeipräsenz als eine Gefahr für die Freiheitsrechte betrachte, sagt Oberbürgermeister Dieter Salomon. Ähnliches berichtet auch Polizeipräsident Bernhard Rotzinger. Nachdem der mutmaßliche Täter gefunden war, erhielt Rotzinger viele Dankesmails. Und es war ja auch eine kriminalistische Meisterleistung, die sein Ermittlerteam vollbracht hatte.
Aus drei Säcken mit Material, das in einem Gestrüpp am Tatort eingesammelt worden war, holten die Beamten ein 18 Zentimeter langes Haar heraus, acht Zentimeter schwarz, zehn Zentimeter blondiert. Eine Polizeimeisterin entdeckte beim Studium von Videobändern aus der Tatnacht des 16. Oktober in einer Straßenbahn einen Mann mit der dazu passenden Frisur. Hussein K. wurde am 2. Dezember festgenommen; er soll die 19-jährige Studentin vergewaltigt und getötet haben.
Wird es der Polizei künftig leichter gemacht, anhand eines Haares Rückschlüsse auf den Täter zu gewinnen? Die Möglichkeit einer erweiterten DNA-Analyse propagiert nun die baden-württembergische Landesregierung. Der Fall Maria hat aber noch mehr grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Wie zuverlässig ist der Datenaustausch zwischen den europäischen Sicherheitsbehörden? Hussein K. hatte offenbar zuvor in Griechenland ein schweres Verbrechen begangen, ohne dass die deutschen Behörden davon wussten. Eine weitere Frage: Wie sicher können deutsche Behörden sein, dass Flüchtlinge, die sich als minderjährig ausgeben, auch wirklich minderjährig sind?
Der aus Afghanistan stammende Hussein K. hatte bei seiner Aufnahme im November 2015 angegeben, er sei 16 Jahre alt; das Jugendamt Freiburg bezweifelte dies in seinem psychosozialen Gutachten nicht. Zur Tatzeit wäre er also 17 gewesen. Seit dem Abgleich mit den Gerichtsdaten aus Griechenland gibt es aber erhebliche Zweifel. Ein Gutachten, das die Staatsanwaltschaft Freiburg erstellen ließ, kam zu dem Ergebnis: Der Mann ist mindestens 22 Jahre alt. Zur Altersbestimmung werden Röntgenaufnahmen des Kiefers, der Handwurzelknochen und der Schlüsselbeine erstellt. Wie verlässlich solche Untersuchungen sind, ist aber umstritten.
Die Staatsanwaltschaft wird das Verfahren zur Sicherheit wohl doch einer Jugendkammer vorlegen. Angeklagte zwischen 18 und 21 werden dort als "Heranwachsende" behandelt und können nach Jugend- oder Erwachsenenrecht verurteilt werden. Es gibt noch keinen Termin für den Prozess.