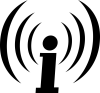Was nicht passt, wird passend gemacht: Wie Rechte einen Karlsruher Richterspruch für ihre Zwecke umdeuten wollen.
Olaf Klemke glaubt das Recht auf seiner Seite. Im Münchener NSU-Prozess hat der Anwalt, der den führenden Thüringer Neonazi Ralf Wohlleben vertritt, am Mittwoch für einen Eklat gesorgt. Von einem Sachverständigen will Klemke klären lassen, ob „das deutsche Volk in seiner bisherigen Identität im Jahre 2050 eine Minderheit gegenüber den Nichtdeutschen sein wird“, wenn die derzeitige demografische Entwicklung nicht gestoppt würde. Und ob man diese Entwicklung, wie es sein Mandant und seine Partei die NPD tun, als „Volkstod“ bezeichnen kann.
Aus Protest gegen diesen „Nazi-Jargon“ verließen die Vertreter der NSU-Opfer den Saal. „Volkstod“ ist ein Schlagwort der extremen Rechten, das für die Überzeugung steht, dass sich das deutsche Volk durch die Vermischung mit anderen Ethnien auflöst. Die Neue Rechte vertritt eine beinahe identische Auffassung, spricht jedoch vom „Großen Austausch“. Gegen diesen Prozess politisch vorzugehen, sei nicht nur legitim, argumentierte Olaf Klemke in seinem Antrag, sondern entspreche einer „verfassungsgemäßen Pflicht zur Identitätswahrung“. Diese sei vom Bundesverfassungsgericht 1987 festgestellt worden – einen mächtigeren Fürsprecher kann ein Anwalt nicht haben.
„Aus dem Wahrungsgebot folgt insbesondere die verfassungsrechtliche Pflicht, die Identität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten.“ Dieser Satz aus einer Entscheidung der Verfassungsrichter vom Oktober 1987 macht seit einiger Zeit auf rechten Internetseiten und in den sozialen Netzwerken die Runde. Auf dem islamophoben Hetz-Blog von Karl-Michael Merkle alias Michael Mannheimer ist er ebenso zu finden wie in Twitter- und Facebook-Auftritten der AfD. Im Interview der rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“ verwahrte sich sogar ein Vertreter der vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung unter Berufung auf dieses Urteil gegen den Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit – ähnlich wie es Klemke nun zugunsten seines Mandaten Wohlleben tut.
Sie alle gehen davon aus, dass mit „Identität des deutschen Staatsvolkes“ in erster Linie weitgehende ethnische Homogenität gemeint ist. Mit dem dauernden Verweis auf das Karlsruher Urteil zeigen sie aber vor allem eines: dass sie es nicht gelesen haben.
Im sogenannten Teso-Urteil von 1987 hatte das Verfassungsgericht darüber zu befinden, ob Marco Teso, geboren 1940 in Meißen, einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik hat. Teso war DDR-Bürger und hatte sich 1969 in den Westen abgesetzt. Jedoch hatte er die DDR-Staatsbürgerschaft nicht von Geburt an inne. Seine Mutter hatte im Dritten Reich nach damals geltendem Recht ihre deutsche Staatsbürgerschaft verloren, als sie seinen Vater, einen Italiener, heiratete. Die DDR erkannte Marko Teso dennoch als Staatsbürger an. Die Behörden der Bundesrepublik aber weigerten sich unter Verweis auf seine Herkunft.
Das Verfassungsgericht entschied zugunsten von Teso. Die Richter konstatierten tatsächlich ein Wahrungsgebot für die Identität des deutschen Staatsvolkes. Dieses sei jedoch „dynamisch“ auszulegen. Soll heißen: Die Richter gingen davon aus, dass sich die ethnische Zusammensetzung eines Staatsvolkes verändern kann, ohne dass es sich dadurch auflöst oder den „Volkstod“ erleidet. Das Urteil steht im Einklang mit der weitergehenden Rechtssprechung des Verfassungsgerichts, in der „Staatsvolk“ im Sinne des Grundgesetzes als die Gesamtheit der Staatsbürger definiert wird – unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft.
Was nicht passt, wird passend gemacht. Im neurechten Magazin Sezession löste ein Autor diesen Widerspruch kreativ, indem er eine ganze Urteilspassage über die Identität des deutschen Volkes „als ethnischer, kultureller und seelisch-geistiger Einheit“ hinzuerfand. Das Verfassungsgericht hat indes zuletzt vor wenigen Tagen klargestellt, dass das Teso-Urteil „die fehlende Ausschließlichkeit der ethnischen Herkunft für die Bestimmung der Zugehörigkeit zum deutschen Volk“ dokumentiert. Denn zuletzt hatte sich augerechnet die NPD im zweiten Verbotsverfahren darauf berufen – was Klemke als „Szene-Anwalt“ durchaus hätte wissen können.