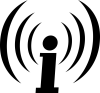Weder Hugo Chávez noch Nicolás Maduro hat die grundlegenden Strukturen der venezolanischen Gesellschaft angetastet. Das macht einen Politikwechsel der Linken nach ihrer jetzigen Wahlniederlage umso schwerer.
Von Raul Zelik
Die Linke Venezuelas hat bei der Parlamentswahl vom 6. Dezember eine schwere Schlappe erlitten, das Oppositionsbündnis MUD (Tisch der demokratischen Einheit) kam auf 56 Prozent der Stimmen und verfügt nun über eine Zweidrittelmehrheit in der Abgeordnetenkammer. Eine Erklärung dafür liegt auf den ersten Blick auf der Hand: Seit dem Absturz des Ölpreises ist die chavistische Sozialpolitik unbezahlbar geworden, und also haben sich auch die Armen von der Regierung unter Nicolás Maduro und des PSUV (Sozialistische Einheitspartei Venezuelas) abgewandt. Bei dieser Darstellung aber wird eine der wichtigsten Eigenschaften des Chavismus unterschlagen: Er hat sich durch seine Bereitschaft, sich globalen und einheimischen Eliten zu widersetzen, mächtige Gegner geschaffen.
Dass der Ölpreis seit 1999 stetig stieg, war auch der Aussenpolitik von Hugo Chávez geschuldet. Er hat die Opec-Staaten letztlich davon überzeugt, zu einem System von Förderquoten zurückzukehren und damit den Preis nach oben zu treiben. Auch innenpolitisch wurde der Reichtum hart erkämpft: Als der staatliche Ölkonzern PDVSA 2002 gezwungen wurde, seine Gewinne an den Staat abzutreten, reagierte die Rechte mit gleich zwei Putschversuchen.
Politik als Korruptionsanreiz
Doch warum hat jetzt eine so klare Mehrheit rechts gewählt? Die Krise war nicht mehr zu übersehen: Immobilien- und Devisenspekulation, rasende Inflation, leere Geschäfte. Die ökonomischen Probleme sind letztlich strukturell bedingt: Venezuela ist von Importen abhängig. Das ist insofern bemerkenswert, als sich der Chavismus schon Mitte der neunziger Jahre die Stärkung der einheimischen Produktion auf die Fahnen geschrieben hat. Zudem erscheint der Staatsapparat handlungsunfähig, obwohl Chávez und Maduro mit dem Poder Comunal, der Rätemacht, seit einigen Jahren den Aufbau neuer Staatsstrukturen vorangetrieben haben.
Unmittelbarer Auslöser der Krise waren die Massnahmen zur Preis- und Devisenkontrolle. Lohnerhöhungen und feste Beschäftigungsverhältnisse führten seit 2000 zu wachsendem Konsum auch der armen Bevölkerung. Damit die grossen Handelsketten die Lohnsteigerungen nicht durch Preiserhöhungen einbehielten, setzte die Regierung die Preise für Grundgüter fest. Zudem beschränkte man den Devisenhandel, um gegenüber der Finanzspekulation weniger angreifbar zu sein. Wer Güter importieren will, muss US-Dollars beim Staat beantragen. Devisen für Lebensmittel und Medikamente können dabei zu einem deutlich günstigeren Kurs gekauft werden.
Die Folge dieser Politik war nicht nur, dass die Staatsbürokratie nun Milliardenbeträge verwaltete und so enorme Anreize für korrupte Machenschaften schuf. Noch dramatischer war, dass dadurch das Horten und das Schmuggeln von Grundgütern extrem lukrativ wurden. Die Regierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf einen «Wirtschaftskrieg der Oligarchie» verwiesen, um das Versorgungschaos zu erklären. Die Rechte horte Waren, um die Unzufriedenheit zu schüren, hiess es. Doch noch viel fataler als politisch motivierte Sabotageversuche waren ökonomisch allzu menschliche Mechanismen: Der Liter Benzin kostet in Kolumbien dreissigmal so viel wie in Venezuela, und bei den Grundnahrungsmitteln verhält es sich dank subventionierter Wechselkurse ähnlich. Kein Wunder also, dass der Westen Venezuelas heute vom Schmuggel lebt und die subventionierten Grundprodukte mit riesigen Gewinnen in Kolumbien verkauft werden.
Basisbewegungen haben Präsident Maduro zuletzt oft seine Untätigkeit vorgeworfen. Doch eine Lösung solcher Probleme ist kompliziert. Der Schmuggel lässt sich nicht einfach unterbinden – Venezuela hat 4600 Kilometer kaum überwachte Grenze. Zudem sind Teile von Polizei und Militär tief in die Schattenökonomie verstrickt. Eine Freigabe von Preisen und Wechselkursen wiederum, die dem Schmuggel die Grundlage entzöge, würde eine Hyperinflation auslösen und vor allem die Ärmsten treffen. Verschärft wird die Situation dadurch, dass die chavistische Umverteilungspolitik den Konsumismus in der Gesellschaft weiter angefacht hat.
Eine andere Politik ist möglich
Doch es gibt keine Alternative zu unpopulären Massnahmen. Notwendig wäre eine radikale Währungs- und Preisreform, die der illegalen Ökonomie die Grundlage entzieht. Will man dabei eine Hungersnot vermeiden, muss sie durch die direkte Verteilung von Grundgütern an die Ärmsten begleitet werden. Darüber hinaus müsste die einheimische Produktion angekurbelt werden, vor allem in der Landwirtschaft.
Dass entsprechende Versuche in der Vergangenheit scheiterten, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass sie überstürzt waren, ohne wirklichen Plan, gesellschaftliche Debatte und reale Verankerung in der Bevölkerung. So warb Chávez 2005 beispielsweise in einer gross angelegten Kampagne für die Gründung von Genossenschaften. Innerhalb kürzester Zeit entstanden Zehntausende Kooperativen. Doch die Kampagne knüpfte nicht an die Erfahrungen der existierenden Genossenschaftsbewegung an, und so kam es, dass drei Jahre später nur noch einige Hundert der neuen Kooperativen übrig geblieben waren. Ganz ähnlich verlief die Einführung der Arbeiterselbstverwaltung in verstaatlichten Betrieben: Nur in wenigen Fällen ging der Prozess von den Belegschaften aus. Gewerkschafts- und Parteiapparate sicherten sich die Kontrolle der Selbstverwaltung, die eigentlichen Akteure blieben eher passiv.
Alter Staat in neuem Gewand
Resümiert man die Entwicklung der letzten siebzehn Jahre, muss man zum Schluss kommen, dass der Chavismus die grundlegenden Strukturen der venezolanischen Gesellschaft kaum angetastet hat. Gerade weil Chávez kein Despot war, sondern immer wieder die Unterstützung der Bevölkerung mobilisierte, konnte er das historische Erbe von hundert Jahren Ölreichtum nicht wirklich infrage stellen: die Plünderung von Rohstoffen für den Weltmarkt. Er brauchte das Geld aus den Ölverkäufen und hat damit gleichzeitig die parasitäre Aneignung der Ölrente über Korruption ermöglicht. Gesellschaftliche Alternativen und Transformationsstrategien wurden überraschend wenig debattiert. Die ökonomische Macht des Staats und der Führerkult um Chávez erwiesen sich als fataler Nährboden für politischen Opportunismus. Wer auf Widersprüche der Bolivarischen Revolution hinwies, galt sofort als Gegner. So wurden die zentralen Fragen erst gar nicht gestellt.
Wider den Opportunismus
Es ist zweifelhaft, ob jetzt noch eine Kehrtwende gelingen kann. Zwar haben trotz der katastrophalen Wirtschaftslage vierzig Prozent der WählerInnen für die Linke gestimmt. Doch darunter sind auch viele Staatsangestellte, die aus opportunistischem Kalkül schnell auf der Gegenseite stehen können. Letztlich hängt jetzt alles davon ab, ob die Basisbewegungen wieder aktiv werden. Es gibt eine lange Geschichte antineoliberaler Kämpfe und wichtige Erfahrungen der Selbstregierung von unten. So hat zum Beispiel die Bewegung Campamentos de Pioneros ganze Stadtteile in Eigenregie errichtet; der Staat stellte nur die Materialien zur Verfügung. Ein Teil der Nachbarschaftsräte hat trotz ihrer Verquickung mit dem Staatsapparat ein demokratisches Eigenleben entwickelt.
Das Problem ist jedoch: Die Regierung bleibt zunächst chavistisch. Sie kann für Basisbewegungen nicht der Gegner sein, um sich zu formieren und zu profilieren. Zudem wird die Rechte alles blockieren, was Basisbewegungen stärken könnte. Mehr noch als die Regierungspartei PSUV fürchtet die rechte Parlamentsmehrheit die Selbstermächtigung der Unterschichten.
Einen positiven Aspekt wenigstens hat das Wahlergebnis: Die OpportunistInnen im Chavismus werden es schwerer haben. So kommt es vielleicht doch noch zu der selbstkritischen Debatte, die von KritikerInnen innerhalb der Linken seit fünfzehn Jahren eingefordert wird, die aber nie geführt worden ist.