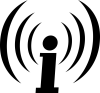Wie fühlt es sich an, als Jude in einem Land aufzuwachsen, in dem "Jude" als Schimpfwort gilt? Über eine Generation in Angst - und voller Selbstbewusstsein
Von Marina Kormbaki
Köln. Wenn Leo morgens zur Schule geht, ins Jüdische Gymnasium in Berlin-Mitte, muss er Sicherheitskontrollen passieren.
Wenn Bea ihre liebste Halskette trägt, die mit dem bunt gezackten
Anhänger, fragen die Mitschüler in Dortmund, was denn der "Judenstern"
soll. "Davidstern", korrigiert sie dann, manchmal.
Wenn Lion der Wunsch beschleicht, mit der Kippa aus dem Haus zu gehen,
verscheucht er ihn wieder. "Nicht da, wo ich wohne", sagt der
Hannoveraner.
Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Leben in Angst. Polizei bewacht
Gemeindezentren, Synagogen und jüdische Kindergärten. Ihr Anblick ist
längst schon zur Gewohnheit geworden, so als gehörten die blau-weißen
Wagen zur Grundausstattung jüdischer Einrichtungen. Unter großem
Polizeiaufgebot wird man bald auch der Befreiung von Bergen-Belsen,
Buchenwald, Dachau und all der anderen Konzentrationslager gedenken, 70
Jahre nach Hitlers Tod.
Im Jahr 2015 sagt Kanzlerin Angela Merkel: "Dass es keine einzige
jüdische Einrichtung gibt, die nicht durch Polizei bewacht werden muss -
das ist ein Punkt, der mich doch sehr besorgt stimmt." Dabei sollte
doch die Bundesrepublik ein Ort werden, an dem Juden sich nicht fürchten
müssen. Schon 1949 sagte der US-amerikanische Hochkommissar John
McCloy, dass man Deutschland künftig daran messen werde, wie es mit
seiner jüdischen Bevölkerung umgeht.
In Oldenburg schmieren heute Unbekannte Hakenkreuze auf jüdische Gräber,
in Berlin verprügeln arabischstämmige Jugendliche einen Mann mit Kippa.
Gefahr droht von rechter wie von Migranten-Seite. Und dass laut einer
aktuellen Bertelsmann-Umfrage 81 Prozent der Deutschen sagen, sie
möchten die Geschichte der Judenverfolgung "hinter sich lassen", trägt
nicht dazu bei, dass Holocaust-Überlebende und ihre Nachfahren sich hier
sicher fühlen.
"Es ist unübersehbar, dass der Judenhass immer offener und brutaler in
Erscheinung tritt", sagt Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats
der Juden, "die Ereignisse von Paris und Kopenhagen hinterlassen
Spuren." Die Anschläge auf einen koscheren Supermarkt in Paris und eine
Synagoge in Kopenhagen haben die Stimmung auch unter deutschen Juden
verändert. In Berlin ist jetzt die Jüdische Gemeinde dazu übergegangen,
ihr Monatsmagazin verhüllt in einem neutralen Umschlag zu verschicken.
Der Vorstand will nicht, dass die Gemeindemitglieder als Juden erkennbar
sind. Und der Zentralrat der Juden rät, die Kippa in Vierteln mit
vielen Muslimen lieber abzusetzen. Ist jüdisches Leben in Deutschland
nur unter der Bedingung möglich, dass keiner davon etwas mitkriegt?
Das Unbehagen setzte nicht erst mit den Morden von Paris und Kopenhagen
ein, es schwelt schon länger. Die Beschneidungsdebatte im Jahr 2012
haben viele Juden als feuilletonistisch verpackte Anfeindung empfunden.
Und als bei den Protesten gegen den Gaza-Krieg im Sommer 2014 nicht nur
Parolen gegen Israel, sondern auch gegen "die Juden" gebrüllt wurden,
schlug das Unbehagen bei vielen in Angst um. Paris und Kopenhagen
verstetigen jetzt das Bedrohungsgefühl: Was kommt als Nächstes?
So sickert die Angst in den Alltag. Man kann sich ihr ergeben, wie der
Publizist Rafael Seligmann, der jüngst in der "Zeit" verkündete: "Wir
gehen!" Europa werde heimgesucht von antisemitischen Stereotypen. Da sei
die Aufforderung von Premier Benjamin Netanjahu, nach Israel
auszuwandern, ein verständliches Signal.
Man kann der Angst aber auch mit stolzem Trotz begegnen. Heiter, laut
und lebhaft. So wie Leo, Bea, Lion und mehr als 1000 junge deutsche
Juden, die sich vor wenigen Tagen in Köln trafen. Kein Gedenktag stand
an und auch kein religiöses Fest, sondern die "Jewrovision": ein
Gesangswettbewerb nach dem Vorbild des Eurovision Song Contest. Zum 14.
Mal fand die vom Zentralrat der Juden ausgerichtete Riesenparty statt,
15 Gruppen aus jüdischen Jugendzentren in ganz Deutschland traten in
beachtlich professionellen Choreografien gegeneinander an. Pop-Produzent
Ralph Siegel saß mit in der Jury, begeistert.
Die Show, der Glanz, alles wichtig, keine Frage. Aber der eigentliche
Sinn der "Jewrovision" ist die Gemeinschaft: Die junge Generation
deutscher Juden soll sich bei Falafel und koscheren Gummibärchen
kennenlernen, sich Jahr für Jahr mit jedem Wiedersehen näherkommen, sich
selbst feiern. Und sie tut das.
Jungs fallen einander zur Begrüßung freudig in die Arme, Mädchen stürmen
aufeinander zu und reden drauflos. Meist auf Deutsch, sehr oft auf
Russisch; schließlich sind die meisten in Deutschland lebenden Juden
erst vor wenigen Jahren aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
eingewandert. Viele von ihnen entdecken erst hier ihre jüdischen
Wurzeln, nachdem ihre Eltern sie in der Sowjetunion vergessen hatten,
vergessen mussten.
Bea und Maria können gar nicht genau sagen, ihre wievielte "Jewrovision"
das heute ist. "Wir sind jedes Jahr hier, von klein auf", sagt die
16-jährige Bea. "Trotzdem staune ich jedes Mal, dass es so viele von uns
gibt", sagt ihre Freundin Maria. "Ich komme mir oft vor, als sei ich
von einem anderen Stern. Aber hier muss ich niemandem erklären, warum
ich anders bin. Hier verstehen wir uns ohne Worte und können sein, wie
wir sind", sagt Bea, das Mädchen mit dem Davidstern um den Hals.
Auf der Bühne geben die Jugendlichen derweil alles, um Pop und Judentum
zu vereinen. Die Wuppertaler schwenken Israel-Fahnen und singen zum
ruppigen Gitarrenriff des "Rocky"-Songs "Eye of the Tiger": "Israel, das
ist mein Land, da bin ich willkommen." Die Stuttgarter covern den
jiddischen Evergreen "Bei Mir Bistu Shein", bei ihnen heißt es: "Du bist
mein Freund, bei dir geht's mir gut, gemeinsam verändern wir die Welt."
Und die Hannoveraner skandieren zu wuchtigem Dance-Beat: "Setz die
Kippa auf, trau dich raus!"
Ist die Aufforderung ernst gemeint? "Es ist mehr ein Wunsch", sagt
Anastasia Kyselova, Leiterin des hannoverschen Jugendzentrums nach dem
Auftritt ihrer Gruppe. "Die Welt wäre eine bessere, wenn man unserer
Aufforderung ohne Angst folgen könnte." Neben ihr steht der 18-jährige
Lion. Heute trägt er die Kippa, ausnahmsweise. "Hier sind ja sehr viele
Sicherheitsleute", sagt er und hat recht. Zwischen den quasselnden,
lachenden, johlenden Grüppchen stehen lauter bewaffnete Männer in
Position. "Aber eigentlich kann es ja nicht genug Sicherheit geben",
sagt Lion.
Leo und sein Freund Gabriel sehen das anders. Ein wenig genervt sitzen
sie im Foyer und trinken Cola. Die 15-Jährigen würden gern mal zum Kiosk
um die Ecke, dürfen das Gebäude aber nicht verlassen. Aus
Sicherheitsgründen. "Ist halt so", sagt Gabriel, "ist immer so", sagt
Leo und erzählt von den Sicherheitskontrollen morgens am Schultor des
Jüdischen Gymnasiums in Berlin.
Sein Kumpel Gabriel lebt in Frankfurt, er geht auf eine staatliche
Schule. "Jude" ist ein Schimpfwort unter seinen Mitschülern. "Die Leute
sagen ,Mach mal keine Judenaktion', wenn sie meinen, dass jemand
rumgeizt, bei Trinkspielen auf Partys sagen sie ,ex oder Jude'." Und was
sagt Gabriel dann, sagt er überhaupt etwas? "Doch, ich frage schon, was
das soll, ob's ein Problem gibt."
"Das ist halt so die Stimmung", sagt Leo. Ist diese Stimmung ein Grund
zum Auswandern nach Israel? "Nee. Meine Eltern kamen aus der Ukraine
hierher, Gabriels aus Georgien - unsere Familien haben das mit dem
Auswandern schon hinter sich. Wir bleiben jetzt hier."
Aufruf zur Auswanderung - immer wieder
Kommt", sagt Israels Premier Benjamin Netanjahu. "Bleibt", sagen Kanzlerin Angela Merkel und der französische Staatschef François Hollande. Seit den jüngsten Attentaten auf einen koscheren Supermarkt in Paris und eine Synagoge in Kopenhagen hat Israels Regierung die in Europa lebenden rund 1,5 Millionen Juden wiederholt zur Auswanderung nach Israel aufgerufen. "Diese Terrorwelle wird weitergehen", meint Netanjahu, "Israel ist eure Heimstätte."
Tatsächlich ist in den zurückliegenden fünf Jahren die Zahl der
Menschen, die Westeuropa gen Israel verlassen haben, deutlich gestiegen.
Zogen im Jahr 2010 noch etwa 3800 Juden nach Israel, waren es 2014
bereits mehr als 8000. Von ihnen lebten 6700 zuvor in Frankreich, das
mit mehr als 500000 Mitgliedern die größte jüdische Gemeinde in Europa
hat. Migrationsexperten warnen jedoch davor, die zunehmende Sorge vor
antisemitisch motiviertem Terror als alleinigen Grund für die
Auswanderungswelle anzusehen. Erstens sei Israel angesichts der ihm
feindlich gesinnten Nachbarschaft alles andere als sicher. Und zweitens
sei es kein Zufall, dass die Auswanderung ausgerechnet zu jenem
Zeitpunkt eingesetzt habe, da Frankreichs Wirtschaft von Rezession und
hoher Arbeitslosigkeit geprägt ist. Der Fortzug französischer Juden nach
Israel ist offenbar auch Ausdruck der Wirtschaftskrise in dem Land. Der
französische Trend lässt sich indes nicht verallgemeinern. In
Deutschland beispielsweise wandern derzeit mehr Israelis ein als
deutsche Juden nach Israel auswandern. Schätzungen gehen von derzeit
rund 200000 Juden in Deutschland aus.
Die Debatte hat auch die USA erfasst. Der Kongress diskutiert, ob die
USA die Einreise europäischer Juden erleichtern sollten. "Nach den
Terroranschlägen in Paris wird es höchste Zeit, dass wir unsere Grenzen
öffnen", sagt Washingtons oberster Rabbi Shmuel Herzfeld.
Ihm und auch dem israelischen Premier Netanjahu wird man ernsthafte
Sorgen nicht absprechen können - letzteren dürfte aber auch
innenpolitisches Kalkül bewegen: Einwanderer sind für die Existenz des
jüdischen Staates von entscheidender Bedeutung. Und dass am 17. März in
Israel Parlamentswahlen anstehen, dürfte Netanjahus Bestreben, sich als
fürsorglicher Vater der Nation zu geben, noch verstärken.
Die Debatte um islamistischen Terror in Europa lässt übersehen, dass
Aufrufe zur Auswanderung nach Israel in Europa eine bald 120-jährige
Geschichte haben. Es waren die Zionisten, die zum Ende des 19.
Jahrhunderts die "Alija", das "Hinaufsteigen" ins Gelobte Land
propagierten. Kontroversen zwischen Zionisten und Juden, die in Europa
ihre Heimat sehen, hat es in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals
gegeben. So löste 1996 der damalige Staatspräsident Ezer Weizman mit
seiner Aufforderung zur Auswanderung ein lautes negatives Echo bei
deutschen Juden aus - ähnlich wie Netanjahu heute. kor