Aus Safed berichtet Juliane von Mittelstaedt
Eli Zvieli hat den Holocaust überlebt. Heute kämpft der 89-jährige Jude in der israelischen Stadt Safed gegen den Rassismus seiner eigenen Landsleute. Ein Oberrabbiner hat dazu aufgerufen, nicht mehr an arabische Studenten zu vermieten. Wer gegen die Selektion verstößt, bekommt die Wut zu spüren.
Erst drohten sie damit, sein Haus anzuzünden. Dann kamen die Beleidigungen, meist per Telefon. Verräter nannten sie ihn. Eine Schande für die Stadt. Dann klebte ein Poster an seiner Tür, darauf stand: "Zvieli bringt die Araber zurück nach Safed!! Ein schreiendes Unrecht!!" Er riss es ab. Es folgte ein Poster an der Wand gegenüber: "Wach auf, Safed, morgen wird es zu spät sein!!!"
Eli Zvieli ist 89 Jahre alt. Er stammt aus Siebenbürgen und hat den Holocaust überlebt. Seit 60 Jahren lebt er in Israel. Der Zorn richtet sich gegen ihn, weil er seit Semesterbeginn Zimmer an drei israelische Beduinen vermietet, die am College von Safed studieren.
Der Nachbar beschwerte sich. Er sagte: "Ich ertrage es nicht, Araber anzusehen." Er bot Zvieli an, die Miete zu übernehmen, wenn er die Wohnung leerstehen lasse. Danach bot er an, sie zu kaufen. Zvieli lehnte ab. Der Nachbar ist leider auch der Oberrabbiner von Safed, das war Zvielis Pech.
Schmuel Elijahu hat schon gefordert, Kinder von Terroristen aufzuhängen. Und Wohngebiete zu bombardieren, aus denen Raketen auf Israel abgeschossen werden. Das neue Ziel des Rabbiners sind die Studenten.
"Meine Studenten sind nette junge Männer"
1400 Araber studieren in Safed. Nur 120 von ihnen leben im Wohnheim, vielleicht 70 in der Stadt - unter 32.000 Juden, davon ein Drittel ultra-orthodox. Safed ist eine der vier heiligen Städte des Judentums, hoch in den Bergen Galiläas gelegen. Durch die Straßen schlurfen Gestalten wie aus dem Märchenbuch, Männer mit weißem Rauschebart, schwarzem Mantel, unter dem Arm ein Buch.
Rabbi Elijahu ist einer von ihnen. Er sagt Dinge wie: "Ein Araber, der sich wie ein Gast des jüdischen Staates benimmt, ist willkommen, aber wenn er sich wie ein Grundbesitzer verhält, dann gibt es keinen Platz für ihn." Weshalb er die Bewohner von Safed dazu aufrief, nicht mehr an Araber zu vermieten. Einige Tage später betrat er Zvielis Haus und sagte zu den drei Beduinen: "Verschwindet aus Safed und geht zurück in euer Dorf."
Niemand protestierte gegen den öffentlichen Mietboykott. Weder die Bewohner von Safed noch der Bürgermeister, auch nicht die Regierung. Nur Eli Zvieli. "Meine Studenten sind nette junge Männer, sie tun niemandem was", sagt er. Und erklärte dem Rabbi, er werde den drei Beduinen nicht kündigen.
"Ich habe mich schrecklich gefühlt, richtig gehasst", sagt Nimran Grifat, 19, einer von ihnen. Er studiert Krankenpflege, fast all seine Kommilitonen sind Araber. Krankenpfleger ist ein arabischer Beruf in Israel. "Wir machen keinen Lärm, in der Wohnung sind wir nur zum Essen und zum Schlafen", sagt er. Grifat ist israelischer Staatsbürger. Wenn er in drei Jahren seine Ausbildung beendet hat, wird er zur Armee gehen, er hat sich für sechs Jahre verpflichtet. Aber auch in Uniform wird er für viele der Feind bleiben.
Israel ist ein jüdischer Staat, aber ein Fünftel seiner Bürger sind arabische Muslime, Christen, Drusen. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen gehören nicht dem Judentum an. Juden und Araber leben in getrennten Städten, lernen in getrennten Schulen und wählen getrennte Parteien. Es gibt Jobanzeigen, in denen steht "Avoda Ivrit" - "Hebräische Arbeit". Das bedeutet: Arbeit nur für Juden.
Es geht in Safed um mehr als einen Nachbarschaftsstreit, um mehr als ein paar fundamentalistische Rabbis. Es geht darum, dass die jüdische Mehrheit sich nicht mehr verpflichtet fühlt, die Minderheit im Land zu tolerieren. Auf Bänken in Safed steht: "Sitzen für Hunde, Schweine und Araber verboten".
Es scheint, dass der offene Araberhass der nationalistischen Regierung Wurzeln geschlagen hat.
Allein in den vergangenen Wochen hat die Regierung ein halbes Dutzend diskriminierende Gesetze in die Knesset eingebracht:
- einen Loyalitätsschwur für öffentliche Angestellte und Neubürger auf den "jüdischen und demokratischen Staat"
- ein Arbeitsverbot für arabische Fremdenführer in Jerusalem
- ein Verbot für alle Organisationen, die den "jüdischen Charakter" des Staates in Frage stellen
- Außerdem sollen kleine Gemeinden neue Bürger demnächst abweisen dürfen, wenn die Bewerber "sozial und kulturell" nicht zur Gemeinschaft passen - eine Einladung zur Diskriminierung.
Der Oberrabbiner war also nicht so weit entfernt von der offiziellen Regierungslinie, als er Anfang Oktober eine "Notfallsitzung" einberief. Das Motto: "Der stille Krieg - wir kämpfen gegen die Assimilation in der heiligen Stadt Safed." 18 Rabbis aus Galiläa sprachen da vor 400 jubelnden Anhängern, sie sprachen vor allem über das, was sie hier die "Gefahr der Assimilation" nennen: arabische Männer, die mit jüdischen Frauen ausgehen.
Am Ende stellten die Rabbis ein religiöses Gebot aus: "Nachbarn und Bekannte müssen sich von dem Juden distanzieren, der an Araber vermietet, sie sollen keine Geschäfte mit ihm machen, ihm das Recht verwehren, aus der Tora zu lesen und ihn auf ähnliche Weise ächten, bis er diesen schändlichen Vertrag gelöst hat."
An die Araber gewandt hieß es weniger formell: "Geht zurück an eure eigenen Orte und besudelt unsere Gläubigen nicht."
"Ich habe den Holocaust überlebt, mir macht nichts mehr Angst"
Kurz darauf griffen 30 Juden drei Araber auf der Straße an, bewarfen ihr Haus mit Steinen und riefen "Tod den Arabern". Wenn ein Araber ein Geschäft betritt, heißt es jetzt manchmal: Wir haben geschlossen. Flugblätter gegen ein "Flüchtlingslager für psychotische, sadistische, geisteskranke Araber" wurden verteilt. Gemeint ist damit die Medizinhochschule, die im kommenden Jahr eröffnen soll.
Die Studenten finden keine Wohnungen mehr. Die Bewohner von Safed schwiegen. Nur Eli Zvieli ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Zvieli, dessen Familie in Auschwitz starb, der erst Zwangsarbeiter war und danach in russischer Kriegsgefangenschaft als einziger Jude unter Tausenden deutschen Soldaten lebte.
"Wir Juden haben in Europa gelitten. Ich will nicht, dass wir gegenüber den Arabern genauso handeln", sagt er und klingt noch immer geschockt, wenn er von den Drohungen erzählt. Er ist ein zierlicher Herr, lächelt oft und trägt gern eine verwaschene Schirmmütze. Mit fester Stimme sagt er: "Ich habe den Holocaust überlebt, mir macht nichts mehr Angst."
Der Bürgermeister will über die Drohungen nicht reden, Ilan Schochat spricht lieber von der "berechtigten Sorge" des Rabbis und von der friedlichen Koexistenz der Religionen. Er berichtet, dass er ja auch 40 Araber im öffentlichen Dienst beschäftige. Was zeige, dass er kein Rassist sei.
Schochat ist 36 und damit der jüngste Bürgermeister Israels. Seine Stimme kratzt, er muss derzeit viel erklären. Denn die Zeitung "Haaretz" hat Safed zur "rassistischsten Stadt Israels" erklärt. Er sagt: "Für jemanden, der nicht aus Israel ist, klingt es vielleicht schrecklich zu sagen, man solle nicht an Araber vermieten. Aber für uns ist das normal."
Für den Bürgermeister ist Safed die magische Hauptstadt von Kabbala und Klezmer, die Studenten dagegen brächten "schlechte Energie gegenüber den Juden" mit in die Stadt. "Sie hören am Sabbat laute Musik, sie rauchen Wasserpfeife vor der Synagoge, und dann machen sie auch noch die Mädchen an." Um Frieden zu schaffen, sagt Schochat, soll jetzt die Polizei mehr Präsenz in der Stadt zeigen. Damit die Bürger sich beschweren können, wenn sie von Arabern belästigt werden.
Dass jedes Jahr 1,2 Millionen Besucher leichtbekleidet durch Safed laufen, scheint dagegen kein Problem. Ruhestörung durch Touristen wird akzeptiert. Durch Araber nicht.
Auch anderswo gibt es diese Konflikte, vor allem aber hier in Galiläa, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung arabisch ist. Die Regierung hat seit den fünfziger Jahren Hunderte neue Dörfer und Städte für Juden gegründet, aber keine einzige Gemeinde für Araber. Im jüdischen Karmiel etwa wurden Zeitungsanzeigen veröffentlicht, die dazu aufriefen, nicht an Araber zu vermieten. Der Vizebürgermeister prahlte, er habe den Verkauf von 30 Häusern an arabische Familien verhindert. Danach wurde er gefeuert.
Tausche Israelis gegen Araber
In Lod im Zentrum Israels haben sie dieses Jahr eine drei Meter hohe Mauer zwischen jüdischen und arabischen Wohnvierteln errichtet. Und in Jaffa werden arabische Häuser abgerissen und an deren Stelle teure Villen gesetzt. So findet ein stiller Bevölkerungswandel statt.
Von der Regierung hört man zu all diesen Dingen nichts. Im Gegenteil: Der Außenminister warb vor der Uno-Generalversammlung für den Tausch arabischer Städte samt Einwohner gegen Siedlungen im Westjordanland. Wie ernst man solche Pläne in Israel nimmt, zeigte vor wenigen Wochen eine Militärübung: Trainiert wurde, Aufstände der Araber gegen ihre Abschiebung niederzuschlagen.
"Es gab immer Leute, die nicht an Araber vermietet haben, aber sie taten das im Stillen", sagt Ron Gerlitz von Sikkuy, einer Organisation, die sich für die friedliche Koexistenz einsetzt. "Heute fühlen sie sich von der Regierung ermutigt." Gerade die neuen Gesetzesinitiativen heizten den Konflikt zwischen Juden und Arabern an, meint Gerlitz. Ein Grundkonsens der Gesellschaft werde in Frage gestellt, "nämlich der, dass wir alle gleichberechtigte Bürger Israels sind."
Das führt dazu, dass sich manche Araber radikalisieren und letztlich bestätigen, was ihnen viele Israelis unterstellen: dass sie Landesverräter sind, eine fünfte Kolonne mit feindseligen Motiven. So wurde ein Imam aus Nazaret gerade vor Gericht gestellt, weil er Qaida-Ideologie predigte. 60 israelische Araber hat man dieses Jahr wegen sogenannter Sicherheitsdelikte verhaftet - so viele, wie seit Jahren nicht. In Umfragen sank der Anteil der Araber, die Israels Existenzrecht akzeptieren, von 81 Prozent im Jahr 2003 auf jetzt 60 Prozent.
Schochat, der Bürgermeister von Safed, meint eine Lösung für das Problem mit den arabischen Studenten gefunden zu haben. Die Hochschule solle einfach an den Stadtrand ziehen und ein großes Wohnheim bauen, sagt er. Dann gebe es keine Probleme mehr.
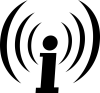



Der Titel des Artikels ist
Der Titel des Artikels ist eigentlich "Holocaust-Überlebender wehrt sich gegen Diskriminierung von Arabern". Der Rassismusvorwurf kommt vom Spiegel und nicht von Eli Zvieli. Aber der hier erfundene Titel macht schon mehr her...