Kritisch-lesen.de sprach mit Klaus Viehmann über die Verknüpfung von Theorieproduktion und politischem Handeln unter kapitalistischen Verhältnissen, die Möglichkeiten der Kritik an einem überkommenen Klassenbegriff und den Kampf gegen die dreifache Unterdrückung durch Kapital, Rassismus und Patriarchat.
kritisch-lesen.de: Das Thema Klassenkampf ist in der Linken mindestens out, an mancher Stelle sogar verschrien. Das Proletariat wird gern mit dem rassistischen Mob assoziiert. Warum müssen wir über Klasse und Klassenkampf diskutieren?
Klaus Viehmann: Na ja, über Klassenkampf müssen alle diskutieren, die über materielle Bedingungen diskutieren. Nur wer glaubt, dass Kämpfe und gesellschaftliche Veränderungen lediglich eine Frage der subjektiven Haltung sind, kann es sich schenken, die kapitalistischen Bedingungen menschlichen Handelns zu beachten. Bei Klassenkämpfen geht es aber auch immer um mehr als den Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit. Zu Unterdrückungsverhältnissen wie Patriarchat oder Rassismen gibt es wichtige stabilisierende und wechselseitige Verbindungen. Eine rein ökonomistische Analyse neigt zu der selektiven Wahrnehmung, dass Klassenkämpfe von der männlichen, weißen Arbeiterklasse gemacht werden und übersieht, dass es ein breites Spektrum an Kampfmotiven, Kampfformen und Kämpfenden selbst gibt.
Dass Angehörige des Proletariats Teil eines rassistischen Mob sein können, ist leider wahr, aber das können Pegida-Mittelschichtler und Sarrazin-Bürger auch nur zu gut.
KL: Du bist schon ein paar Tage politisch aktiv. Wie kam das?
KV: Ich komme aus der eher praktischen Ecke. Studiert habe ich nie. 1969 habe ich die ersten Flugis gegen die NPD verteilt und bekam prompt meine erste Vorladung zur politischen Polizei. Mein Bezugspunkt war damals die subkulturell geprägte Lehrlings- und Jugendzentrumsbewegung. 1970 gab’s dann bei einer kleinen Demo das erste Mal auf die Fresse – völlig grundlos, aber umso lehrreicher. Ab 1973 habe ich als Lehrling in einem Buchladenkollektiv die Westberliner Linke kennengelernt und das Abflauen der APO erlebt. Ich bin dann aus diversen Gründen zur damaligen Stadtguerilla in Westberlin, der Bewegung 2. Juni, gegangen, das waren die mit der Lorenz-Entführung. Von 1976 bis 1978 war ich als „Illegaler“ unterwegs und von 1978 bis 1993 war ich im Knast. Wen’s interessiert: mein Fazit der Knastzeit wurde vor ein paar Jahren in der Rote-Hilfe-Zeitung (S. 15ff.) abgedruckt.
KL: Als Nichtakademiker in der linken Szene aktiv zu sein ist zumindest heute eher selten. Wie war es damals?
KV: Das gilt wirklich nur für die „Szene“. In Betrieben oder Gewerkschaften gab es viele nicht-akademische und ziemlich radikale Linke. Wie auch immer: Das Problem der Akademisierung linker Theorie wurde schon in den 1970er Jahren diskutiert. Einerseits war es in der studentisch geprägten Linken eher cool, Lehrling oder „Proll“ zu sein, weil die Arbeiterklasse ja noch als revolutionäres Subjekt der Geschichte galt. Andererseits glaubten aber nicht wenige – die sogenannten Kopfrocker –, dass sich aus der Auseinandersetzung mit komplizierten Texten die richtige Praxis automatisch ergeben würde, zum Beispiel nach drei ausgiebigen Kapital-Schulungen. Welch ein Illtum... Ich habe schon damals gedacht, dass es eine Denkfalle ist, Theorie und Praxis zu trennen. Das eine ist ein Korrektiv und eine Anregung für das andere. Theorie um ihrer selbst willen – also auf einer sozialen Glatze akademische Locken drehen – ist im Effekt so sinnlos wie eine politische Praxis, die nicht reflektiert und nötigenfalls korrigiert wird.
KL: Wie wurde denn über unterschiedliche Klassenlagen innerhalb der Linken diskutiert?
KV: Klar, jemand aus einer Arbeiterfamilie macht andere Erfahrungen und verarbeitet sie auch anders als jemand aus der Mittelschicht, auch, was Erfahrungen mit Rassismus und patriarchalen Strukturen angeht. Man erlebt Geldmangel abstrakt oder konkret, nimmt die Fabrik als alltägliches Terrain oder theoretischen Schauplatz von möglichen Arbeitskämpfen wahr. Und natürlich werden auch politische Angriffsziele von der Klassenlage geprägt: Linke Arbeiterinnen und Arbeiter müssen im Alltag gegen Chefs und Kapitalinteressen kämpfen, und wer studieren kann, hat eher Raum für andere, globalere Aktivitäten.
Damals, erste Hälfte der 70er-Jahre, kamen zwar noch mehr Studierende aus ArbeiterInnenfamilien, aber die Mehrzahl der Linken war Mittelschicht. Diese Klassenzusammensetzung war aber nach meinem Eindruck seinerzeit stark politisch und lebensweltlich überformt: In WGs oder Kneipen und auf Demos trafen Studierende auf Lehrlinge und GewerkschafterInnen, AkademikerInnen auf Junkies und Kleinkriminelle, MLerInnen und TrotzkistInnen auf AktivistInnen der neuen Schwulenbewegung und die schon länger aktive Frauenbewegung. Breite Diskussionen über die jeweilige Klassenlage gab es eher nicht, höchstens mal am Küchentisch. Die Situation in Westberlin war ja damals auch anders, es gab viele große billige Wohnungen, und wenn jeweils zwei, drei von sechs Leuten jobbten, reichte das für alle. Dazu kam womöglich Bafög oder Geld der Eltern in die gemeinsame Kasse. Dieses Modell taugte aber ganz sicher nicht für Alleinlebende oder (proletarische) Kleinfamilien. Außerdem lagen Welten zwischen jemandem, der/die sich ohne Lohnarbeit selbstverwirklichen will, und, ich sag’ mal: SchichtarbeiterInnen. Manche Lebensstile, die in den Großstadtszenen von Linken gelebt werden, sind ja bis heute ziemlich exklusiv-ausschließend.
KL: Wie können denn Theorie und Praxis trotzdem zusammen gebracht werden?
KV: Wenn du die Gesellschaft wirklich radikal verändern willst, geht es bei der Aneignung oder Diskussion von Theorie ja nicht um Scheine und eine akademische Karriere. Theorieproduktion könnte stattdessen als Teil sozialer Kämpfe verstanden werden. So wie die alte Parole der Lehrlingsbewegung: Leben – Lernen – Kämpfen. Und das nicht individuell, sondern kollektiv. Damals konnte das eine Basis-Stadtteilgruppe sein, ein Buchladenkollektiv, die Arbeitsstelle, die WG oder Kommune. Auch bei den Stadtguerillagruppen wurde übrigens viel, viel mehr gelesen und diskutiert – untereinander oder mit anderen Linken – als mit Waffen herumgemacht. Die meisten hatten die üblichen Kapital-Schulungen gemacht und die linken Säulenheiligen wie Lenin, Mao, Bakunin, Che, Frantz Fanon, George Jackson, Vera Figner und so weiter gelesen. Dazu kamen dann Bücher über Befreiungsbewegungen, Organisation und ein paar technische Fachbücher. Wir wollten eine Einheit von Denken und Handeln herstellen, die Trennung von Überzeugungen und deren Verwirklichung aufheben. In dem Sinne haben wir uns als Militante verstanden, nicht im Sinne von „Streetfightern" mit hohlem Gepose. Militant zu sein hieß, für deine politische Überzeugung kämpfend die eigene Person und Lebensperspektive in die Waagschale der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu werfen.
KL: Du warst 15 Jahre im Knast. Hat dir dieses Militanz-Verständnis geholfen?
KV: Oh ja! Die Fronten im Knast sind zwar klar, und an klaren Fronten lässt sich gut kämpfen: Du wehrst dich gegen das Knastregime, das dich fertig machen und von deinen linken Überzeugungen abbringen will. Aber du musst, wie draußen auch, „militant“ gegen den Meinungsmainstream und den stummen Zwang der Verhältnisse andenken, und dafür brauchst du Theorie, Wissen, Lesen und Schreiben. Es geht im Grunde all die Jahre darum, zu leben oder gelebt zu werden. Peter Weiss hat in der „Ästhetik des Widerstands“ geschrieben: „Die Wachheit der Gedanken ist die letztlich bleibende Waffe.“ Das ist im Knast eine echte Herausforderung, denn die Voraussetzungen für die Wachheit der Gedanken sind dort Mangelware: Bücher, Zeitungen und Radio gibt es nicht so im Überfluss wie draußen. Du musst ständig gegen die Knastzensur kämpfen, um nicht nur ausgesuchte Bücher und Zeitungen zu bekommen, alle Besuche und Briefe wurden bis zum Entlassungstag kontrolliert und so weiter.
KL: Kann man im Knast dennoch eine kollektive Theorie und Praxis entwickeln?
KV: Natürlich ist es schwierig, in der Isoliertheit des Knasts theoretisch zu arbeiten. Isolation macht zunächst einmal blind für Wirklichkeiten außerhalb der eigenen Erfahrungen und Wissenshorizonte. Gegen diese Isolation und Vereinzelung sind immerhin Bücher, Zeitungen und Briefe ein Zugang zur Geschichte anderer Menschen, ihren Kämpfen, ihren Niederlagen, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen. So kannst du internationale Verhältnisse reflektieren und deine eigenen Überzeugungen überprüfen. Und dann muss du natürlich versuchen, irgendwie in Austausch mit anderen über diese Überlegungen zu kommen. Die Diskussionen über Theorie – über praktische Aktionen kannst du ja unter der Zensur schlecht diskutieren – sind damit der kollektive Prozess, der Gefangenen bleibt. Dazu gehören eine große Portion Wissbegierde, hungrige Augen und Ohren und Lust auf andere Erfahrungen und Analysen.
KL: Die theoretische Arbeit im Knast ist von den Bedingungen her also eine ziemlich einsame, zumal mittelbare Angelegenheit. Wie schafft man es, in diesem Gefangensein – das ja auch zum Gefangensein im eigenen Denken werden kann – den Bezug zum Draußen herzustellen?
KV: Ja, das ist eine wichtige Frage und du brauchst ein paar Jahre, um sie zu beantworten. Nach meiner Erfahrung darfst du nicht der Versuchung erliegen, nur das hören, lesen und sehen zu wollen, was dich nicht verunsichern kann. Wer das tut, riskiert, dass seine Überzeugungen zu hohlen Parolen verkommen und nur noch ein Stützkorsett bilden, das beim ersten ernsthaften Zweifel völlig zerbricht. Es ist besser, immer wieder Zweifel zuzulassen, nachzudenken und weiterzudenken, sich als soziales Wesen in Bezug zu setzen zu den lebendigen Realitäten draußen. Und deshalb sind die Kontakte nach draußen für Gefangene auch so wichtig. Reflexion und Selbstreflexion finden durch Sprache statt, und da ist das Schreiben und Bekommen von Briefen ganz wichtig, um Gedanken zu sortieren, zu reflektieren und von anderen bestätigt oder korrigiert zu werden. Mit Marx gesagt ist Sprache praktisches Bewusstsein, das heißt, was du nicht formulieren kannst, kannst du auch nicht denken.
Im Idealfall war Theorieproduktion im Knast immer zweierlei: Ein Mittel gegen das intellektuelle Ersticken im Knast und ein Beitrag für deine Genossinnen und Genossen draußen.
KL: Welche Themen und Theorien waren das, an denen du während deiner Zeit im Knast gearbeitet hast?
KV: In den ersten Jahren im Knast drehten sich die Debatten oft um Konzepte des bewaffneten Kampfes, um Fragen des Knastkampfes, darum, wie man sich im Prozess gegen die Justiz verhält und so weiter. Das waren alles Fragen, die unter der Käseglocke eines Hochsicherheitstraktes wahnsinnig wichtig wirken und auch sind. Wer sich - wie ich - nicht dem Kollektiv der RAF-Gefangenen angeschlossen hatte, musste sich mehr um Kontakte nach außen, zu verschiedensten linken Gruppen oder Individuen bemühen, um politische Diskussionen führen zu können. Also auch über Themen, die in den politischen Gruppen draußen, gerade auf internationaler Ebene, kontrovers diskutiert wurden.
KL: Aus solchen Diskussionen ist ja auch der Aufsatz „Drei zu Eins“ entstanden. Damit bezeichnet ihr die „triple oppression“. Was ist damit gemeint?
KV: Es geht um die Kritik an einem überkommenen Klassenbegriff und eine unvollständige Kapitalismusanalyse. Mit „triple oppression“ wird die dreifache Unterdrückung durch Kapital, Rassismus und Patriarchat angesprochen. Um das jetzt mal geschichtlich einzusortieren: Mitte bis Ende der 1980er war eigentlich deutlich zu sehen, dass die autonome gemischte Linke viele Unterdrückungsverhältnisse nicht gut genug sieht und sie auch auf der praktischen Ebene nicht ausreichend bekämpft, nicht mal in den eigenen Reihen. In der Zeit entstand ein lockerer Zusammenhang von Leuten, die mir geschrieben oder mich besucht haben, die alle unzufrieden mit der autonomen Bewegung und deren „weißen Flecken“ waren.
KL: Woher kamen diese „weißen Flecken“?
KV: Solche Fragen haben wir uns damals auch gestellt: Welcher Klasse entstammt die autonome Linke, welches Geschlecht hat sie, wie deutsch und wie weiß ist sie eigentlich? Wie kann eine Linke damit umgehen und trotzdem emanzipatorisch wirken und alle Verhältnisse umwerfen, die unterdrückerisch sind? Da ging es also um bewusstseinsmäßige und praktische Konsequenzen der eigenen materiellen Bedingungen.
KL: Und welche Antworten habt ihr auf diese Fragen gefunden?
KV: Bei der Suche nach Antworten stießen wir bald auf Texte von Schwarzen, etwa aus den Postcolonial Studies von Stuart Hall, Paul Gilroy und Hazel V. Carby, oder auch auf Diskussionen US-amerikanischer Stadtguerillagruppen wie dem Weather Underground oder der Black Liberation Army. Man muss dazu sagen: Das alles waren Ansätze, die damals vom linken Mainstream weit entfernt waren. Viele Texte waren noch nicht mal auf Deutsch erschienen. Hinzu kamen feministische Kritiken am Marxismus von Christel Neusüß und den „Bielefelderinnen“ wie Maria Mies.
Dass anderswo solche Diskussionen viel weiter waren, macht ein Zitat von Neville Alexander deutlich, einem Schwarzen Anti-Apartheid-Aktivisten, der zehn Jahre lang auf Robben Island gefangen war. Er sagt sinngemäß, dass man nicht von drei Stadien oder verschiedene Kämpfen sprechen kann, sondern von einem einzigen Kampf der Befreiung: gegen Rassismus, Kapitalismus und Patriarchat. Der Kampf ist unteilbar und kann nicht gewonnen werden, solange eine der anderen Unterdrückungsformen weiter besteht.
Wir wollten diese wichtigen Gedanken für die deutschsprachige Linke aufgreifen und für die Kämpfe hier nutzbar machen. Alle 3:1-DiskutantInnen kamen ursprünglich aus einer marxistischen Ecke und im 3:1-Papier wird keineswegs behauptet, dass die Marx'sche Theorie erledigt sei. Aber der triple-oppression-Ansatz unterstreicht, dass Kämpfe nicht nur von einer weißen, männlichen Arbeiterklasse in den Metropolen gemacht wurden oder werden, sondern dass gegen Imperialismus, Patriarchat und Rassismen ebenso wichtige Widersprüche und Kämpfe existierten und sich weiter entwickeln werden.
Es ist klar, dass es den Kapitalismus, das Patriarchat oder die Rassismen nicht ohne spezifische historische Entwicklungslinien gibt. Das heißt, dass in konkreten Situationen Unterschiede in der „Zusammensetzung“ der Unterdrückungen zutage treten, die sich dann, in unterschiedlicher Ausprägung, etwa gegen Arbeiterinnen und Arbeiter, gegen Frauen oder gegen Schwarze richten − oder auch imperialistisch gegen trikontinentale Befreiungskämpfe, also Kämpfe des antikolonialen Widerstands in Asien, Afrika und Lateinamerika. Es gibt kein schematisches Nebeneinander von Unterdrückungen in der Wirklichkeit. Keine ist völlig auf eine andere zurückführbar oder völlig vereinnahmt von anderen, sie bilden eine zusammenhängende Wirklichkeit.
KL: Deswegen geht es also um die Unteilbarkeit der Kämpfe, die du ja schon mit der Aussage von Neville Alexander angesprochen hast.
KV: Das ist ein zentraler Punkt! Unvollständiges Erkennen des Feindes hatte immer eine Verkürzung der revolutionären Versuche und ihrer Utopien zur Folge. Entweder wurde der Feind um seine rassistische Seite verkürzt, und die Befreiung der Schwarzen fiel unter den Tisch, oder die patriarchalische Seite des Feindes wurde übergangen, und die Frauenunterdrückung blieb, oder die kapitalistische Seite des Feindes wurde nicht wahrgenommen und (nicht nur) die ArbeiterInnen hatten es auszubaden. Wurden eurozentristisch die imperialistischen Aspekte des Feindes tatenlos hingenommen, so konnte er von seinen Kernländern aus Kriege führen und den Globus ausbeuten.
Der triple oppression-Ansatz kritisiert übrigens nicht etwa den linken Universalismus des „Umwerfens aller Verhältnisse“, er kritisiert vielmehr, dass die (alte) Linke ihrem eigenen universalistischen Anspruch nie gerecht wurde, denn „Der Mensch“ war für sie männlich, weiß, Lohnarbeiter und Metropolenbewohner − und auch nur die ihn unterdrückenden Verhältnisse wollte sie umwerfen.
KL: Welche Perspektiven ergeben sich aus dieser Analyse für das konkrete Handeln?
KV: Wir haben das im 3:1-Papier zwar nicht so ausdrücklich gesagt, aber: Es war auch ein ganz praktischer Vorschlag an die Linke, die Autonomie und Selbstorganisation der Frauenbewegung, die ja oft als Spalterei kritisiert wurde, und auch die Selbstorganisation von MigrantInnen zu akzeptieren und solidarisch zu unterstützen. Der triple-oppression-Ansatz verlässt ja den alten unergiebigen Haupt- versus Nebenwiderspruch-Zirkel und versucht einen gemeinsamen vielgestaltigen Feind zu definieren. Das ist wichtig, denn nur Leute, die ihren Feind in einer zumindest sehr ähnlichen Weise identifizieren, können darauf hoffen, ihre Kräfte zu vereinigen. Den Feind unvollständig zu erkennen hatte historisch gesehen immer eine Verkürzung der revolutionären Versuche und ihrer Utopien zur Folge, und damit auch böse linke Niederlagen. Also: Know your enemy!
Das ursprüngliche 3:1-Papier war gar nicht als Publikation gedacht und hat einige zeittypische Mängel in Hinsicht auf die Antisemitismusanalyse oder die Kritik der Behindertenbewegung an linken Vorstellungen vom optimierten „neuen Menschen“, dazu habe ich vor der Entlassung aus dem Knast dann noch zwei ergänzende „Nachbemerkungen“ geschrieben (siehe hier).
Aber das zentrale Motiv des 3:1-Papiers ist wohl zeitlos: Eine "militante" gemeinsamere linke Theorie und Praxis, die auf der Anerkennung der Autonomie und Erfahrungen anderer Unterdrückter beruht und von einem Bewusstsein von der Unteilbarkeit ihrer Kämpfe getragen wird.
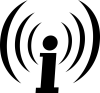
Links zu weiteren Texten von Klaus Viehmann u.a.
Die Ausgabe der Roten-Hilfe-Zeitung mit dem Text von Klaus Viehmann gibt es auch hier: https://linksunten.indymedia.org/en/node/91370
Und den Text "Drei zu Eins. Klassenwiderspruch, Rassismus und Sexismus" als Text: http://www.idverlag.com/BuchTexte/DreiZuEins/DreiZuEinsViehmann.html