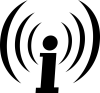Gut, ich gebe es zu: Ich habe die Linken auf dem Kieker. Das liegt allerdings nur daran, dass ich selbst ein Linker bin. Ich will, dass alle Menschen frei und gleich werden. Ich will, dass die Welt besser und gerechter wird. Ich will, dass Rassismus, Sexismus und Nationalismus aus der Welt verschwinden, lieber gestern als morgen. Ich will, dass alle Menschen in Wohlstand leben können. Ich trage also auch das gute alte linke Bedürfnis mit mir herum, die Welt zu verändern. („Wir alle sind Atlanten und tragen die Welt auf den Schultern“, wie Erik gerade dichtete. Nunja, Ayn Rand nicht.) Wie viele meiner Freunde bestätigen können, bin ich auch mindestens so selbstgerecht wie die meisten Linken und habe außerdem einen ebenfalls typisch linken, nervtötenden Spaß daran, andere mit meinen politischen Ansichten zu belästigen. Eigentlich bin ich wahrlich ein Vollblutlinker.
Nun habe ich aber einige Probleme mit meinem Linkssein: Erstens werde ich nur selten als Linker wahrgenommen und anerkannt. Damit kann ich noch leben – ich behaupte einfach wacker weiter, dass ich dazugehöre. Zweitens aber finde ich zunehmend Ansichten und Aussagen von Linken, denen ich nicht nur nicht zustimmen kann, sondern denen ich ganz vehement widersprechen muss – und zwar gerade, weil ich links bin. Eine Einladung an junge Südeuropäer, in Deutschland eine Lehrstelle zu suchen, sei eine „Ohrfeige“ für die deutschen Jugendlichen, die, selbstverständlich, zuerst gefördert werden müssten, meint etwa Sahra Wagenknecht. Der Schweizer Sozialdemokrat Rudolf Strahm glaubt, Personenfreizügigkeit über nationale Grenzen hinweg sei ein „neoliberales und menschenverachtendes Konzept“. Oder nehmen wir die Forderung nach einer erneuerten nationalen „Grenzziehung gegenüber der sogenannten ‚Globalisierung’“, die der Soziologe Wolfgang Streeck erhebt. Und Paul Murphy von der Sozialistischen Partei Irlands, bis zur letzten Wahl Abgeordneter im Europäischen Parlament, befindet: „Gäbe es mehr europafeindliche Abgeordnete, ob von links oder rechts, würde das Parlament weniger Schaden anrichten.“
Diese Aussagen, denen man noch einige hinzufügen könnte, haben ihren gemeinsamen Ursprung in einem Missverständnis: Dass die ärgsten Feinde der Linken nicht Rechte, sondern Liberale wären. Der junge Genosse aus dem Europaparlament etwa freut sich ganz offen über den Zuwachs an Rechtsradikalen und -populisten bei der letzten Europawahl – weil er glaubt, mit ihnen gemeinsam den „ausführenden Arm der neoliberalen Verschwörung gegen Europas Arbeiterklasse“, das EU-Parlament, bekämpfen zu können. Da tut sich also ein Linker mit Rassisten, Nationalisten, Homophoben zusammen, und findet überhaupt nichts dabei. Schlimmer: Wo bleibt der Aufschrei auf der Linken? Denn im #Aufschreien ist sie doch eigentlich gut geübt, jeder baden-württembergische Kommunalpolitiker kann sie auf die Palme bringen. Und hier sitzt einer der Ihren im wichtigsten und mächtigsten Parlament Europas und verbündet sich mit ganz offen nationalistischen Ideologen, und die Linke sagt: nichts.
Mein Verdacht ist: Sie sagt nichts, weil sie das Verhalten des Herrn Murphy in Wahrheit nachvollziehbar und sympathisch findet. Es gibt, spätestens seit 1848, dem Erscheinungsjahr des Kommunistischen Manifests, in der Linken eine ehrwürdige Tradition, Gespenstern hinterherzujagen, und das Gespenst der heutigen Linken ist der „Neoliberalismus“. Zwar lässt sich sicher einiges gegen einen radikalen Marktfundamentalismus einwenden, der allen Ernstes glaubt, der Markt sei die Lösung all unserer Probleme. Man kann auch mit einigem Recht argumentieren, die Politik von Margaret Thatcher und Ronald Reagan habe Schaden angerichtet. Es ist aber etwas ganz anderes, zu behaupten, wir lebten in einer Zeit, in der der „Neoliberalismus“ (was immer das genau sein mag) unsere gesamte Kultur und Politik durchdrungen habe, und die EU sei nur ein weiterer „Agent“ dieser rätselhaften, alles unterwerfenden Macht, gegen die man den Nationalstaat in Stellung bringen müsste.
Ich persönlich glaube ja, dass man der Wirklichkeit der heutigen Welt näher kommt, wenn man sie über Prozesse wie Globalisierung, Differenzierung und Individualisierung beschreibt und die positiven Entwicklungen nicht vergisst, die diese Prozesse beinhalten. Das ist aber hier nicht relevant. Die Linke, will ich sagen, kann den Neoliberalismus durchaus hassen (und analysieren und bekämpfen) – solange sie ihn nicht mehr hasst als Rassismus, Nationalismus und Sexismus, die klassischen rechten Überzeugungen. Die Linke scheint sich aber das neoliberale Gespenst, gegen das sie schattenboxt, als so mächtig vorzustellen, dass sie tendenziell der Meinung ist, sie müsste mit der klassischen Rechten paktieren, um es zu erlegen. Man konnte das, zum Beispiel, gerade in Frankreich beobachten: Arnaud Montebourg, der Führer des linken Flügels der Parti Socialiste und bis dahin Wirtschaftsminister, stellte sich öffentlich gegen den „neoliberalen“ Kurs von Präsident Hollande – nicht ohne darauf hinzuweisen, dass dieser Kurs Frankreich von außen aufgezwungen werde, durch Deutschland und die EU. Diese nationalistische Sündenbockrhetorik kann man exakt so auch bei Marine Le Pen finden.
Die Neigung, den „Neoliberalismus“ zu überhöhen, entspringt letztlich dem schon von Marx formulierten Glauben, dass die Ökonomie die „Basis“, der alles beherrschende Kern von Gesellschaft und Politik sei. Die „Ökonomisierung“ der Gesellschaft, die viele Linke für das angebliche Zeitalter des Neoliberalismus konstatieren, das in den 80er Jahren angebrochen sei, hat insofern weniger mit tatsächlich beobachtbaren Entwicklungen zu tun als mit ihren eigenen theoretischen Vorannahmen: Wer nur nach Ökonomie und Märkten sucht, findet auch nur Ökonomie und Märkte. (Das gilt übrigens ganz ähnlich auch für tatsächlich neoliberale Wirtschaftswissenschaftler wie Gary Becker, die ebenfalls – déformation professionnelle – überall in der Gesellschaft nach Märkten suchten und sie folglich auch fanden. Linke Sozial- und Kulturwissenschaftler untersuchen nun die Werke Beckers und anderer und lesen deren Fehlrepräsentation der Gesellschaft als Hinweis auf eine tatsächliche Ökonomisierung – eine der vielen seltsamen Blüten, die die „Analyse“ des „Neoliberalismus“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften getrieben hat. Don’t get me started.)
Der Schattenkampf der Linken gegen den „Neoliberalismus“ wäre an sich ganz lustig anzusehen – wenn er nicht, ganz real, rechten Kräften in die Hände spielen würde. Denn das Modell Montebourg ist nicht spezifisch französisch. Überall in Europa gewinnen die Rechten mit der Behauptung Stimmen, Globalisierung und Europäisierung unserer Gesellschaften seien zu bekämpfende Übel. In dieser Situation müsste die Linke leidenschaftlich auf der Seite des Internationalismus stehen, für das Globale, die Menschenrechte, Europa und die Überwindung des Nationalstaats eintreten. Stattdessen überzieht sie alles mit einer ätzenden „Kritik“, verfolgt abstruse Verschwörungstheorien und jagt Gespenster. Die Globalisierung ist für sie, genau wie für die Rechte, ein Feind, der von außen kommt und den man bekämpfen muss. Die Menschenrechte sind für sie ein neokoloniales Projekt des Westens. Europa ist für sie „neoliberal“, rassistisch und bellizistisch. Und sie fordert einen starken Staat, der für sie nach wie vor und ohne weitere Reflexion (oft gar mit Emphase) der Nationalstaat ist – anstatt in die Zukunft zu denken, Alternativen zum nationalen Sozialstaat zu suchen, gräbt sie sich im 20. Jahrhundert und damit im vergangenen Jahrtausend ein.
Dieser Nationalismus ist vielleicht das Kernproblem. Dank der Erfolge des nationalen Wohlfahrtsstaats in der Mitte des letzten Jahrhunderts scheint die Linke ihre kosmopolitische Tradition vergessen zu haben. Man muss noch nicht einmal die nationalistischen Exzesse eben jenes Jahrhunderts in Erinnerung rufen, um das für problematisch zu halten. Man kann sich auch einfach vor Augen führen, welche Erfolge die nationale Grenzen perforierenden Entwicklungen unserer Zeit – Globalisierung und Europäisierung – anzubieten haben:
- Wirtschaftliche Fortschritte vor allem in Schwellenländern mit gewaltigen Wohlstandsgewinnen und einem (absoluten, nicht nur relativen) Abbau globaler Armut.
- Transnationale Migrationsbewegungen, die die Vielfalt und den Wohlstand aller Gesellschaften voranbringen.
- Globale Kommunikationsnetze.
- Offene Grenzen in Europa. So beschämend und empörend die Vorgänge an den EU-Außengrenzen sind – jeder abgebaute Schlagbaum ist ein Fortschritt in einer Welt, die allen Ernstes in künstlich festgelegte Flächen eingeteilt ist, an deren Grenzpfosten für viele Menschen die Bewegungsfreiheit endet.
- Der Aufbau einer supranationalen Demokratie in Europa, ein Modell, das in der Tat, sollte es funktionieren, als Vorbild für andere Weltregionen dienen kann, weil es Konflikte verhindert und moderiert und leistungsfähige Politiken gegenüber globalen Prozessen ermöglicht, ohne auf demokratische Legitimation und Repräsentation zu verzichten.
- Ganz persönlich: Wie viele Freunde, Bekannte, Kollegen habt ihr, die aus anderen Ländern stammen? Wie viele hatten eure Großeltern oder Eltern? Würdet ihr auf diese Menschen verzichten wollen? Nein? Dann solltet ihr auch auf die Globalisierung nicht verzichten wollen.
Man kann und sollte sicher verschiedene Aspekte der Globalisierung kritisch hinterfragen. Aber jemand, der ernsthaft gegen Nationalismus ist (und viele Linke reklamieren das trotz allem für sich), kann nicht gleichzeitig gegen die Globalisierung sein. Es gibt zwei Varianten, wie Linke mit diesem Widerspruch umgehen: Entweder ignorieren sie ihn. Das ist die „kritische“ Variante, die sich auf eine linke Tradition berufen kann, derzufolge es, warum auch immer, Sinn macht, schlechterdings alles zu kritisieren, was einem vor die Flinte läuft. Man kann das, wenn man will, von Adornos „negativer Dialektik“ herleiten, die von vornherein und sowieso alles schlimm findet und sich deshalb um positive Alternativen nicht zu kümmern braucht. Man kann so ganz wunderbar gleichzeitig gegen Nationalismus, Globalisierung und überhaupt alles sein und dabei ein reines Gewissen bewahren, ohne die Welt auch nur das kleinste Stück vorangebracht zu haben.
Die zweite Variante: Man konvertiert (oder bekennt sich) ganz offen zum Nationalismus. Man findet diese Version vor allem bei männlichen, älteren und entsprechend etablierten Intellektuellen. Diese altlinken Grummelopas sehnen sich nach den 50er und 60er Jahren zurück, ihrer Jugendzeit, in der der nationale Wohlfahrtsstaaat seine großen Erfolge feierte. Nehmen wir zum Beispiel Wolfgang Streeck, den oben bereits einmal zitierten Leiter des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, der in seinem 2013 veröffentlichten Buch Gekaufte Zeit zu dem Schluss kommt, dass man den Nationalstaat gegen die von ihm sogenannte „sogenannte ‚Globalisierung’“ in Stellung bringen müsse: „Im Westeuropa von heute ist nicht mehr der Nationalismus die größte Gefahr, schon gar nicht der deutsche, sondern der Hayekianische Marktliberalismus.“ (Siehe nämlich Front National, UKIP, SVP, FPÖ, AfD… Und warum eigentlich nur Westeuropa?)
Womit wir auch schon wieder beim Liberalismus wären. Denn wie gesagt: Die seltsame Rechtsneigung der Linken resultiert nicht zuletzt aus ihrer übertriebenen Abneigung gegen den Liberalismus. (Und, leider, auch aus der seltsamen Rechtsneigung von „Liberalen“ wie eben Hayek, Friedman oder auch Westerwelle. Der Verrat des real existierenden Neoliberalismus durch seinen Pakt mit den Konservativen wäre eine eigene Polemik wert.) Die Linken müssen keinesfalls alle Positionen des Liberalismus, schon gar nicht des Neoliberalismus, übernehmen, sonst wären sie keine Linken mehr. Sie sollten aber den Gegner unmissverständlich auf der Rechten suchen. Dabei würden sie zahlreiche Ziele entdecken, die sie mit Liberalen gemeinsam haben: Freiheit und Wohlstand für alle. Mitbestimmung, Demokratie, Emanzipation.
Um Lenins Frage aufzunehmen: Was tun? – Die Linke muss sich von der konservativen Rechten und insbesondere ihrem traditionellen Nationalismus abwenden. Sie sollte sich auch vom Marxschen Ökonomismus lossagen, der in der Ökonomie, im Kapitalismus oder nun im Neoliberalismus die Wurzel allen Übels erkennen will, und einsehen, dass wir, wenn wir die Welt verändern wollen, zunächst einmal die Einstellungen derer ändern müssen, die das „Fremde“ ablehnen und verabscheuen. Sie muss sich endlich in ein konstruktives Gespräch über die Globalisierung einklinken, ein Nachdenken nach vorne beginnen, anstatt weiter die Vergangenheit zu idealisieren. Sie muss Konzepte entwickeln, wie die beiden großen historischen Leistungen des Nationalstaats – Demokratie und allgemeine Wohlfahrt – auch in einer globalisierten, von nationalen Grenzen so weit wie möglich befreiten Welt bewahrt werden können. Ganz konkret muss sie sich heute gegen den nationalistischen Backlash stellen, der das bisher auf dem Weg zu einer offenen, freien und gleichen Welt Erreichte umkehren und zerstören will. Mit anderen Worten: Sie muss sich selbst wiederfinden.