Zum (Miss-)Verhältnis von Postmoderne und der Neuen Rechten
Von Ludwig Decke
Während postmoderne Theorien seit den 1980er Jahren in der Linken für eine anhaltende Diskussion sorgen, scheint sich auf der anderen Seite des politischen Spektrums ein eindeutigeres Bild abzuzeichnen. Innerhalb der Neuen Rechten, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Alternative zum etablierten rechtsextremen Lager herausgebildet hat, scheint „postmodern“ meist als Chiffre für Chaos und Auflösung, für den vom politischen Gegner verantworteten Angriff auf tradierte Werte wie Volk, Staat und Nation zu stehen. So bringt die Formel „Postmoderne = Dekonstruktion von Identität“, wie sie in der neurechten Jugendzeitschrift Blaue Narzisse aufgestellt wird, die verbreitete Abneigung gegen den Begriff und die mit ihm assoziierten Phänomene auf den Punkt.
Umso verwunderlicher ist es daher, dass einer der wichtigsten Köpfe jener Denkrichtung, der Schweizer Publizist und Schriftsteller Armin Mohler, ein gänzlich anderes Verhältnis zur Postmoderne pflegte. Mohler brachte sich Anfang der 1950er Jahre durch die paradoxe Wortschöpfung „Konservative Revolution“ ins Gespräch, mit der er ein rechtskonservatives Lager vom Nationalsozialismus abzugrenzen versuchte, um damit der Renaissance einer extremen Rechten den Weg zu bereiten. Als – bis heute – intellektueller Leitstern der Szene blieben ihm die Entwicklungen innerhalb der französischen Philosophie nicht verborgen, die seit Ende der 1960er Jahre Pfade jenseits des klassischen Marxismus einschlug und in Deutschland diskreditierte Autoren wie Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger zu neuer Popularität verhalfen. So begegnete ihm auch das Phänomen der Postmoderne, mit dem er sich in einem 1986 erschienenen Artikel in der Zeitschrift Criticón, dem damaligen Zentralorgan des Rechtskonservatismus, ausführlich auseinandersetzte.
Mohler unternimmt mit seinem Essay den Versuch, postmoderne Theorien für die Neue Rechte nutzbar machen. „Die Postmoderne hat uns wirklich etwas zu bieten“, schreibt er, „etwas, was uns fehlt, was uns fruchtbar ergänzt.“ Er fordert seine Leserschaft dazu auf, den dazugehörigen Autoren die Arme zu öffnen. Der Grund für diese wohlwollende Bewertung liegt in der angenommenen Verwandtschaft zu seinem eigenen Schaffen. Die postmodernen Theorien seien die legitimen Erben der „Konservativen Revolution“, man teile die Ablehnung der Moderne. Laut Mohler liegt der bestimmende Wesenszug der Moderne in ihrem Bekenntnis zum Universalismus, zum uneingeschränkten Recht der Individuen auf Freiheit und Emanzipation – eine Ideologie, die mitunter durch
missionarischen Sendungseifer verbreitet wurde.
Das Verdienst der „Konservativen Revolution“ sei es demgegenüber gewesen, jene Versprechen als leere Hüllen entlarvt zu haben und anstelle eines die Wirklichkeit leugnenden Egalitarismus zu einer „realistischen“ Sicht auf den Menschen vorgestoßen zu sein. Damit sieht sich Mohler in einer Linie mit Ernst Jünger, einem „konservativen Revolutionär“ par excellence. Wenn Jünger jeder allgemeinen Wahrheit, jeder universellen Moral eine Absage erteilt, wenn er in Das abenteuerliche Herz die Humanität als Produkt der Aufklärung des selbstzerstörerischen Versuchs bezichtigt, „in jedem Buschmann eher den Menschen anzuerkennen als in uns“, dann ließ dies auch das Herz eines Mohlers höherschlagen.
In der Postmoderne will Mohler nun jenen antiaufklärerischen Impuls wiedererkennen, den seine eigene politische Agenda auszeichnet. Am Beispiel Gerd Bergfleths, Alt-68er und bis heute tätiges Sprachrohr völkischen Geraunes, lobt er den unorthodoxen Habitus und die Ausrichtung am Leben, die den postmodernen Theoretikern innewohnen würden. Dadurch gelänge es ihr – sogar besser als aktuell dem Konservatismus – „in erstickender Atmosphäre Luft und neue Bewegungsfreiheit“ für eine rechte Programmatik zu erlangen. Die Formel, die Mohler vorschlägt, lautet also sinngemäß „Postmoderne = Dekonstruktion von Aufklärung“ – und damit Wiedergewinnung von Identität. Dass es Denkern wie Michel Foucault oder Jacques Derrida in Wahrheit eher um eine Aufklärung über die Aufklärung ging und sich jene in ihrer Stoßrichtung dem Projekt einer emanzipatorischen Linken verschrieben hatten – das dem der Kritischen Theorie nicht unähnlich war –, bleibt freilich unerwähnt.
Auch wenn man Mohlers Auseinandersetzung mit der begrifflichen Herkunft und den theoretischen Grundlagen seines Gegenstands zurecht eine einseitige Vereinnahmung vorwerfen kann: Sein Versuch, postmoderne Leitsprüche mit den Zielen der Neuen Rechten zu vereinen, wirft trotz des fragwürdigen Interpretationsversuchs ein Schlaglicht auf die Postmoderne selbst. Es drängt sich die Frage auf, ob schon im Kern der Theorie die Möglichkeit ihrer Vereinnahmung von rechts angelegt ist.
Um diesem Problem nachzugehen, bietet es sich an, einen Blick auf das „Gründungsdokument“ jener philosophischen Gemengelage zu werfen. Die Rede von der Postmoderne nahm mit der Schrift Das postmoderne Wissen von Jean-François Lyotard zu Beginn der 1980er Jahre ihren Ausgang. Als Analyse der zeitgenössischen Informationsgesellschaft konzipiert, versucht das Werk die Legitimation von Wissen in Abgrenzung zu bisherigen, „modernen“ Begründungsversuchen zu beschreiben. Lyotard operiert dabei mit einem Wissensbegriff, der sich nicht auf bloße wissenschaftliche Erkenntnis reduzieren lässt.
Wissen bedeutet für ihn nicht nur die Einsicht in die Wahrheit eines Sachverhalts, sondern bezeichnet ganz allgemein die Fähigkeit zu „guten“ Performanzen, wozu neben dem guten – also richtigen – Erkennen auch gutes Handeln, Entscheiden, Bewerten etc. gehören. Diese zweite Form des Wissens, die wie die der Wissenschaft einer eigenen Gesetzmäßigkeit folgt, hängt dabei stets mit „Gewohnheit“ zusammen, verstanden als Konsens der Wissenden untereinander, die sich über die Kriterien der entsprechenden Kompetenzen – Wahrheit, Gerechtigkeit, Effizienz, Schönheit – verständigt haben. Solch ein traditionelles Wissen muss im Gegensatz zur Wissenschaft dabei stets „Meinung“ bleiben.
Seine charakteristische Form ist die der Narration, der Mythen und Legenden. Die Funktion dieses Wissens liegt letztlich darin, durch die Überlieferung von Gewohnheitsregeln Selbstvergewisserung zu erhalten. Erzählungen würden im Gegensatz zur Wissenschaft daher keiner Rechtfertigung bedürfen: „So bestimmen sie, was in der Kultur das Recht hat, gesagt und gemacht zu werden, und da sie selbst einen Teil von ihr ausmachen, werden sie eben dadurch legitimiert.“ Da es sich bei beiden Formen des Wissens – dem wissenschaftlichem und dem narrativen – jeweils um eine Menge von Aussagen, um Sprachspiele handelt, die nach jeweils eigenen Regeln funktionieren, gilt gegenwärtig, so Lyotard, keine der anderen als praktisch überlegen. Man könnte daraus nun schlussfolgern, dass volkstümliche Meinung und wissenschaftliche Erkenntnis dadurch dieselbe Berechtigung haben. Das ist jedoch nicht Lyotards Anliegen, als missverständliche Deutung allerdings möglich. Für eine solche Interpretation muss man die Form seiner als Bericht konzipierten Schrift, also den deskriptiven Zugang, mit einer akzeptierenden Wertung verwechseln – und einige Passagen des Textes überlesen.
An den Gegensatz von wissenschaftlichem und narrativem Wissen anknüpfend stellt Lyotard fest, dass sich ersteres immer schon durch sein Gegenteil legitimieren muss: „Das wissenschaftliche Wissen kann weder wissen noch wissen lassen, dass es das wahre Wissen ist, ohne auf das andere Wissen – die Erzählung – zurückzugreifen, das ihm das Nicht-Wissen ist; andernfalls ist es gezwungen, sich selbst vorauszusetzen.“ Die Moderne sieht er dadurch charakterisiert, dass das Wissen seine Legitimation entweder – als Selbstzweck – aus der Erzählung des spekulativen Geistes auf dem Weg seiner Selbstverwirklichung bezieht (Idealismus), oder – als Mittel zum Zweck der Freiheit – aus einer Erzählung, die die Emanzipation der Menschen zum Gegenstand hat. Hinsichtlich des zweiten Falls stand Wissenschaft damit im Zeichen eines ethisch-politischen Ziels, das von der Aufklärung vorgegeben war. Dieses Modell finde sich auch im kritischen Marxismus wieder, den Lyotard etwa der Frankfurter Schule zuschrieb: Hier bestehe „die ganze Berechtigung der Wissenschaft darin […], dem empirischen Subjekt (dem Proletariat) die Mittel für seine Emanzipation von der Entfremdung und Repression zu geben“ – eine Perspektive, der ungeteilte Sympathie zukommen sollte, möchte man meinen.
Lyotard beschreibt dagegen, dass im Wissenskonzert der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Dinge anders stehen. Die emanzipatorische Erzählung und ihr spekulatives Pendant hätten in der postmodernen Gegenwart jegliche Glaubwürdigkeit verloren, da sie einerseits durch den Siegeszug von Technik und Kapitalismus irrelevant geworden seien; andererseits sei in der Verbindung von Wahrheit und Gerechtigkeit, wie sie das Wissen im Zeichen der Humanität verfolgt, selbst schon ein Widerspruch angelegt. Die Postmoderne habe, so Lyotard, der Wissenschaft „die raue Nüchternheit des Realismus gelehrt“. Das Ziel der fortschrittsoptimistischen Aufklärung, mit Vernunft eine freie, humane Welt zu erschaffen, wird damit zum realitätsfernen Märchen.
Daraus wird eine Kontur dessen deutlich, was unter Postmoderne gern verstanden wird: Statt Kritik der Aufklärung bzw. Aufklärung über die Aufklärung zu sein, lässt sie sich als vergleichsweise plumpen Angriff auf den Universalismus deuten. In der postmodernen Welt stehen sich unzählige Narrative und Meinungen gegenüber, die nicht mehr miteinander durch eine übergeordnete Instanz, die Vernunft, verbunden sind. Somit ist es nur folgerichtig, dass Lyotard den Gedanken von Kommunikation, so wie er von Habermas gedacht wird, als hoffnungslos romantisch ablehnt und stattdessen auf den agonalen Charakter des Sprachspiels, den Kampf, verweist.
Lyotard verspricht sich von der Heterogenität der Sprachspiele – und hier wird seine Zielsetzung deutlich, die sich von einer identitären Programmatik grundlegend unterscheidet –, dass mit ihnen das Inkommensurable zu seinem Recht komme, das sich zuvor unter dem Diktat der Aufklärung fügen musste. Gleichwohl, und das ist meines Erachtens der wunde Punkt seiner Theorie, vermag diese Perspektive einem Relativismus die Tore zu öffnen, der jede Kultur zu ihrem eigenen Referenzsystem erklärt, weil selbst die inhumanste Praxis nicht im Namen eines höheren Prinzips infrage gestellt werden kann. Wer also den ethischen Imperativ des Inkommensurablen (oder des Unvernehmens, wie es Jacques Ranciére später nennen wird) nicht versteht, kann eine Linie zu Ideen ziehen, die Lyotard selbst gewiss nicht im Sinn hatte.
Die Idee des Universalismus ist somit der Gegner, der eine falsch verstandene Postmoderne und die Neue Rechte verbindet. Dass letztere die antiaufklärerischen Prämissen der postmodernen Theorie teilt, zeigt sich insbesondere im Konzept des Ethnopluralismus, einem der zentralen Begriffe neurechter Ideologen. Jenes Konzept geht von der Existenz verschiedener Völker aus, deren unterschiedliche, naturgegebene oder historisch gewachsene Werte und Eigenschaften ein jeweils in sich hermetisch abgeschlossenes System bilden, das prinzipiell nicht vermittelbar ist.
Wichtig ist hierbei, dass Anhänger dieser Theorie für gewöhnlich Abstand von rassistischen Argumentationen nehmen, wie sie von Nazis der alten Schule propagiert werden, sondern von der prinzipiellen Gleichberechtigung jedes Volkes ausgehen – solange es in seinem angestammten Raum bleibt. Das größte Verbrechen aus dieser Sicht besteht demnach in der Vermischung verschiedener Kulturen, etwa durch Immigration, da dies zum Verlust von Identität führen würde. Nichts liegt diesem Gedanken daher ferner als ein universalistisches Verständnis von „Menschheit“; vielmehr sind es gerade die Versprechen der Menschenrechte, die im Fadenkreuz der Kritik stehen. Diese werden meist als „egalitaristischer Totalitarismus“ wahrgenommen, mit denen die ganze Welt in eine liberal-humanistische Diktatur gezwungen werden soll – wobei naturgemäß die USA als federführende Macht hinter alldem angesehen werden.
Will man das „Neue“ der Neuen Rechten verstehen, so reicht es wie schon bei der „Konservativen Revolution“ Armin Mohlers nicht aus, jene politische Strömung als rein klassisches, antimodernes Projekt der extremen Rechten zu interpretieren. Es handelt sich vielmehr um den Versuch, die Moderne samt ihrer Werte hinter sich zu lassen und zu einer Utopie fortzuschreiten, die rechte Inhalte mit der modernen Verfassung der Welt versöhnt. So will der russische Publizist Alexander Dugin, seines Zeichens Chefideologe der Identitären Bewegung und Propagandist einer „Vierten Politischen Theorie“, seinen Kampf gegen die Moderne explizit in postmodernem Gewand führen.
Und in einem Manifest der französischen Nouvelle Droit aus dem Jahr 2000 heißt es treffend: „Die Moderne wird nicht durch die Rückkehr in die Vergangenheit überschritten, sondern durch einen Rekurs auf gewisse vormoderne Werte in einer entscheidend postmodernen Dimension.“ Ein Bewusstsein für die missverstandene Postmoderne und deren Schnittstellen zur Neuen Rechten helfen also, letztere in ihrer Eigenheit – und damit auch in ihrer Brisanz – zu begreifen. Gleichzeitig braucht es linke Theoriearbeit, um nicht einfach einen Begriff zu kolportieren, der zur Queerfront gegen die Moderne benutzt wird.
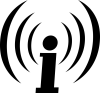

etwas unvollständig
Was hier ganz fehlt ist die Bestimmung der Moderne als technisch-ökonomisches System in dem der Mensch von der Eigendynamik des Systems bestimmt wird. Diese Moderne zu überwinden ist seit jeher Ziel von Links und Rechts. Die Postmoderne war da auch kein wirklicher Fortschritt.
Was du thematisierst ist im Wesentlichen der Kampf der Menschen gegeneinander innerhalb der Grenzen des Gesamtsystems. Überwindung hiesse aber, dass der Mensch wieder Herrschaft über das System erlangt statt nur in seinen Zwängen zu leben. Unsere Lebensformen sind nämlich v.a. durch technisch-ökonomische Notwendigkeiten beschränkt: d.h. das Leben der Menschen ist in allen modernen Gesellschaften im Wesentlichen gleich, egal ob diese kommunistisch, autokratisch und demokratisch regiert werden.