An den Gestaden des Logos: Die Wissenschaften und das Tier. Während wir uns im ersten Teil unseres Features „Wann ist das Tier ein Mensch?“ dem gewagten Versuch verschrieben haben, in einem kurzen Überblick mehr als 2500 Jahre europäisch-abendländischer Philosophiegeschichte unter dem Gesichtspunkt des daraus entstehenden Anthropozentrismus zu betrachten, sollen die nächsten Teile des Essays den Fokus auf die Wissenschaften richten. Dabei soll das Werden, Bestehen und die Dekonstruktion des Mensch-Tier-Verhältnisses in der modernen Gesellschaft nachgezeichnet werden.
Wann ist das Tier ein Mensch? Teil II: An den Gestaden des Logos: Die Wissenschaften und das Tier.
Während wir uns im ersten Teil unseres Features „Wann ist das Tier ein Mensch?“ dem gewagten Versuch verschrieben haben, in einem kurzen Überblick mehr als 2500 Jahre europäisch-abendländischer Philosophiegeschichte unter dem Gesichtspunkt des daraus entstehenden Anthropozentrismus zu betrachten, sollen die nächsten Teile des Essays den Fokus auf die Wissenschaften richten. Dabei soll das Werden, Bestehen und die Dekonstruktion des Mensch-Tier-Verhältnisses in der modernen Gesellschaft nachgezeichnet werden.
Wir widmen uns also der Frage, welche Erkenntnisse zum nicht-menschlichen Tier, zum Menschen, zu ihrem Verhältnis und zur Gesellschaft, in der sie leben, durch naturwissenschaftliche, psychologische, soziologische und historische Disziplinen erzielt wurden. Wir fragen, welche Auswirkungen diese hatten und inwieweit diese Erkenntnisse zu Konsequenzen innerhalb und außerhalb der jeweiligen Disziplinen geführt haben.
Im heutigen Feature richtet sich unser Blick damit auf die Naturwissenschaften und wie sich in den Naturwissenschaften der Blick auf das Mensch-Tierverhältnis richtet.
1. Die naturwissenschaftliche Revolution in der frühen Neuzeit Europas: Emanzipation der Naturwissenschaften und der Balken im Auge der Erkenntnis.
Etwa ab dem 16. Jhdt. beginnt in Europa eine Auseinandersetzung mit der Natur, die sich von der bisherigen Praxis unterscheidet. Viele naturwissenschaftliche Werke – zum Bsp. die von Kepler, Bacon und Galilei- fügen in die Titel ihrer Werke den Begriff „neu“ ein. Dies ist ein Unterschied zu bisherigen Titelgebungen, die sich sonst immer auf vorhergehende Schriften bezogen, es ist eine Veränderung der Methodik sowie des Verhältnisses zur Wissenschaft: Die immer gleichen Verweise auf die schon geschriebenen Bücher und der damit rekursive Prozess des Zitierens und Interpretierens alter Werke wird als unbefriedigend empfunden. Die Gelehrten der Zeit wollen ihren Blick nicht mehr nur in die Bücher, sondern vor allem auf und in die sie umgebende Welt richten.
Wesentlichen Einfluss auf die neue Methodik hatten v.a. zwei Männer: Francis Bacon und Rene Descartes.
Francis Bacon hebt in seinem Buch Novum Organum scientiarum aus dem Jahre 1620 vor allem die Methode der Empirie hervor. Er spricht sich darin gegen die bisherige Perspektive aus, alles Wissen wäre bereits bei antiken Philosophen wie Aristoteles und in der Bibel zu finden.
Die Entwicklung menschlichen Wissens als einen Sammelprozess beschreibend, erkennt er auch dessen Schwächen und arbeitet heraus, wie unsere Wahrnehmung durch unsere Vorurteile getrübt und geschwächt werden kann.
Descartes hingegen legt durch sein Buch Discourse de la methode (1637) den Grundstein für eine rationalistisch-mathematische Methode als Mittel richtigen Vernunftgebrauchs und wissenschaftlicher Wahrheitsfindung. Erkenntnisse über die Natur der physikalischen Welt wurden nun über die rationale Beobachtung der Natur mit mathematischen Mitteln erzielt. Damit wird Naturwissenschaft beschrieben als ein in sich begründeter und begründbarer rationaler Prozess, als unabhängig von sozialen, kulturellen und historischen Gegebenheiten und als rational gesteuert.
Ab dem 16. Jhdt. verbreitete sich diese Methode der Weltbetrachtung und wurde zu einer nicht mehr weiter hinterfragten Selbstverständlichkeit. In dieser Atmosphäre der Befreiung von alten Denkzwängen und des geistigen Aus- und Aufbruchs etabliert sich neben den Disziplinen der Mathematik, der Astronomie und der Physik auch gerade die Biologie. Durch den Versuch die Natur nicht metaphysisch, sondern rational zu beschreiben wird sie zu einer wissenschaftlichen Instanz.
Da die vernunft- und methodengeleitete Herangehensweise als eines der wichtigsten Instrumente rationaler Wissenschaft betrachtet wurde, stand für die Biologie das 17. und 18. Jhdt. primär im Zeichen der Klassifikation, Bennenung und Ordnung von Flora und Fauna.
Die erste biologische Klassifikation der Organismen wurde im Jahr 1735 – mehr als 100 Jahre vor der Evolutionstheorie Darwins – von Carl von Linné vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine hierarchische Einteilung von Tieren in Stämme, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten. Alle diese Kategorien haben noch zusätzliche Subkategorien (zum Bsp. hat die Kategorie Art auch die Subkategorie Rasse). Dabei hielt Linné die biologischen Arten für unveränderliche Teile einer Schöpfungsordnung, weshalb der Mensch in diese Klassifikation zunächst nicht aufgenommen, bzw. erst 1766 in der zwölften Auflage seines Buches Systema naturae erwähnt wird.
Trotz aller methodischer Strenge und Rationalität zeigt sich also auch bei Linné eine noch bis in die Gegenwart gültige Definition des Menschen als das Maß aller Dinge im aristotelischen Sinne und als Krone der Schöpfung in der biblischen Diktion. Der Mensch war und ist gottesgleich, er erhebt sich über den Stammbaum als seine eigene Schöpfung und transzendiert sich von diesem.
1859 veröffentlicht Darwin „On the origin of species“. Seine Darstellung der Evolution als ein Mechanismus kleinster individueller Abweichungen, die sich auf das Überleben eines Individuums auswirken und über große Zeiträume zu einer Veränderung der Form und Gestalt eines Tieres führen können, hat eine der ersten und grundlegendsten Enttäuschungen des Menschen und seines Menschenbildes zur Folge. Deutlich wird dies schon in einer sehr frühen Skizze Darwins, die er in seinem Notebook B – einem seiner vielen Notizbücher – noch im Sommer 1838 fest hielt. Zu sehen ist ein Stammbaum, der sich von allen bisherigen Stammbäumen seiner Zeit deutlich unterscheidet. Dieser Stammbaum ist radikal unregelmäßig und es gibt abgestorbene Äste. Die Entwicklung ist ein völlig ungeordneter und diskontinuierlicher Prozess. Jene Arten, die heute ganz oben auf dem Stammbaum erscheinen, sind ein Produkt des Zufalls und nicht das Produkt eines großen Plans. Das Prinzip der natürlichen Auslese folgt keinem schöpferischen Plan.
Dennoch kommt der Mensch in Darwins Werk On the origin of species nur mit einer kleinen – wenn auch ahnungsvollen Randbemerkung vor: „Licht wird auf den Ursprung der Menschheit und ihre Geschichte fallen.“
1871 erst erfolgt die Publikation die Abstammung des Menschen. Im Vorwort dieser Publikation gibt Darwin an, er habe in „On the origin of species“ einen Fehler gemacht, er habe zuviel Gewicht auf die natürliche Auslese gelegt, stattdessen sei die sexuelle Auslese ebenfalls bedeutend und beschreibt die sexuelle Selektion als einen Kulturprozess der ästhetische Aspekte beinhaltet. Es findet eine Wahl nach ästhetischen Kriterien statt. Als Bsp. wählt Darwin die Zeichnung des Gefieders einer bestimmten Fasanenart. Die nahezu perfekte Kugelform in der Zeichnung des Gefieders des Männchens wirkt attraktiv auf das Weibchen und das Weibchen wählt nach ästhetischen Gesichtspunkten das Männchen aus. Dies ist ein evolutionärer Zeichenprozess, der dazu führt, dass sich auch die Zeichnung immer weiter wandelt, dass die Zeichen sich wandeln.
Im deutschen Sprachraum zeigte sich in Bezug auf Darwins Evolutionstheorie eine Fixierung auf den Kampf ums Überleben. Darwin aber verstand unter dem Begriff „struggle“ nicht in erster Linie einen Kampf, sondern eher ein Ringen, eine Auseinandersetzung mit der Natur. Darwin geht davon aus, dass der evolutionäre Vorteil des Menschen seine Schwäche sei, da nur durch eine schwache Form so etwas wie Intellekt und die kognitiven Fähigkeiten des Menschen entstehen konnten. Der Mensch musste aufgrund seiner Schwäche kooperieren, sich in sozialen Gemeinschaften arrangieren, daraus entwickelt sich eine Art Anerkennung des Anderen. Der schwache Mensch weiß, dass er für sein Überleben von dieser Gruppe abhängig ist. Und da er ein entwickeltes Gehirn und eine Sprache hat, hat sich in Form der Entstehung eines Gewissens so etwas wie Moralfähigkeit entwickelt, die laut Darwin etwas für den Menschen Spezifisches sei. Die genealogische Wurzel der Moralfähigkeit ist also die menschliche Schwäche.
Darwin spricht sich sehr entschieden dagegen aus, seine Evolutionstheorie als Fortschrittstheorie zu bezeichnen, es gibt keinen großen Plan, kein Ziel der Entwicklung, es ist der Zufall, der regiert. Für Darwin ist ein Säugetier nicht fortschrittlicher als ein Vogel. Ein Vogel ist einfach nur anders organisiert, um an seine spezifischen Umstände angepasst zu sein. In Darwins Vorstellung ist der Mensch eben nicht die Krone der Schöpfung. In einem weiteren seiner Notizbücher findet sich eine Zeichnung des Stammbaums der Primaten, in dem der Mensch ein Zweig ist, jedoch keineswegs an der Spitze. Doch während auf der einen Seite die Erkenntnisse und der stringente Aufbau von Darwins Evolutions-Theorie die Wissenschaftlergemeinde überzeugen, bleibt die Wiedereingliederung des Menschen unter all jene Lebewesen, die er sich zuvor Untertan gemacht hat, eine Kränkung, die sich allen rationalen Argumenten entziehend bis zum heutigen Tag für emotionsgeladene und empörte Diskussionen sorgt.
Aber auch wissenschaftliche Interpretationen der Thesen Darwins sind geprägt von der anthropozentrischen Perspektive: Und der Balken im Auge des menschlichen Beobachters führt zu jenen sozialdarwinistischen Entwicklungen, die eine Restaurierung des Menschen als Krone der Schöpfung anstreben. So stellt der Biologe Ernst Haeckel den Stammbaum der Evolution als deutsche Eiche dar. Die teleologische Betrachtung der Evolution beruht auf der speziesistischen Selbstüberschätzung des Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts. Aus dieser Betrachtung heraus entstand auch das Prinzip der Eugenik sowie die Vorstellung, dass sich Arten und Rassen in einem andauernden Existenzkampf befänden, den nur die beste Art oder Rasse gewinnen kann.
Nach dem Anthropologen und Juristen Steven Wise werden Postulate, die in der Evolution eine Hierarchie der Höherwertigkeit sehen, immer von Individuen oder Gruppen propagiert, die sich selbst dabei an der Spitze dieser Hierarchie sehen.
Nicht nur für Darwin steht fest, dass die Evolutionstheorie keine hierarchische Bewertung in höhere oder niedere Lebewesen zulässt. Das Gros der Evolutionsbiolog_innen geht davon aus, dass die Vorstellung einer linearen Höherentwicklung wissenschaftlich keinen Sinn ergibt.
Dieser Argumentation folgend, kommt Martin Balluch in seinem Buch „Die Kontinuität des Bewusstseins“ zu dem Schluss, dass
die Evolution Diversifikation und Ausdifferenzierung produziere, kein Baum mit einer Krone sei, sondern ein Netzwerk ohne Hierarchie. Wesen mit mehr oder weniger Komplexität in diesem Netzwerk nicht höher oder niederer, besser oder schlechter seien und nicht mehr oder weniger von der Selektion begünstigt werden.“
Wie wenig derlei naturwissenschaftliche Erkenntnisse Einfluss auf andere Subsysteme der Gesellschaft haben, ja noch nicht einmal ein Umdenken in der Wissenschaft selbst hervorrufen, zeigt sich gerade, wenn wir noch einmal den Blick auf den Stammbaum des Menschen werfen. Nach der Klassifikation von Linné gehört der Mensch zum Stamm der Chordatiere, im Unterstamm der Wirbeltiere, zu der Klasse der Säugetiere, in der Ordnung der Primaten, in der Überfamilie der Menschenähnlichen (Hominoidea), zu der Familie der großen Menschenaffen. Die Familie wiederum teilt sich auf in: Orang Utan und afrikanische große Menschenaffen.
Diese Ordnung ist jüngsten Datums, denn noch bis vor kurzem wurde der Mensch nicht zu den Menschenaffen gezählt. Neueste Genomanalysen haben aber eindeutig ergeben, dass der Schimpanse und der Bonobo am nächsten zum Menschen verwandt sind. Mensch und Affe zeigen eine genetische Übereinstimmung von 98,4%. Mit anderen Worten: Der nächste Verwandte der Schimpansen und der Bonobos ist nicht der Orang Utan und auch nicht der Gorilla, sondern der Mensch.
Die Soziologie der Wissenschaft: Oder weshalb das Tier kein Mensch sein darf!
Nicht nur die verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tiere sind es, die nicht oder nur zaghaft eine Revision im Spiegel der Wissenschaft erfahren. Auch in der Frage, welche Eigenschaften und Fähigkeiten nichtmenschlichen Tieren zugesprochen werden können, finden fast täglich Pressemitteilungen von Studien ihren Weg in die Massenmedien, die zu dem Ergebnis kommen, dass nichtmenschliche Tiere durchaus über so genannte menschliche Fähigkeiten verfügen. Zugleich wird deutlich, dass diese Erkenntnisse trotzdem keinerlei Rückwirkung auf die Wissenschaft selbst und ihre Methoden haben.
Die Frage, die sich stellt ist: woran liegt das? Die Antwort darauf kann mit einem Bonmot des Soziologen und Systemtheoretikers Niklas Luhmann gegeben werden: „Kultur verhindert (…), die Überlegung, was man anstelle des Gewohnten anders machen könnte.“ Auch die Naturwissenschaften als Subsystem der Gesellschaft sind eingebunden in eine kulturelle Entwicklung, deren Quellen sich, wie die Politik, die Kunst und die Jurisprudenz aus der abendländischen Antike ableiten lassen. Wie wir gesehen haben, handelt es sich bei den wissenschaftlichen Disziplinen um Emanzipationsbestrebungen, sich der Umklammerung der Übermutter Philosophie zu entwinden und sich neue und andere Methoden der Wahrnehmung und der Erkenntnis anzueignen. Doch gab es bei der Lossagung der Wissenschaften von der Philosophie nicht einen vollständigen Bruch oder totalen Paradigmenwechsel: Letztendlich wurden viele Vorannahmen und Erkenntnisse philosophischer Prägung, eine ganze Kultur der Wertvorstellungen, schlicht tradiert und a priori angenommen. So auch die Selbstverständlichkeit eines Mensch-Tier-Dualismus. Die Naturwissenschaften des 18., 19. und 20. Jahrhunderts wollen den Mensch-Tier-Dualismus beweisen und setzen ihn dabei in ihren Untersuchungen voraus. Dabei handelt es sich allerdings um einen jener logischen Fehler vor denen Francis Bacon gewarnt hat: man kann nicht etwas beweisen, was man schon voraussetzt.
Diese Paradoxie führt dazu, dass bis in die Gegenwart die naturwissenschaftlichen Enttäuschungen und Diskreditierungen der menschlichen Hybris sich mehren, dass also all jene Eigenschaften, die bislang als Alleinstellungsmerkmal des Menschen hervorgehoben wurden, auch bei nichtmenschlichen Tieren zu finden sind – dazu zählen unter anderem Bewusstsein, Kognition, Sprache, Werkzeuggebrauch, Empathie, Sozialverhalten und Kulturfähigkeit. Und doch sind die Rückwirkungen dieser Erkenntnisse auf die Wissenschaft und die Gesellschaft so gering.
Weshalb es keine Rückwirkung in die jeweiligen naturwissenschaftlichen Disziplinen gibt, kann auch mit den Überlegungen des Wissenschaftstheoretikers Thomas Kuhn erklärt werden: Kuhn postulierte, dass in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen die Tendenz besteht, innerhalb bestimmter Paradigmen zu forschen. Wissenschaftler sind also in erster Linie bestrebt die einem bestimmten Forschungsfeld zugrundeliegenden Theorien zu bestätigen und zu konsolidieren und damit ein Paradigma zu verfestigen. Es geht den Forscher_innen also nicht in erster Linie darum, die Grenzen, Ungereimtheiten oder Paradoxien zu hinterfragen und so wird – wie schon erwähnt – immer wieder etwas bewiesen, was eigentlich schon vorausgesetzt wurde.
Desweiteren ist das gesellschaftliche Subsystem der Wissenschaft, insbesondere der Naturwissenschaft hinsichtlich moralischer Implikationen und ethischer Diskurse keine selbsttätige Instanz. Zwar produziert sie Erkenntnisse, aus denen sich ethische Implikationen ableiten lassen, doch ist sie nicht selbst damit betraut, daraus für die Gesellschaft und deren Subsysteme Handlungsanweisungen zu generieren.
Die der Ethik verpflichteten Disziplinen der Philosophie und Theologie bzw. die kirchlichen Institutionen reagieren, aufgrund ihrer Tradition des naturwissenschaftlichen Skeptizismus, meist mit deutlicher Ablehnung auf die neuen Erkenntnisse. Erst wenn durch die Massenmedien auf Schieflagen und Missstände hingewiesen, sich unabhängige Protestbewegungen gebildet und ihre Ansichten auf die Straße getragen haben, entstehen daraus Handlungszwänge für die Institutionen.
Niklas Luhmann beschreibt das Wissenschaftssystem als eine gesellschaftliche Institution, die letztlich nur an der Frage interessiert ist, ob eine wissenschaftliche Hypothese wahr oder falsch ist. Welche gesellschaftlichen Konsequenzen daraus folgen, ist für die Wissenschaft nicht relevant. Ist die erzielte Erkenntnis hinreichend neu und interessant, so können sich die Massenmedien dieses Themas annehmen, sie können daraus eine moralische Implikation ableiten und eine öffentliche Meinung generieren, infolgedessen gegen diesen Missstand eine Protestbewegung initiiert wird. Nur dann, wenn diese Protestbewegung im Wechselspiel mit den Massenmedien eine ausreichend große Masse erreicht, wird das jeweilige Thema – zum Bsp. Tierrechte – für die Politik relevant. Laut Luhmann interessiert sich das gesellschaftliche Subsystem Politik nämlich nur für die Frage der Macht: Können mit diesem Thema Wählerstimmen gewonnen werden? Kann damit ein Machtanspruch konsolidiert oder neu hinzugewonnen werden? Erst dann, wenn in der Gesellschaft ein Thema hinreichend ausgeprägt kommuniziert wird, kann es zum Politikum werden. Erst dann wird auch der politische Apparat eine Gesetzesnovelle ausarbeiten, diese mit einer Mehrheit beschließen und zum tatsächlichen Gesetz machen, welches durch die Judikative – also das gesellschaftliche Subsystem des Rechts– angewandt wird und damit auch in andere gesellschaftliche Subsysteme wie zum Bsp. die Wirtschaft und die Wissenschaft rückwirkt. Erst dann werden auch die durch die Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse zu einem Paradigmenwechsel sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch in anderen Bereichen der Gesellschaft führen.
http://radioalf.blogsport.de/
RALF - Radio Animal Liberation Freiburg
- RALF Tune in – Meat out.
Das Tierbefreiungs-Radio auf Radio Dreyeckland
Jeden 3. Montag im Monat, von 16.00 bis 17.00 Uhr auf 102.3 mhz
Webstream auf www.rdl.de
http://radioalf.blogsport.de/
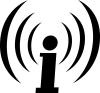

Wann ist das Tier ein Mensch? (Teil 1)
https://linksunten.indymedia.org/de/node/78893
http://radioalf.blogsport.de/archiv-einzelbeitraege/wann-ist-das-tier-ei...
Der "Materialismus" ist tot...
... lang lebe der "Materialismus".