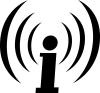Die Mobilisierung gegen den G20-Gipfel zeigt, dass die Linke aus der eigenen Geschichte nichts gelernt hat.
Überwältigt von der russischen Oktoberrevolution verfasste Lenin im Winter 1917/1918 unter dem eher nüchtern anmutenden Titel »Wie soll man den Wettbewerb organisieren?« ein Grundsatzpapier für den Umgang mit der neuergriffenen Macht. Darin heißt es: »Nur durch die freiwillige und gewissenhafte, mit revolutionärem Enthusiasmus geleistete Mitarbeit der Massen der Arbeiter und Bauern an der Rechnungsführung und Kontrolle über die Reichen, die Gauner, die Müßiggänger und Rowdys ist es möglich, diese Überbleibsel der fluchbeladenen kapitalistischen Gesellschaft, diesen Auswurf der Menschheit, diese rettungslos verfaulten und verkommenen Elemente, diese Seuche, diese Pest, diese Eiterbeule zu besiegen, die der Kapitalismus dem Sozialismus als Erbschaft hinterlassen hat.«
Die von Lenin gewählten Charakterisierungen für die Feinde des
Sozialismus lesen sich heute als Ankündigung der Verfolgung von
politischer Opposition und sozialer Differenz, die bereits den Beginn
der gesellschaftlichen Transformation in Russland und nicht erst das
Regime Stalins kennzeichnete. Die unschuldigen Opfer wurden allein
deshalb zu Zielscheiben des Roten Terrors, weil sie einer bestimmten
sozialen Schicht angehörten, und nicht, weil sie tatsächlich
Konterrevolutionäre waren. Für die Linke müsste dieses Wissen zu der
Erkenntnis führen, dass die von ihr angestrebte radikale Umgestaltung
der kapitalistischen Verhältnisse sich an Maßstäben von Humanität und
politischer Freiheit orientieren muss.
Widmet man sich den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg, finden sich dagegen eher neuerliche Feindbildkonstruktionen und ein politischer Aktionismus, der die Bereitschaft zu Bürgerkrieg, Gewalt und Terror gegen Andersdenkende anruft. Nach einem der zahlreichen Anschläge militanter G20-Gegner forderten die Urheber in einem Bekennerschreiben zu Hausbesuchen bei Hamburger Millionären auf; in einem anderen heißt es, man könne derzeit nur die »Maschine zum Stottern« bringen, aber »die Maschinisten nicht aufhalten«, gefolgt von der unverhohlenen Drohung: »noch nicht«. Eine weitere Selbstbezichtigung informiert, dass »Bullen mit Feuer« angegriffen wurden. Das sei gerechtfertigt, weil es sich bei »Bullen« um ein Werkzeug der Klassenjustiz handele. Mit den »Reichen«, den vage bleibenden »Maschinisten« und auch den »Bullen« geraten also wieder soziale Schichten sowie Gruppen vermeintlicher Funktionsträger in den Fokus linker Gewalt. Man fühlt sich an die »Only a dead pig is a good pig«-Rhetorik der Black Panther Party erinnert, die später von der RAF übernommen wurde. »Natürlich kann geschossen werden«, meinte Ulrike Meinhof, für die klar war, auf welcher Seite der Unterscheidung »Mensch oder Schwein« Polizisten einzuordnen waren. Wer hoffte, dass diese Art der Gegnerbestimmung gerade aufgrund ihres negativen Traditionsgehalts innerhalb der bewegungslinken Protestgruppen zu einer historisch informierten Debatte über die Legitimation von Militanz und zu ihrer Kritik führt, wurde enttäuscht.
Mit viel Pathos und gänzlich affirmativ ruft die Interventionistische Linke (IL) in ihrer »Ersten Mitteilung zum G20-Gipfel« dazu auf, 100 Jahre nach dem Roten Oktober »die Revolution aufs Neue zu erfinden«, und erhebt die »Zerstörung der herrschenden Ordnung« zum Programm. In markigen Worten werden die G20-Proteste als Auftakt einer Rebellion beschworen, als Bruch »in der wankenden Ordnung der autoritär-kapitalistischen Gegenwart«, und die Leser dazu aufgefordert, »die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen«. Im »Herzen der Bestie« müsse der »gemeinsame Widerstand gegen die nationalistische Kackscheiße« organisiert werden, wobei die verbindende Solidarität unter den linken G20-Gegnern Hoffnung schüre, »dass unsere Rebellion zu etwas Besserem führen wird als der gegenwärtigen Traurigkeit«. Kaum eine Demo-Phrase wird ausgelassen, wobei der Standpunkt radikaler Kritik eher für Eingeweihte illustriert als für Außenstehende nachvollziehbar wird.
Nichtsdestoweniger mache die derzeitige Lage eine linke Erhebung unumgänglich. Gruppen wie die IL, TOP B3rlin oder das autonome Demonstrationsbündnis »Welcome to Hell« interpretieren die Krise der wirtschaftsliberalen Globalisierung und die zunehmenden Differenzen zwischen den reichen Industriestaaten als aussichtsreiche Möglichkeit: Im sich abzeichnenden Kampf zwischen einem »autoritären Neoliberalismus« und einem »nationalistischen Backlash« stünden die Chancen gut, ein »starkes Zeichen« eines »ungehorsam« zusammenkommenden »Lagers grenzübergreifender Solidarität« zu setzen. Zumal beim Gipfel »Reaktionäre« wie »Erdoğan, Trump und Putin« mit »Vertretern eines autoritären Wettbewerbsstaates wie Merkel und Co.« an einem Tisch sitzen und die Reproduktion der kapitalistischen Ordnung besprechen.
Das ist zweifelsohne der Fall, doch lässt sich darin angesichts wachsender Interessenskonflikte und militärischer Drohpotentiale zwischen den kapitalistischen Staaten nicht auch ein Moment pragmatischer Vernunft erkennen? Nach Darstellung der Bundesregierung bietet das G20-Treffen die Möglichkeit, auf informeller Ebene mit den Spitzendiplomaten neben der »Stabilisierung der Weltwirtschaft (…) geopolitische Konflikte, Terrorismus, Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, Hunger, den voranschreitenden Klimawandel und Pandemien« zu besprechen und nach gemeinsamen Lösungsstrategien zu suchen. Es gibt viele Gründe diese Agenda als zynisch, plakativ und unter Bedingungen nationalstaatlicher Konkurrenz als nicht bewältigbar zu bewerten. Nicht zuletzt, weil Deutschland vor dem Gipfel das Lob offener Märkte aus einer Position ökonomischer Stärke heraus formuliert und sich gegenüber strukturell benachteiligten Staaten als Lehrmeister aufspielt. Doch wenn Angela Merkel bekennt, sie wolle »kein Zurück in eine Welt vor der Globalisierung« und sich überzeugt zeigt, dass »durch nationale Alleingänge, durch Abschottung und Protektionismus« besagte »Herausforderungen ganz sicher nicht gelöst werden«, artikuliert sie eine Hoffnung, hinter die auch die Linke nicht zurückfallen darf.
Obwohl in den linken Aufrufen auf die Gefahr des Nationalismus hingewiesen wird, ist man nicht bereit, in seinem weltoffenen und politisch liberalen Widerpart das kleinere Übel zu erkennen. Der Gipfel wird vielmehr als Beweis angeführt, dass die »Gegenüberstellung von neoliberaler ›Vernunft‹ und rechter ›Unvernunft‹« durchbrochen werden müsse« (IL). Die Existenz unterschiedlicher politischer Freiheitsgrade wird selbst noch zum Verdachtsmoment gegen das System: »Die Herrschenden versuchen verzweifelt, die imperiale Lebensweise durch sogenannte liberale Demokratie zu verhüllen«, raunt es in der Mitteilung der IL verschwörungstheoretisch. Es gebe »keinen besseren oder schlechteren Kapitalismus«, fabuliert der Altautome Andreas Beuth aus dem Organisationskreis der »Welcome to Hell«-Demonstration im Taz-Interview. Die Unterschiede zwischen Manchester-Kapitalismus und Sozialstaat, zwischen einem progressiven Liberalismus mit Antidiskriminierungsgesetzgebung und einer Entwicklungsdiktatur mit Gefängnisdrohung für jeden kritischen Geist werden damit nivelliert und die verschiedenen Gesellschaftsformen schlichtweg über einen Kamm geschert. Während mit Emphase über Kriege, bewaffnete Konflikte, Flucht und die Abschottung Europas schwadroniert wird, sieht man über Feinheiten wie Rechtsstaat oder Willkürherrschaft, die am Ende über die Migrationsrichtung entscheiden, lapidar hinweg. So beweisen die Aufrufe genau die Indifferenz, die »Merkel und Co.« wegen ihrer Verhandlungsbereitschaft gegenüber Despoten vorgeworfen wird.
Aber den linken G20-Gegnern geht es gerade nicht um Differenzierung, sondern es kommt ihnen auf das gemeinschaftsstiftende Moment ihres Feindbildes an. So heißt es im Aufruf von TOP B3rlin mit Blick auf die unterschiedlichen Gruppierungen im Protestlager: »Inhaltlich können wir uns schließlich alle darauf einigen, dass beim G 20 zwanzig Arschlöscher zusammenkommen und nur Scheiße herauskommt.« Die fäkalsprachliche Banalisierung täuscht nur mühsam darüber hinweg, dass man es mit der Begründung der Gipfelproteste gar nicht so genau nehmen mag und stattdessen lieber mal so richtig auf den Tisch haut. Bei so viel Entschlossenheit lässt sich der Gedanke wohl kaum erörtern, ob es unter den jetzigen Bedingungen der kapitalistischen Krise nicht darum gehen müsste, gegen deren regressivste Tendenzen zu demonstrieren. Zu skandalisieren wären nicht Versuche, den Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) zu koordinieren, stattdessen sollte die Linke gegen den türkischen Autoritarismus, den russischen Neoimperialismus oder den saudi-arabischen Export des wahhabitischen Islam protestieren.
Zweifelsohne taugt die Inszenierung der G20 besser zum bewegungslinken Hassobjekt, weil man sich auf diese Weise im Arsenal antikapitalistischer Projektionen bedienen kann. Den langjährigen Versuchen zum Trotz, das Kapitalverhältnis als umfassendes Herrschaftssystem zu verstehen, das sich hinter dem Rücken der Menschen reproduziert, wendet sich die G20-Kritik gegen vermeintliche Repräsentanten des Kapitals, denen mehr oder weniger direkt ein besonders böser Wille zu Ausbeutung und Unterdrückung zugeschrieben wird. Zwar werde der Gipfel nur von austauschbaren Charaktermasken ausgetragen, aber diese seien schließlich »real«, heißt es im Aufruf von »Welcome to Hell«. Im Bekennerschreiben zu den jüngsten Anschlägen auf die Kabelanlagen der Bahn drohen die Autoren den »Maschinisten« der Weltwirtschaft und in einem Aufruf kündigt das linksradikale Bündnis »Ums Ganze« die »Verantwortlichen und Profiteure dieses Systems« zu »markieren«.
Lust an der Konkretisierung treibt wohl auch TOP B3rlin dazu, mit der Blockade des Hamburger Hafens den »Sachzwang kapitalistischer Globalisierung politisierbar« machen zu wollen. Die Gruppe möchte thematisieren, dass sich durch Produktionsverlagerungen ins Ausland die Ausgangsbedingungen von Lohn- und Arbeitskämpfen verschlechtert haben. Dies funktioniere nur, wenn angesichts der international arbeitsteiligen Produktion die Transportkosten niedrig bleiben. Wird also, wie in Hamburg beabsichtigt, die logistische Infrastruktur angegriffen, bekomme die Linke »ein Mittel in die Hand, das die Gegenseite in die Knie zwingen kann«. Das klingt nach einem Sandkastenmanöver, das insbesondere von den Hamburger Hafenarbeitern vermutlich mit viel Sympathie aufgenommen werden wird.
Neben dieser Hybris stört aber viel mehr die symbolische Pointe der geplanten Aktion: Die national angesiedelte Produktion und die Begrenzung des Warenverkehrs erscheinen als Lösung des Problems. Schon wollte man sich freuen, dass nach der Kampagne gegen die Europäische Zentralbank in Frankfurt die schier obsessiven Schuldzuweisungen an Banker und Politiker ein wenig abebbten, da findet die Globalisierungskritik ihre Gegner erneut mit schlafwandlerischer Sicherheit in der Zirkulationssphäre des Kapitals.
Dazu passt, wenn im Neuen Deutschland Samuel Decker und Thomas Sablowski (die kürzlich eine Studie zur G20 für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgearbeitet haben) die Entscheidung der Bundesregierung, Afrika an die Spitze der G20-Agenda zu setzen, mit dem Imperialismus des 19. Jahrhunderts analogisieren. 1884/85 habe die Berliner Afrika-Konferenz von Reichskanzler Bismarck den »Beginn einer neuen Etappe im Wettlauf der Kolonialmächte um die Aufteilung Afrikas« eingeläutet, heute gehe es den Industriestaaten um eine »neue Welle neoliberaler Strukturpolitik zur kapitalistischen Durchdringung des afrikanischen Kontinents«.
Dass sich die Bevölkerungsmehrheiten in den abgehängten Regionen nichts sehnlicher als eine kapitalistische Durchdringung wünschen, die wenigstens die Aussicht auf sozialen und politischen Fortschritt böte, darf nicht bedacht werden. In der Mobilisierung gegen den Gipfel bleibt jedenfalls unerwähnt, was einer Weltbank-Studie aus dem Jahr 2015 zu entnehmen ist: In den vergangenen 20 Jahren ist es demnach weltweit zu einer Halbierung der extremen Armut gekommen; in bevölkerungsreichen Schwellenländern wie China und Indien steigt der materielle Wohlstand ebenso wie die Lebenserwartung und der Zugang zu Bildung, insbesondere für Frauen. Demgegenüber geht die Säuglingssterblichkeit zurück. Selbst in der Subsahara-Region ist Zahlen der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam zufolge seit 2001 die Armutsquote von 57 auf 41 Prozent gefallen. Zweifellos sagen solche Zahlen wenig über die ungerechte Verteilung von Reichtum in der Welt aus, aber sie deuten eine unterschlagene Ambivalenz an, die die linken Generalabrechnungen unglaubwürdig erscheinen lassen.
Dies gilt auch mit Blick auf die Ableitung von Krieg und militärgestützter Außenpolitik. Die »kapitalistischen Kernländer«, so heißt es im Aufruf von »Welcome to Hell«, sicherten ihre ökonomischen Interessen nicht mehr nur durch die »Implementierung von Handelsabkommen und einer kapitalorientierten Zoll- und Fiskalpolitik«, sondern griffen »immer häufiger auf militärische Optionen zurück«. Tatsächlich ist die Anzahl kriegerischer Konflikte seit dem Ende des Kalten Kriegs enorm angestiegen. Dabei handelt es sich aber nicht um kapitalistische Raubkriege, wie besagter Aufruf suggeriert, sondern zuvörderst um Bürgerkriege, wie sie heute in zerfallenden Staaten wie Syrien und Libyen stattfinden. Werden die dortigen Interventionen auf Macht- und Profitstreben verkürzt, ist eine angemessen kritische Auseinandersetzung mit der westlichen Sicherheitspolitik schon verfehlt.
Die Koalitionen der Willigen, Nato und EU sandten nicht Soldaten in den Kosovo oder nach Afghanistan, um profitable Anlageobjekte und Ressourcen zu gewinnen. Sie versuchten vielmehr, mittels militärisch erzwungener Demokratisierung internationale Stabilität als Grundbedingung ökonomischen Wachstums herzustellen. Die wirtschaftliche Durchdringung der Interventionszonen war bloßes Mittel zum Zweck. In der Regel scheiterten die zivil-militärischen Entwicklungsprojekte auch am geringen Interesse, Kapital in den Hochrisikozonen von Bürgerkriegsländern zu verbrennen. Nur ist das kein Grund zur Häme, denn damit blieben diejenigen, die in Kabul oder Damaskus um Menschenrechte ringen, auf sich allein gestellt.
Dass im Expansionsinteresse des Kapitals, dem militärischen Demokratieexport und im Freihandel Momente von Befreiung stecken – wohlgemerkt nur Momente, nicht die befreite Gesellschaft selbst –, müsste in einer Zeit identitätspolitischer Regression Gegenstand linker Strategiedebatten sein. Die globalisierungskritische Linke bläst dagegen, wie nun in Hamburg, besinnungslos zum antikapitalistischen Angriff. Angespornt von den »Blutspuren der internationalen Ausbeutung«, die »Welcome to Hell« von den Mauern Hamburgs »abtropfen« sieht, sinnen die Black-Block-Aktivisten auf Krawall. Schon durch die ständige Wiederholung, der Protest solle »unberechenbar« bleiben, wird eher umschrieben als getarnt, was wirklich gewünscht ist. Die autonome Floskel, es werde kein ruhiges Hinterland geben, erhält auch in einer Hafenstadt nicht viel mehr Sinn und gibt wie immer, wenn sie benutzt wird, nur ein weiteres Beispiel, wie sich die Linke mit Hilfe einer passenden Semantik auf die Gewalt einstimmt.
Natürlich will sie es am Ende auch in Hamburg, trotz einer Reihe von Brand- und Farbanschlägen, nicht gewesen sein: »Wir üben keine Gewalt aus, wir leisten Widerstand«, so wiederum Alexander Beuth, der sich im schon erwähnten Taz-Interview in kapitalistischer Überbietungslogik auf einen »der größten schwarzen Blöcke, die es in Europa jemals gegeben hat«, freut. Das Bündnis »Ums Ganze« verbittet sich »jede Spaltung und Kriminalisierung der Proteste« und lädt keine zehn Zeilen später – ganz höflich, in der Sprache einer NGO – »alle« dazu ein, »schon jetzt die Herausforderung anzunehmen und mit uns gemeinsam, kreativ und vielfältig den Aufstand gegen die Eliten und ihren Ausnahmezustand zu wagen«. Auffällig ist nicht nur, wie hier die Kritik am Polizeieinsatz zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird (worauf der damalige Jungle World-Redakteur Stefan Wirner schon angesichts der Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm vor einem Jahrzehnt hinwies), sondern vor allem, wie in einer Mischung aus Scheinheiligkeit und Lokalpatriotismus – wie könne der Staat es wagen, gerade die linke Szene in Hamburg zu provozieren – die falsche Legitimation linker Gewalt betrieben wird.
Demgegenüber muss mindestens einem der Mobilisierungsvideos zugutegehalten werden, dass in ihm ganz ehrlich zum Ausdruck kommt, wie sehr sich die Beteiligten auf die Randale freuen und aller Voraussicht nach Spaß daran haben werden. Im Clip fährt eine vermummte Gang zum Sound eines gerappten Agitprop-Songs in einem ausgedienten Wasserwerfer spazieren, wirft sich nach dem bestandenen Abenteuer einer Polizeikontrolle betont lässig in Aufmischpose und signalisiert als Streetfight-Crew, die sich ästhetisch irgendwo zwischen den Skinheads Sächsische Schweiz und den Ultras des nächsten Großstadtfußballvereins bewegt, Kampfbereitschaft.
Als Kritiker solcher Selbststilisierung möchte man zunächst das Lächerliche herauskehren: Die Protagonisten des Clips scheinen zu belegen, was der jung verstorbene Intellektuelle Alfred Schobert, der durchaus Verständnis für antifaschistischen Selbstschutz hatte, hinsichtlich muskulärer Auswüchse der Antifa der neunziger Jahre sinngemäß in die Worten fasste, wer viel trainiere, habe nun mal weniger Zeit zum Lesen und Nachdenken. Ein anderer Gedanke drängt sich jedoch auf, wenn die Bewegungsprosa der IL komplementär zum Aufruf zur Gewalt gelesen wird: »Wir sind das triste Weiter-so unserer Gesellschaft, das Gefühl der Belanglosigkeit der Dinge, leid«, heißt es da. Der gewollte Krawall, der auch im Mobilisierungsvideo besungen wird, entpuppt sich viel weniger als Notwehr denn als der temporäre Ausbruch energiegeladener Bürgersöhne, die sich in Erwartung eines großzügigen Erbes ihrer Eltern und nach Durchlaufen diverser Auslandssemester noch nach einem besonderen Kick sehnen und deshalb den Aufstand proben. Mit der viel bemühten grenzenlosen Solidarität, also mit Empathie für die im Weltmaßstab Ausgebeuteten, hat diese Haltung überhaupt nichts zu tun. Denn Flüchtlinge und die Empfängerinnen von Elendslöhnen dürften ganz ähnlich wie schon die Ossis nach dem Mauerfall vor 28 Jahren die Perspektive relativ wohlhabender deutscher Studenten nicht als »trist« und »belanglos«, sondern als erstrebenswert und aufregend empfinden.
Doch über die Banalisierung linker Gewalt hinaus ist die Inszenierung der Militanz als Ankündigung des zukünftigen Umgangs mit Abweichlern, Nichtüberzeugten und Gegnern zu fürchten. In einem Selbstbezichtigungsschreiben der Gruppe »Eat the Rich« nach Brandanschlägen auf die Autos zweier Hamburger Millionäre formulierten die Autoren die Anregung, »die wilde Zeit des G20-Gipfels für Hausbesuche bei den weit über 40 000 Hamburger Milionär*innen zu nutzen und dies in den Aktionsplänen zu berücksichtigen«. Der von ihnen begangene Anschlag stehe zudem »in guter alter sozialistischer Tradition« und markiere das kapitalistische Eigentum, das stattdessen vielmehr Bedürftigen als Erholungsort zur Verfügung gestellt werden solle.
Vielleicht lässt sich noch davon absehen, dass hier jemand ohne einen blassen Schimmer von der Verlogenheit der sozialistischen Erholungskultur spricht, die exklusive Ferienaufenthalte an politisches Wohlverhalten und Arbeitsleistung koppelte. Von der Benutzung ehemaliger Villen für Jugendwerkhöfe, Schulen und andere Instanzen der autoritären Disziplinierung ganz zu schweigen. Der Aufruf zum Hausbesuch indes, also zur Mob-Action gegen die sozialen Feinde, steht in der Tradition des revolutionären Terrors, aus dem vor 100 Jahren eines der unmenschlichsten Regime des vergangenen Jahrhunderts hervorging. Zwischen der mangelnden Wertschätzung liberaler Grundrechte, hinter die ein Projekt der Emanzipation nicht zurückfallen darf, und der Leichtfertigkeit, mit der Gewalt gegen Personen legitimiert wird, besteht ein Zusammenhang. Vor diesem Hintergrund erscheint der Rechtsstaat als Fluchtpunkt restlinker Vernunft, die angekündigte Randale in der Hansestadt dagegen als Vorschein des Schlimmeren.