Abstract: Den Text verstehen wir als einen Beitrag zu der in den letzten Jahren in der (radikalen) Linken verstärkt geführten Strategiedebatte. Wir analysieren in einem ersten Schritt die momentane gesellschaftliche Situation. Wir gehen davon aus, dass die momentane Krise der Ausdruck der grundlegenden Widersprüchlichkeit der kapitalistischer Produktionsweise ist. Sowohl neoliberale Austeritätspolitiken als auch (links-)keynesianische Strategien, müssen scheitern, da sie die grundsätzliche Widersprüchlichkeit nicht außer Kraft setzen können.
In einem zweiten Schritt werden die grundlegenden Formen ausgemacht, in denen soziale Kämpfe momentan in diesem Land geführt werden. Wir identifizieren dabei zwei Formen von Kämpfen, die unvermittelt nebeneinander stehen, aber gerade auf eine Vermittlung angewiesen wären. Dies sind zum einen vereinzelte Interessenkämpfe im Alltag und zum anderen die Ansätze politischer Gruppen, die meist nur die Abschaffung des großen Ganzen fordern, aber keine soziale Basis hinter sich haben, um dies umzusetzen. Wir schlagen vor, dass die Vermittlung beider Pole über die gemeinsame soziale Lage der Lohnabhängigkeit und darauf aufbauend über Klassenbewusstsein hergestellt werden kann.
Der Klassenbewussteinsbegriff wird – vor dem Hintergrund feministischer
Debatten über Reproduktionsarbeiten unter kapitalistischen Bedingungen –
mit einem materialistischen Bedürfnisbegriff verbunden. Ein am
Bedürfnis orientiertes Klassenbewusstsein entsteht in der Praxis durch
die Erkenntnis, dass die Negation und Subordination der eigenen
Bedürfnisse unter die des Kapitals eine Realität für die ganze Klasse
ist. Es handelt sich also um die Rückkoppelung der eigenen
Bedürfnisstruktur an die Totalität des Kapitalverwertunsprozesses.
In einem dritten Schritt wird danach gefragt, welchen organisatorischen Ausdruck ein solcher Kampf für die Interessen und Bedürfnisse der Klasse der Lohnabhängigen bräuchte. Wir schlagen eine auf drei Ebenen gelagerte Form der Organisierung vor: 1. Organisation nach Interessen im unmittelbaren Lebensumfeld und solidarische Vernetzung mit ähnlichen Basisgruppen auf einer lokalen Ebene 2. Eine überregionale Verbindung dieser Kämpfe, um eine politische Konstante herzustellen. 3. Den Aufbau eines Büros als Kommunikationsknotenstern für die Ebenen eins und zwei.
Die Gruppe Antifa Kritik & Klassenkampf geht davon aus, dass eine solche Form der Organisation in der Lage wäre, ein ernsthaftes und im Alltag verankertes Gegengewicht zu den Krisenstrategien des Kapitals zu bilden und dass diese den Ausgangspunkt für eine sozialrevolutionäre Veränderung der Gesellschaft bilden könnte.
Antifa Kritik & Klassenkampf, Frankfurt am Main
Auf der Suche nach der Reißleine in Zeiten der Krise
- Strategische Überlegungen -
-------
„C’est l’histoire d’une société qui tombe et qui au fur et à mesure
de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer : jusqu’ici tout va
bien, jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien…
Le problème ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.“
------
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Krise
2.1 Widerspruch & Krisendynamik
2.2 Die Rolle der BRD in der Krise
3. Klasse
3.1.Selbstorganisierung & Klassenkampf
3.2 Bedürfnis & Klassenbewusstsein
3.3 Exkurs: Zur Kritik der Zurückweisung des Klassenbegriffs am Beispiel des …umsGanze Bündnisses
4. Praxis
5. Literatur
--
1. Einleitung
„Jedes geschichtliche Unternehmen kann […] nur ein mehr oder weniger vernünftiges und begründetes Abenteuer sein. Zuerst jedoch ein Wagnis. Als solches kann es keine Maßlosigkeit, keinen unerbittlichen und absoluten Standpunkt rechtfertigen.“ (Camus 1969: 326)
Es gibt bisher trotz aller Diskussion über die Krise in der deutschen Linken keine theoretisch fundierte, aber gleichzeitig gesellschaftlich relevante Praxis, um auf die mit Kapitalismus und Krise verbundenen Entwicklungen reagieren zu können.1So wie man vielleicht aus heutiger Perspektive sagen kann, dass die Linke Anfang der 2000′er auf die Re-Formierung der hiesigen Verhältnisse durch die Agenda 2010 und deren Folgen nicht adäquat reagiert hat, so beschleicht uns der Gedanke, dass wir angesichts der heutigen Krise und ihrer konkreten Folgen für die Menschen an einem ähnlichen Punkt stehen könnten – nicht im Sinne einer nicht genügenden Thematisierung der Krise, sondern im Sinne einer Reflexion der eigenen Handlungen, ob diese dem Gegenstand angemessen sind oder ob wir uns nicht zu sehr in den Formen von Events und Symbolpolitik verrennen, die in den 1990′ern und 2000′ern Refugium einer radikalen Linken waren, also in einer Zeit gesellschaftlicher Ohnmacht angesichts eines scheinbar alternativlos gewordenen Kapitalismus.
Alle uns bis heute bekannten Versuche, auf die heutigen Krisenbearbeitungsstrategien des Kapitals zu reagieren, konnten die mit ihnen einhergehenden Angriffe auf die Lohnabhängigen nicht abwehren – unsere eigenen inbegriffen. Alle Politik, die über Teilbereichskämpfe hinausweist, begegnet uns in der einen oder anderen Form des Events oder der reinen Kritik. Beide Formen greifen nicht verändernd in unseren Alltag als Lohnabhängige, in die Sphäre der kapitalistischen Produktionsweise ein – unter den derzeitigen Bedingungen bleiben sie als Appell zahnlos. Damit ist angezeigt, in welche Richtung wir mit unserem Strategievorschlag wollen: Hin zu einer politisch-strategischen Neuorientierung im Bereich Antikapitalismus und Krisen-Widerstand. Wir zielen damit auf die drängende Frage, wie sich in der gegenwärtigen Situation eine Linke handlungsfähig organisieren kann, weswegen wir hier nur die Grundzüge einer Krisentheorie darlegen können, da es uns zentral darum geht, einen zu diskutierenden Strategievorschlag zu unterbreiten.
Anlass zu alledem gab uns unser Versuch, innerhalb von M31 an die
Produktions- und Reproduktionskämpfe, über ein gemeinsames Event
hinausgehend, anzuknüpfen. Dem M31-Generalstreikspapier wurde zwar in
einigen Teilen der (radikalen) Linken anfänglich mit Interesse begegnet,
doch entwickelten sich daraus keine tragfähigen Strukturen. Die Gründe
dafür vermuten wir einerseits in einem Mangel an verbindender und
verbindlicher Organisierung und andererseits in der weitestgehend
fehlenden Erfahrung in Kämpfen im Bereich Lohn- und Hausarbeit. Damit
verbunden ist die bequeme, oft unreflektierte Einrichtung in der eigenen
Subkultur und in unseren bisherigen, oftmals nur selbst-referentiellen
Formen von Politik.
Von unseren praktischen Erfahrungen der letzten sieben Krisenjahre
ausgehend und in Folge einer längeren Diskussion über die Möglichkeit,
Klasse(nkämpfe) und Krise in der Praxis miteinander zu verbinden, wollen
wir hiermit den aktuellen Stand unserer Überlegungen vorstellen. Soviel
sei schon vorweggenommen: es geht uns hier nicht um einen antiquierten
Klassenbegriff, dessen inhaltliche Bestimmung nicht über die einfache
Parole „Klasse gegen Klasse“ hinauskommt, sondern um eine
Reaktualisierung des Klassenbegriffs unter heutigen Bedingungen und
unter Berücksichtigung der bisher geführten Diskussionen um diesen.
Beim Schreiben dieser Zeilen sind auch für uns so einige Fragen aufgekommen, die bis heute nicht abschließend geklärt sind, dementsprechend soll dies hier auch kein Master-Plan sein, sondern im besten Fall ein auszuprobierender und zu diskutierender Anstoß einer gemeinsamen politisch-strategischen Neuausrichtung. Damit verbunden ist ein Aufruf an euch, Genoss*innen, angesichts der sich vollziehenden politischen Weichenstellungen in der heutigen Re-Formierung des Kapitalismus sowie der um sich greifenden reaktionären Entwicklungen, unsere eigene Praxis auf den Prüfstand zu stellen und die Debatte um eine angemessene Krisen-Antwort weiterzuführen.
2. Krise
Bevor wir zur Diskussion praktischer Perspektiven der radikalen Linken in der Krise kommen, wollen wir kurz darstellen, wie wir die gegenwärtige gesellschaftliche Situation einschätzen, da sich hieraus einige Konsequenzen für die Praxis ergeben.
2.1 Widerspruch & Krisendynamik
Auch wir gehen davon aus, dass die gegenwärtige Krise Ausdruck der grundlegenden Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Produktionsweise ist, die in ihren inneren Widersprüchen angelegt ist. Sie ist vor allem auf die grundlegenden Widersprüche zwischen den Bedingungen der Produktion von Mehrwert und den Bedingungen seiner Realisierung zurückzuführen (vgl. MEW 25: 254f.).2Die kapitalistische Konkurrenz treibt die Einzelkapitale zu Rationalisierungsmaßnahmen, durch die (im Verhältnis zu den eingesetzten Produktionsmitteln) mehr und mehr Arbeitskräfte aus dem Produktionsprozess gedrängt werden. Der Heißhunger des Kapitals nach Mehrarbeit drückt auf die Löhne; so wird tendenziell die Nachfrage unterminiert, die das Kapital zur Realisierung des produzierten Mehrwerts bräuchte. Während die fordistische Regulation der kapitalistischen Vergesellschaftung als ein Klassenkompromiss gedeutet werden kann, in dem dieser Widerspruch durch keynesianischen Staatsinterventionismus prozessiert wurde, kann entsprechend das Scheitern des Fordismus in den 70er Jahren als ein Scheitern des Keynesianismus gedeutet werden. Dabei wurde deutlich: Weder kann der Staat als Staat Mehrwert schaffen3noch kann er sich angesichts eines Kapitals, dessen Spielwiese der Globus ist, als der Souverän aufführen, der zu sein er beansprucht und den die verängstigten Warensubjekte sich wünschen. Die „relative Prosperität der Arbeiterklasse“ konnte nur kurz zugelassen werden und entpuppte sich als „Sturmvogel einer Krise“ (MEW 24: 410). Die Profitraten brachen – nicht nur aufgrund hoher Löhne, sondern bspw. auch aufgrund von mangelnden Rationalisierungsreserven – ein. So setzten sich die zur Krise treibenden Widersprüche – im Verbund mit verschiedensten Formen sozialer Kämpfe – wieder durch und wurden nun durch die neoliberale Offensive der Deregulierung, Privatisierung, Finanzialisierung und Zerschlagung der Gewerkschaften bearbeitet. Heute zeigt sich, dass auch diese Strategie4gescheitert ist (was natürlich nicht heißt, dass sie politisch als überholt gilt). Die Krise des Fordismus wurde nicht gelöst, sondern verschoben.
Vor diesem äußerst grob skizzierten Hintergrund teilen wir die Einschätzung, dass aus der jetzigen Situation nur eine tiefe Depression herausführt, in welcher der immer weiter aufgestaute Entwertungsdruck sich durchsetzt.5Die Situation in Griechenland, Portugal oder Spanien liefert einen Vorgeschmack darauf, was dieser Entwertungsprozess bedeutet. Seine konkrete Gestalt ist natürlich kaum vorherzusehen. Auch Faschismus und verschärfte kriegerische Auseinandersetzungen sind als Bestandteil und Resultat der Krisendynamik eine mögliche Entwicklung, die man bereits in vielen Teilen der Welt beobachten kann. Davon auszugehen, dass auf irgendeine Weise ein Entwertungsprozess stattfinden muss, hat jedoch ungeachtet der Frage nach seiner konkreten Gestalt – und ungeachtet der prophetischen Frage, ob wir es nun mit einem Zusammenbruch der kapitalistischen Produktionsweise, die endgültig an ihre innere Schranke gestoßen ist, zu tun haben oder doch nur mit einer Bereinigungskrise, nach deren Überwindung derselbe Schlamassel von vorne beginnt – weitreichende Konsequenzen für die Einschätzung der (wirtschafts-)politischen Handlungsfähigkeit der Staaten. Sie können im Grunde nur zum Sachwalter des Entwertungsdrucks werden, egal ob dies im Gewand neoliberaler Austeritätspolitik, die Entwertung primär durch den Angriff auf die Lebensverhältnisse der Lohnabhängigen vorantreibt, oder keynesianischer Konjunkturpakete geschieht, die die Entwertung nur weiter hinausschieben. Denn jedes noch so gut gemeinte Konjunkturprogramm wird früher oder später an die Grenze seiner Finanzierbarkeit stoßen – und nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ist es ohnehin fraglich, woher die Hoffnung kommt, die Konjunkturprogramme könnten nun eine selbsttragende Konjunktur in Gang bringen. Auch die jüngsten Konjunkturprogramme haben ihr Ziel verfehlt. Deshalb teilen wir die These der Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, dass es – zumindest systemimmanent – keine soziale Krisenlösung gibt (vgl. 2009). Eine solche ist nur als sozialrevolutionäre Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise zu haben.
Diese Perspektive bedeutet für uns auch immer, eine radikale Kritik am
Staat zu formulieren. Die Reproduktion verschiedenster – ökonomischer,
rassistischer und sexistischer – Herrschaftsverhältnisse ist sein Job;
er ist bei allem, was er tut, angewiesen auf eine funktionierende
Kapitalakkumulation, deren Aufrechterhaltung entsprechend sein zentrales
,Interesse‘ sein muss – dies zu betonen, halten wir im gegenwärtigen
Suchprozess der (radikalen) Linken für zentral, denn nur eine gehörige
Delegitimation des Staats6eröffnet
eine langfristige Perspektive auf eine Selbstorganisation von unten
jenseits der herrschenden Logik; wo der Staat als Teil der Lösung und
nicht als Teil des Problems verhandelt wird, geht früher oder später
jeder Ansatz von Selbstorganisation in staatstragende Organisation über.
Inwiefern die Situation günstig ist, dem Staatsfetischismus
entgegenzuarbeiten, bleibt allerdings abzuwarten. Die dilemmatische Lage
der Staaten mag zunächst zu dieser Hoffnung verleiten, sie löst sich
jedoch wieder in Luft auf angesichts des Umstands, dass der landläufige
Reim auf die Lage darin besteht, Staat und Demokratie befänden sich im
Würgegriff der Finanzmärkte und müssten aus ihm befreit werden, um dem
Gemeinwohl wieder Luft zu verschaffen. Es ist gerade diese Deutung, die
sich gut mit linkskeynesianischen Reformvorstellungen vereinen lässt, da
in ihnen der Nationalstaat weiterhin als der zentrale Ort der
Regulierung gilt.
Dennoch soll ein wesentlicher Aspekt linkskeynesianischer Programme7hier nicht übergangen werden: Sie können bei entsprechender Ausrichtung dazu führen, dass es eben nicht primär die Lohnabhängigen sind, die den Entwertungsdruck zu spüren bekommen, und in diesem Sinne einen wesentlichen Unterschied machen.8Sie sollten jedoch mit einem anderen, eben sozialrevolutionären Impetus angegangen werden, d.h. sie sollten nicht – wie bspw. bei David Harvey (2009) oder Roth/Papadimitriou (2013: 109) – als Krisenlösung diskutiert, sondern als Maßnahmen betrachtet werden, die nur sinnvoll sind, wenn sie den Bedürfnissen der Lohnabhängigen entgegenkommen und damit die Krise vorantreiben.9Sie wären zu betrachten als einzelne, wirtschaftspolitische Maßnahmen innerhalb eines viel weiter reichenden antikapitalistischen Transformationsprozesses, als Übergangsmaßnahmen, bei denen es darum geht „das letzte Geld sinnvoll (zu) verballern“ (Ortlieb 2013: 36).10
Die theoretische Kritik des Staates und des (National)Staatsfetischismus löst allerdings – wie die Kritik des Linkskeynesianismus zeigt – nicht die praktische Frage: Wie hältst Du’s mit dem Staat? Hegemoniale Verschiebungen innerhalb der Staatsapparate können die konkreten Bedingungen für sozialrevolutionäre Bewegungen verbessern oder verschlechtern – gerade auch deshalb, weil der kapitalistische Staat nicht nur ökonomischer Akteur, sondern auch ideologische und repressive Instanz ist. Inwiefern etwa anti-staatliche Formen der Selbstorganisation wie Haus- oder Fabrikbesetzungen erfolgreich sein können, hängt nicht zuletzt davon ab, ob sie in einem Maß als legitim gelten, das den Einsatz repressiv-gewaltsamer Mittel durch den Staat verhindert. Emanzipatorische Bewegungen sollten sich jedoch der Illusion entwinden, der Staat sei beliebig für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
2.2 Die Rolle der BRD in der Krise
Neben diesen allgemeinen Einschätzungen zu Kapital und Staat in der Krise gilt es innerhalb Europas auch die besondere Rolle Deutschlands, seine hegemoniale Position in der gegenwärtigen Krise mitzureflektieren. Diese Rolle verdankt sich der für die BRD seit den Nachkriegsjahren charakteristischen Exportorientierung, die in ihren Anfängen darauf zurückzuführen ist, dass der „aufgrund des Rüstungsbooms der NS-Ära akkumulierte Kapitalstock […] für die westdeutsche Binnenwirtschaft viel zu groß“ (Roth/Papadimitriou 2013: 21) war und entsprechend auf die Märkte außerhalb der BRD drängte. Hierzu mussten die Lohnkosten im Vergleich zu anderen Ländern möglichst gering gehalten werden. An dieser Grundausrichtung (heute meist neomerkantilistische Strategie genannt) hat sich bis heute nichts geändert, nur findet sie in einem stark veränderten Umfeld statt. Konnte der deutschen Wettbewerbsfähigkeit, die auf einer hohen Arbeitsproduktivität bei geringen Lohnstückkosten gründet, in der Zeit vor dem Euro noch durch Währungsabwertungen entgegengearbeitet werden, fiel diese Möglichkeit mit der Einführung des Euro 1999 und 2002 weg, so dass die Konkurrenz zwischen den Euro-Ländern nur mehr über binnenwirtschaftliche Maßnahmen ausgetragen werden konnte, und das heißt konkret: über eine Politik der Verelendung (Lohn- und Rentenkürzungen, Reduktion der Sozialausgaben etc.). Entsprechend rüstete die rot-grüne Bundesregierung 2003 mit der Agenda 2010 für den innereuropäischen Kampf um einen Platz an der Sonne auf.
Mit dieser aggressiven Exportorientierung und der Politik des Lohndumpings, die Deutschland innerhalb der EU durchgesetzt hat, ist die BRD selbst für einen guten Teil der sogenannten Eurokrise verantwortlich zu machen. Zwar scheint es so, als seien die Länder der europäischen Peripherie für die Krise selbst verantwortlich, da sie hier zuerst nicht übersehbar in Erscheinung trat. Doch die wirtschaftlichen Probleme der Krisenländer sind nahezu unmittelbar auf die neomerkantilistische Strategie Deutschlands zurückzuführen – das gilt es gegen jede Form deutsch-nationalen Wohlstandschauvinismus zu betonen: Die „Pleitegriechen“, gegen die die Bild hetzt, sind ein Produkt des sozialpartnerschaftlich abgesicherten „Modell Deutschland“. Und es ist dieses die allgemeine Krisendynamik vorantreibende Land, das nun den Krisenländern ihre Politik aufoktroyiert und sich zum Meister der Krisenlösung aufschwingt. „Deutschland, das durch ein System von Kapitalderegulierung nach außen und Lohndrücken nach innen eher als jeder andere Staat letztlich die Eurokrise verursacht hat, hat sich als Bock zum Gärtner gemacht.“ (Anderson 2012: 16)
Der besonderen Rolle Deutschlands für die gegenwärtige Krise korrespondiert eine besondere Rolle des sozialen Widerstands in Deutschland: Dass hierzulande kein spürbarer Widerstand gegen die deutsche Wettbewerbs- und Standortpolitik organisiert wurde und wird, dass der soziale Friede hierzulande nicht von unten aufgekündigt wurde und wird, bedeutet für die Lohnabhängigen in den Krisenländern einen verschärften Klassenkampf von oben, um auf das deutsche Niveau der „Wettbewerbsfähigkeit“ aufzuschließen. Der Wettbewerbs- und Krisenkorporatismus der DGB-Gewerkschaften war und ist weiterhin weit entfernt von einer Politik der internationalen Solidarität. Zwar stoßen Äußerungen wie die von Berthold Huber anlässlich des N14-Generalstreiks 2012 auch gewerkschaftsintern auf teils scharfe Kritik,11dass diese reichen würde, die eingefahrene deutsche Gewerkschaftstradition aufzusprengen, ist aber nicht abzusehen. Zudem bleibt es so oder so eine zentrale Aufgabe von Gewerkschaften, den Kampf zwischen Kapital und Arbeit zu moderieren und berechenbar zu machen. Die Erfahrung, dass Gewerkschaften streikbereite Belegschaften zurückhalten, wurde vielerorts gemacht. Und natürlich geht die transformatorische Phantasie der Gewerkschaften kaum über linkskeynesianische Visionen sozialverträglichen Wachstums hinaus. Der gewerkschaftliche Kampf gegen Lohn- und Sozialkürzungen wäre zwar in der gegenwärtigen Konstellation ein objektiv solidarischer Kampf, stieße jedoch spätestens dann an seine Grenze, wenn er so erfolgreich wäre, dass deutsche Arbeitsplätze gefährdet werden, weil zu hohe Löhne – gerade in Krisenzeiten – Kapitalanlagen unprofitabel machen. Diese Grenze wäre nur zu überwinden, wenn die gewerkschaftliche Kritik der schlechten Arbeit den qualitativen Sprung zu einer Kritik der Lohnarbeit selbst machen würde. Das aber würde eine selbstnegatorische Positionierung bedeuten und die Widersprüche, die mit ihr einhergehen, sind für eine repräsentative Interessensorganisation, die als Verhandlungspartner fungieren soll und will, nicht auszuhalten. Eine solche Positionierung, die sich die existierenden Widersprüche bewusst macht, und eine sozialrevolutionäre Organisierung, die diese aushält und bearbeitbar macht, scheint uns jedoch notwendig.12Es sind (unter anderem) die kapitalistischen Vergesellschaftungsmechanismen, die uns immer wieder spalten und in Konkurrenz zueinander setzen – nur wenn wir in der Praxis bewusst gegen sie opponieren, ist wirkliche Solidarität möglich.
3. Klasse
3.1 Selbstorganisierung und Klassenkampf
„Die Proteste werden dann gefährlich, wenn sie als Klassenkampf angesehen werden.“ (Klaus Schwab, Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, 2012)
Vor dem Hintergrund der beschriebenen ökonomischen Situation und der durch sie bedingten, sich verschärfenden Angriffe auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, zu denen der Staat des Kapitals immer wieder ausholt, sowie des Erstarkens antisemitischer, rassistischer und national gesinnter Kräfte, wird eine handlungsfähige Linke immer dringlicher. Im Zusammenhang mit dem Ziel, handlungsfähig zu werden, das heißt auch die eigene Marginalität zu überwinden, ist immer wieder die Rede von der Selbstorganisierung, die in Gang gebracht werden soll und als Ausweg aus der Misere sowie sozialrevolutionäre Perspektive diskutiert wird. Diese Perspektive teilen wir grundsätzlich, doch stellt sich uns zunächst die Frage, wer sich überhaupt als Subjekt dieser Organisierung begreift bzw. begreifen könnte.
Die klassisch marxistische Antwort, es sei das Proletariat oder die
Arbeiter*innenklasse, scheint vor dem Hintergrund, dass sich heute
anscheinend kaum jemand diesen Begriffen zuordnet, äußerst
unbefriedigend und abstrakt. Doch ohne Träger*innen sozialrevolutionärer
Veränderung kann es diese nicht geben. Handlungsfähigkeit unsererseits
ist nicht denkbar ohne das Anknüpfen an potenzielle Subjekte der
Selbstorganisierung. Es stellt sich uns also weiter die Frage, wer diese
sein könnten. Klar ist: Es gibt kein per se revolutionäres Subjekt, so
wenig wie es die ‚Klasse für sich‘ gibt. Der Prozess der Konstituierung
potenzieller Träger*innen sozialrevolutionärer Veränderungen bedarf
vielmehr einer bestimmten Form der politischen Auseinandersetzung,
welche momentan nicht gegeben ist.
a) Gerade in der Krise tritt die Abstraktheit nicht über sich selbst hinausblickender Alltags- und Interessenkämpfe von Lohn- und Reproduktionsarbeiter*innen, Mieter*innen, Student*innen u.a. besonders deutlich hervor. Der Mangel an gesellschaftlicher Kontextualisierung der vereinzelten Kämpfe der Lohnabhängigen und der sie repräsentierenden Organisationen macht sie zu langfristig wirkungslosen Erscheinungen.
Sogar die durch sie verkörperte Hoffnung auf eine punktuelle
Verbesserung der Lebensbedingungen wirkt absurd vor dem Hintergrund des
sich mit totalitärem Gebaren steigernden Verwertungszwangs des Kapitals,
der sich dieser Hoffnung entgegenstellt. Forderungen nach unmittelbarer
und dauernder Verbesserung der Lebensbedingungen werden aus oben
beschriebenen Gründen solange ein endloses und mühseliges Anrennen gegen
die Grenzen der bestehenden Herrschaftsverhältnisse und
kapitalistischen Produktionsweise sein, wie sie die Überwindung dieser
nicht praktisch anstreben, was voraussetzt, sich ihrer bewusst zu
werden.
Erst wenn der Widerspruch zwischen den eigenen Interessen und
Bedürfnissen und denen des Kapitals, der sich in dieser Form des
politischen Kampfes ausdrückt, von den Kämpfenden auf die
gesellschaftliche Totalität bezogen wird, das heißt die eigene Position
innerhalb dieser verortet wird, konstituieren sich potenzielle
Träger*innen sozialrevolutionärer Veränderung. Dieser bewusste
Totalitätsbezug, in dem die eigene Position innerhalb des
Reproduktionsprozesses des Kapitalverhältnisses reflektiert wird, ist
es, den wir als Klassenbewusstsein verstehen.
b) Demgegenüber steht die Abstraktheit der Kämpfe linker Politgruppen, die ihren Blick immer an sich selbst vorbei auf die Abschaffung des Kapitalismus richten. Der Mangel an Verankerung in Alltags- und Arbeitskämpfen macht sie zu wirkungslosen Erscheinungen. Das Selbstbewusstsein, mit dem moralische Appelle auf den alljährlichen Großevents13vorgetragen werden, ist angesichts des fehlendes Einflusses auf die Reproduktionsprozesse gesellschaftlicher Herrschaft absurd.
Auch die linksradikalen Aktivist*innen stehen – daran muss man (sich
selbst) scheinbar immer wieder erinnern – in einem materiellen
Verhältnis zur Verwertung des Kapitals, sind selbst Ausgebeutete. Nur
wenn ihre Kämpfe direkt in dieses Verhältnis eingreifen, haben sie
Einfluss darauf und können so antikapitalistisch wirken. Die Geste des
in der Masse der ihre Gegnerschaft zum Schweinesystem Beteuernden, sich
in seiner Radikalität ebenso wie in seiner Moralität so wohlfühlenden
gestreckten Mittel- bzw. Zeigefingers bleibt solange eine symbolische
Feier der eigenen Ohnmacht, wie sie nicht innerhalb des eigenen
Ausbeutungsverhältnisses stattfindet, die entsprechenden Kämpfe also
nicht in die Reproduktion der bestehenden Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse eingreifen und somit im Bewusstsein der eigenen
Proletarität geführt werden.
Die Forderung nach der Abschaffung des Kapitalismus muss sich aus dem Widerspruch, in dem die Bedürfnisse des eigenen Lebens zu den Bedürfnissen des Kapitals stehen, ergeben; sie bleibt idealistisch, solange sie reine Erkenntnis des gesellschaftlichen Ganzen bleibt und nicht die Bewegung des aus sich heraustreibenden Widerspruchs im Besonderen ist.
Es zeigt sich, dass weder die systemimmanenten Einzelforderungen reiner Interessenkämpfe noch die scheinbar außerhalb des Systems stehenden Forderungen nach der Abschaffung des Kapitalismus ihr Ziel erreichen können – es mangelt ihnen am jeweils Anderen. Es geht also um das alte Problem, dass „die sozialistische Bewegung heute und hier nur dann reale gesellschaftliche Bedeutung gewinnen wird, wenn sie die chinesische Mauer zwischen isolierten Tageskämpfen einerseits [und] weitgespannten sozialistischen Zukunftsvorstellungen andererseits durchbricht“ (SB 1973: 11).
Vor dieser Beziehung bleiben die einseitigen Momente abstrakt. Diese Abstraktheit ist ihre politische Ohnmacht. Das Potenzial beider Formen des Kampfes kann sich nur in ihrer Verbindung realisieren. Der bewusste Kampf gegen die eigene Proletarität schafft die Möglichkeit der Konstituierung eines sozialrevolutionären Selbstorganisierungsprozesses. Die vermittelnde Kategorie beider Pole ist der Klassenkampf, der ohne Klassenbewusstsein nichts ist. Die Subjekte der „Selbstorganisation“ sind die klassenbewussten Proletarier*innen.
----------
Einschub: Klasse, Klassenkampf, Klassenbewusstsein
----------
Zum Begriff der Klasse
Wenn wir hier den Begriff der Klasse hervorkramen und versuchen politisch nutzbar zu machen, geht es uns nicht darum, einen alten Klassenbegriff aufzuwärmen, der zu Recht in vielerlei Hinsicht kritisiert wurde. Gemeint sind hier vor allem die folgenden Kritikpunkte:
1. Die Arbeiter*innenklasse ist kein per se revolutionäres Subjekt (Fetischismus, kein privilegierter Erkenntnisstandpunkt etc.).
2. Auch wenn Klassenkämpfe ein transzendierendes Potential entwickeln können, haben sie zunächst funktionalen Charakter für die Reproduktion des Kapitals, da um die Durchsetzung von Interessen gerungen wird, die sich innerhalb der bestehenden ökonomischen Verhältnisse und Kategorien bewegen.
3. Es existiert kein Automatismus in der Entwicklung von ‚Klasse an sich‘ zur ‚Klasse für sich‘; aus der objektiven Klassenlage ist keine bestimmte Bewusstseinslage abzuleiten.
4. Der Klassenantagonismus stellt nicht den einzigen und auch nicht den Hauptwiderspruch in kapitalistischen Gesellschaften dar.
5. Dennoch ist und bleibt davon auszugehen, das kapitalistische Gesellschaften stets Klassengesellschaften sind – zunächst in dem ganz grundlegenden Sinne, dass sie auf einer Trennung der Produktionsmittel von den unmittelbaren Produzent*innen beruhen, die zugleich mit der Trennung von Lohn- und Hausarbeit, von Produktions- und Reproduktionssphäre einhergeht. Diese Trennung bedeutet, dass die Menschen, die den gesellschaftlichen Reichtum produzieren, nicht über ihn verfügen können, d.h. ihnen ist – in beiden Sphären – die Kontrolle über die zu ihrer Reproduktion notwendigen materiellen, sozialen und zeitlichen Bedingungen entzogen. Dies liegt nicht einfach am bösen Willen der Kapitalist*innen, es ist vielmehr der systemische Charakter der Heteronomie hervorzuheben; die Klassenherrschaft in kapitalistischen Gesellschaften ist in eine Form anonymer, subjektloser Herrschaft eingegliedert, die auch der herrschenden Klasse das Gesetz der Kapitalakkumulation aufzwingt. Dennoch hegt die Kapitalist*innenklasse ein besonderes Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Gesellschaftsordnung. Sie setzt ihre Herrschaft ständig durch ideologische und materielle Gewalt bewusst um. So sind es (auf qualitativ andere Weise) die Bedürfnisse der Lohnabhängigen, die stets zu kurz kommen.
----------
Zum Begriff des Klassenkampfes
Vor diesem Hintergrund bedeutet Klassenkampf nicht schlicht den Kampf von (proletarischer) Klasse gegen (kapitalistische) Klasse, sondern ist als Kampf um die Aneignung der materiellen, sozialen und zeitlichen Bedingungen der Reproduktion bzw. der Bedürfnisbefriedigung zu verstehen, der nicht bloß ein Kampf innerhalb und – im besten Fall – gegen das Klassenverhältnis, sondern auch innerhalb und – im besten Fall – gegen das übergreifende Kapitalverhältnis und andere (etwa rassifizierte, vergeschlechtlichte) Ausbeutungsverhältnisse ist.
Klar ist nach dem bisher Gesagten auch, dass der zunächst rein immanente
Klassenkampf erst innerhalb der konkreten politischen Praxis einen
transzendierenden Charakter erhalten kann (Vgl. hierzu auch Antifa
Kritik & Klassenkampf, 2015). Der Begriff des Klassenkampfes kann
selbst Teil dieser Praxis sein. Er erfüllt für uns eine dreifache
Funktion:
1. Er bietet die Möglichkeit, eine Klammer zwischen verschiedenen Kämpfen (in Produktions- und Reproduktionssphäre) herzustellen.
2. Er verweist auf den potentiellen Widerspruch zwischen den „Bedürfnissen des Kapitals“ (Marx) und den daran hängenden Interessen ihrer privaten und staatlichen Funktionär*innen einerseits und den Bedürfnissen der Lohnabhängigen andererseits.
3. Er kann so zwischen Theorie und Bedürfnissen vermitteln und damit dazu beitragen, dass Kritik und Theorie zur materiellen Gewalt werden (vgl. MEW 1: 385; Heller 1976: 52).
----------
Zum Begriff des Klassenbewusstseins
Die Reproduktion des Kapitals ist abhängig von Voraussetzungen, die es selbst nicht herstellen kann. Es bedarf gesellschaftlicher Sphären und Verhältnisse, die einer anderen Logik folgen als es selbst – wie etwa des Staats oder des patriarchal-heterosexistischen Geschlechterverhältnisses –, die nicht einfach aus ihrer Funktionalität für das Kapital erklärt werden können und auf diese nicht zu reduzieren sind. Das bedeutet, dass die gesellschaftliche Totalität nicht im Kapitalverhältnis aufgeht, sondern umfassender ist. Sozialrevolutionäre Emanzipation bedeutet entsprechend mehr als die Emanzipation vom Kapitalverhältnis: „Der Emanzipationskampf ist nicht auf das (…) ,rein ökonomische‘ Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital zu beschränken, sondern in ihm müssen alle Ungleichzeitigkeiten der Geschichte aktualisiert werden […]. Emanzipation bedeutet Befreiung vom Objektstatus: Selbsttätigwerden in der Geschichte. Selbsttätigkeit kann jedoch nicht frei gewählte Selbsttätigkeit sein, sondern sie muss sich ihrer materiellen Abhängigkeiten bewusst sein.“ (Claussen 1982: 144). Auf Letzteres zielt das Klassenbewusstsein als notwendige Bedingung sozialrevolutionärer Veränderung. Es schließt das anti-fetischistische Bewusstsein über die historisch spezifische Form kapitalistischer Ausbeutung (samt ihrer Voraussetzungen) und ihre Negationswürdigkeit mit ein. Es will nicht auf ein dumpfes Wir-Gefühl jener hinaus, die sich in derselben Position befinden, soll die Subjekte nicht homogenisieren, sondern meint – als negatives – die Einsicht, dass ihre unterschiedlichen Positionen und die damit einhergehenden je speziellen Gründe zu kämpfen einem gemeinsam geteilten Problemzusammenhang (nicht, wie der Traditionsmarxismus meint, einem gemeinsam geteilten Standpunkt) entspringen.
----------
3.2. Bedürfnis und Klassenbewusstsein
„Die Theorie wird in einem Volke nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist […]. Eine radikale Revolution kann nur die Revolution radikaler Bedürfnisse sein.“ (MEW 1: 387)
„Klassenbewusstsein nie als System von Lehrsätzen schulmeisterlich an die Massen herantragen, sondern aus dem Erleben der Masse entwickeln. Politisierung aller Bedürfnisse.“ (Sexpol: 1934)
„To make love and to refuse night work to make love, is in the interest of the class“ (Dalla Costa: 1972)
Wenn wir betonen, dass wir den (Praxis-)Begriff des Klassenbewusstseins für wichtig halten, weil mit diesem der Bezug auf die Totalität kapitalistischer Vergesellschaftung hergestellt werden kann, bedeutet dies nicht, dass wir einem industrieproletarisch verengten Begriff von Klasse aufsitzen. Klar ist: Die konkreten Lebensrealitäten derer, die gezwungen sind, von dem zu leben, was der Verkauf seiner*ihrer Arbeitskraft abwirft bzw. was die Arbeitskraft derer abwirft, von denen sie abhängig sind, sind nichts Homogenes, sondern durch verschiedene Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse in sich weiter fragmentiert. Insofern ergeben sich daraus auch verschiedene Anknüpfungspunkte für die Entstehung von Klassenkämpfen. Klassenbewusstsein kann dann als der Versuch beschrieben werden, im Kampf ein Gemeinsames zu finden: d.h. die eigene Lebenslage auf die Totalität der Gesellschaft zu beziehen, diese als ein verdinglichtes Verhältnis von Menschen zu verstehen, so der Vereinzelung entgegenzuwirken und die gesellschaftlichen Verhältnisse den gemeinsamen Interessen und Bedürfnissen entsprechend zu organisieren. Das Gemeinsame ergibt sich daraus, dass die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse nicht einfach unvermittelt nebeneinander stehen, sondern Teil einer Totalität sind, die gebunden ist an abstrakte Arbeit, Ware, Mehrwert, Akkumulation, Zweigeschlechtlichkeit, geschlechtlich konnotierte, unentlohnte Reproduktionsarbeit sowie an einen rassifizierenden Nationalstaat und Imperialismus.
Klassenbewusstsein ist dabei weit mehr als ein bloß wissenschaftliches
Erkennen, sondern ergibt sich aus der Dialektik von Theorie und Praxis
und vermittelt sich über die Basis- und Selbstorganisierung. Besonders
offen treten die sonst versteckten ökonomischen Kräfte und die dahinter
liegende Gewalt in sozialen Kämpfen hervor, woraus sich Reflexion,
Organisationsbildung und Spontaneität (im Sinne der Selbstorganisation)
ergeben können.
Aus diesem Verständnis heraus halten wir die von Hans-Jürgen Krahl formulierte, an Lukacs anknüpfende Bestimmung von Klassenbewusstsein für einen produktiven Ausgangspunkt. Krahl:
„Klassenbewusstsein ist immer ein ans Durchschauen der Wertabstraktion gebundenes, parteiliches Totalitätsbewusstsein und an die Befriedigung von Bedürfnissen geheftetes produktives Konsumtionsbewusstsein.“ (Krahl 2008: 344).14
Dieser Bezug auf die historisch gewordenen Bedürfnisse erlaubt es, die verschiedenen Lebensrealitäten in das Bewusstsein der Klasse adäquat mit einfließen zu lassen. Zudem können die Bedürfnisse in einer Gesellschaft, in der die Bedürfnisbefriedigung der Menschen nur ein Abfallprodukt der Mehrwertproduktion ist, ein wichtiger Ausgangspunkt für sozialrevolutionäre Veränderungen sein. Dabei sind es insbesondere die Bedürfnisse der Lohnabhängigen, die immer wieder negiert und den herrschenden Verhältnissen subordiniert und eingepasst werden. Eine historische konkrete Analyse und (Selbst-)Reflexion dieser Bedürfnisse (samt ihrer autoritären und regressiven Kanalisierungen) und die veränderte Zusammensetzung der lohnabhängigen Klasse, ihre Bedürfnis- und Bewusstseinsstrukturen sowie ihr Alltagsleben müssen daher untrennbarer Teil einer sozialrevolutionären Strategie und Praxis sein.
Gegenwärtig sehen wir vor allem, dass sich die Widersprüche in der gesellschaftlichen Sphäre der Reproduktions- und Fürsorgearbeiten zuspitzen. Die Einschnitte in die Bedürfnisstruktur der lohnabhängigen Klasse werden hier besonders spürbar. Gerade in den Bereichen, um die sich aus historischen Gründen feministische Kämpfe drehen, da aufgrund der patriarchalen Arbeitsteilung und sexistischer Sozialisationsprozesse vor allem Frauen in ihnen arbeiten müssen, durchschneidet das Kapital grundlegende menschliche Lebensbedürfnisse. Auch die Widersprüche in dieser Sphäre nehmen der lohnabhängigen Klasse die Möglichkeit, Zeit füreinander zu haben, zu lieben, Zuneigung zu zeigen, sich zu bilden und zu einer menschenwürdigen Behandlung in der Kindheit und bei Pflegebedürftigkeit. Die Rückkopplung der eigenen Interessen und Bedürfnisse an die Totalität des Kapitalverwertungsprozesses bedeutet daher, dass eine feministische Perspektive ein untrennbarer Teil des Klassenbewusstseins sein muss. Um dies adäquat zu fassen, scheinen uns zwei Diskussionsstränge unabdingbar für eine Aktualisierung des Klassenbewusstseinsbegriffs. Das ist zum einen die materialistische Diskussion über Bedürfnisse und zum anderen die von feministischen Ökonom*innen angestoßene Diskussion über Fürsorgearbeiten, wie sie momentan beispielsweise in der „Care-Revolution“-Bewegung geführt wird.15
Eine materialistische Perspektive auf Bedürfnisse tritt einem unmittelbaristisch oder ontologisch gefassten Bedürfnisbegriff entgegen.16Bedürfnisse sind nicht ahistorisch als richtige oder falsche, allgemein-menschliche oder spezifisch-kapitalistische Bedürfnisse zu kategorisieren.17In kapitalistischen Verhältnissen ist es die erste Bedingung der Produktion einer Ware, dass sie „menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt“ (MEW 23: 49). Die Herrschaft des Kapitals ist damit aber nicht nur in ihrem Innersten von den bedürftigen Menschen abhängig, sondern produziert gleichzeitig seine Bedürftigkeit auf historisch qualitativ spezifische und neue Weise. Gleichzeitig können, da die Produkte gesellschaftlicher Arbeit privat angeeignet werden, die von der kapitalistischen Produktionsweise hervorgerufenen Bedürfnisse nur durch Zahlung befriedigt werden. Diese systematische Restriktion der Bedürfnisbefriedigung, ihre Subsumtion unter die Zahlungsfähigkeit, bedeutet, dass die gesellschaftlich produzierten Bedürfnisse ein die Herrschaft des Kapitals transzendierendes Potential enthalten. Gleichzeitig sind sie – mit H. Marcuse – zu verstehen als bereits von Herrschaftsinteressen der bestehenden Gesellschaft historisch geformte und durch den Sozialisationsprozess vermittelte. Sie sind Resultat einer Verinnerlichung der Leistungs- und Konkurrenzanforderungen des Kapitals an die Lohnabhängigen und tragen so zur kulturellen und psychischen Verelendung bei. In dieser Hinsicht sind sie Modalitäten der Aggression und des Elends, die die Unterdrückung verewigen.
Bedürfnissen kommt damit ein Doppelcharakter zu: Sie sind immanentes,
das Kapital stützendes und ihm verpflichtetes Produkt kapitalistischer
Produktionsweise und gleichzeitig ihr von ihr selbst hervorgebrachter
Totengräber. Das Radikale am Bedürfnis lässt sich mit Hilfe
allgemeingültiger Maßstäbe praktisch realisieren, „die sich auf die
optimale Entwicklung des Individuums, aller Individuen, beziehen unter
optimaler Ausnutzung der materiellen und geistigen Ressourcen, über die
der Mensch verfügt“ (Marcuse 1970: 26) und die sich historisch weiter
entwickeln. Radikal sind Bedürfnisse, insofern sie zur Abschaffung von
entfremdeter Lohnarbeit, Leid, Armut und Krieg hintreiben – sie zielen
auf Kooperation und Solidarität, auf Befriedung, Kontemplation und Muße.
Kurz: Es sind menschliche Bedürfnisse auf der Höhe des historisch
Möglichen und Wünschbaren und als solche befinden sie sich in einem
antagonistischen Verhältnis zur bestehenden Gesellschaft. Indem die
politische Praxis diese aufgreift, kann ein Bewusstsein befördert
werden, das die Grenzen der Repression überschreitet. Der Blick auf die
Produktion und Negation der Bedürfnisse bringt die verschiedenen
Spaltungslinien der kapitalistischen Herrschaft zu Tage.
Die strategischen Diskussionen rund um das Konzept der „Care-Revolution“ fordern ebenfalls einen bedürfnisgeleiteten Perspektivwechsel im politischen Handeln ein. Es geht darum, dass bei diesem „die Verwirklichung menschlicher Lebensinteressen und damit die Verfügung über die relevanten Lebensbedingungen zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse im Zentrum stehen.“ (Winker 2011: 9). In den Mittelpunkt rückt so die Frage nach Zeit und Ressourcen zur Selbstsorge und zur Sorge für andere, d.h. nach Tätigkeiten, die zur Befriedigung menschlicher Lebensbedürfnisse notwendig sind. Diese Orientierung finden wir gut und richtig und denken, dass sich in dieser Bestimmung ein wichtiges Element der aktuellen Form von Klassenbewusstsein finden lässt.18
Die strategische Bedeutung dieser Orientierung ergibt sich aus einem
zentralen Widerspruch der Kapitalverwertung unter neoliberalen
Bedingungen; d.h. einem zentralen Problem heutiger
Akkumulationsstrategien: der wachsenden Spannung zwischen der
Güterproduktion und der sozialen Reproduktion. Letztere findet – nicht
zuletzt aufgrund des verschärften Klassenkampfs von oben im Zuge der
Krise des Fordismus und der damit einhergehenden Auflösung des
klassischen fordistischen Familienernährer/ Hausfrauen-Modells (ein Lohn
reicht nicht mehr für eine ganze Familie aus) – immer stärker in
kommodifizierter und rationalisierter Form statt und macht einen stets
größeren Teil der gesellschaftlichen Arbeit aus. Bei diesen sozialen
Reproduktionsarbeiten (von denen Care-Arbeit ein Teil ist) stehen
Subjekt-Subjekt-Verhältnisse im Vordergrund, die nicht ohne eine
emotionale Basis, Verantwortlichkeit, Kommunikation und eine
Abhängigkeitshierarchie zu denken sind. Die durch diese Qualitäten
charakterisierten Arbeitsprozesse können aber nicht beliebig
rationalisiert, verkürzt oder von Maschinen übernommen werden. Daraus
entsteht das Problem der divergierenden Produktivitäten: Während die
Güterproduktion ständig weiter rationalisiert werden kann, stößt die
Rationalisierbarkeit der Care-Tätigkeit sehr schnell an ihre Grenzen. In
Ansätzen gehandhabt werden kann dieses Problem nur durch einen starken
Druck auf die Löhne mitsamt einem rassistischen Migrationsregime zur
Herstellung eines Markts von illegalisierten
Billiglohn-Carearbeiter*innen und dem Versuch der „Verobjektivierung der
Subjekt-Subjekt Beziehungen“ (Madörin 2007: 157).
Diese Verschärfungen der Arbeitsbedingungen im Sektor der sozialen
Reproduktion betreffen nicht, wie in der patriarchalen Gesellschaft gern
geglaubt wird, nur einen kleinen gesellschaftlichen Teilbereich – das
hier verausgabte Arbeitsvolumen übersteigt das der „produktiven“
Lohnarbeit um das 1,7fache (vgl. Winker 2011). Aus dem Subjekt-Subjekt
Charakter dieser Arbeitsverhältnisse ergibt sich hier zudem ein
doppelter Ansatz für den Klassenkampf. Sowohl die Arbeiter*innen als
auch die, um die sie sich kümmern, haben ein Interesse daran, dass diese
Arbeiten nicht mehr unter den Zwängen der Kapitalverwertung
stattfinden. Praktisch könnte dies etwa in Krankenhausstreiks werden,
die von allen dort Arbeitenden und den (potentiellen) Patient*innen
zusammen geführt werden.
Die in den Klassenkampf und das Klassenbewusstsein einfließenden radikalen Bedürfnisse sind mehr als rein materielle und doch von existenzieller Bedeutung für die Klassenindividuen. Das Kapital durchschneidet die einfachsten Lebensbedürfnisse der Lohnabhängigen und stürzt sie in Armut, Burn-out, Vereinzelung, massenindustrielle Kranken- und Altenverpflegung etc. pp. Diese Erkenntnis, die psychisches und zwischenmenschliches Elend auf die Totalität der Kapitalverwertung rückbezieht, scheint uns daher ein untrennbares Element des heutigen Klassenbewusstseins zu sein.
3.3 Exkurs: Zur Kritik der Zurückweisung des Klassenbegriffs am Beispiel des …umsGanze-Bündnisses
Seit einigen Jahrzehnten herrscht in bestimmten Teilen der Linken die Auffassung vor, der strategische Bezug auf Klassenkonzepte sei irgendwie antiquiert und auf jeden Fall ein Ausweis von verbohrtem Dogmatismus. Nach unserer Überzeugung stellen die stattdessen angewendeten Konzepte und Bezüge keine befriedigende Alternative dar, vielmehr führen sie leider allzu oft in strategische Sackgassen.19
Ein bekanntes Beispiel dafür, in welche idealistischen Fallstricke man gerät, wenn man sich von der lohnabhängigen Klasse als Bezugspunkt für gesellschaftliche Veränderung verabschiedet, ist das seit einigen Jahren bundesweit aktive …umsGanze-Bündnis (UG). In einem Interview vom Januar 2014 äußerte sich ein offizieller Vertreter des Bündnisses zu ihrem Verständnis von Klasse und Klassenbewusstsein folgendermaßen:
„Das Klassenbewusstsein in Deutschland, die Zahl der Lohnabhängigen und der Prekären sind auch für uns nicht Ausgangspunkt unseres Organisierungsprozesses oder unserer Theoriearbeit. Solche persönliche Betroffenheiten und Interessen enden regelmäßig in nationalen Standortlogiken statt in emanzipatorischen Ideen und wären daher eher zu überwinden.“ (ND 25.01.2014)
UG verweigert der Kategorie des Klassenbewusstseins jeglichen politisch-emanzipatorischen Sinn, was kaum verwunderlich ist, wenn die Lage der Lohnabhängigen – die gesellschaftliche Tendenz zur Individualisierung und Entsolidarisierung verdoppelnd und verstärkend – zu persönlicher Betroffenheit entpolitisiert wird. Vom Klassenbewusstsein bleibt so nur noch das empirische vorfindliche Bewusstsein der Lohnabhängigen übrig und das sei nun mal in aller Regel standortnationalistisch. Wie man zu solchen Annahmen kommt, zeigt ein Blick in die Grundsatzbroschüre von UG, in der ebenfalls sehr knapp auf die Frage des Klassenbewusstseins eingegangen wird:
„Die Abhängigkeit der Staatsbürger von der nationalen Reichtumsproduktion überlagert objektiv den Klassengegensatz[…]. Dass sich die Proletarier aller Länder im Ersten Weltkrieg gegenseitig zu Hunderttausenden fürs jeweilige Vaterland abschlachteten,[…] dokumentiert nicht in erster Linie fehlendes ‚Klassenbewusstsein‘. Es offenbart viel mehr den historischen Stand der objektiven Verstaatlichung der Proletenklasse, ihre Integration ins nationalökonomische ‚Wir‘. […] Gegenüber der Perspektive eines ›revolutionären Internationalismus‹ gehörte es bereits damals zu den handfesten Erfahrungen der Proleten, dass ihr Auskommen von der nationalökonomischen Gesamtbilanz ihres Staats in der Kolonial- und Weltmarktkonkurrenz abhing. Und dass sie in diesem Rahmen tatsächlich etwas zu gewinnen und zu verlieren hatten.“ (UG 2009: 41).
Nun war ein weltgeschichtlich nicht ganz unbedeutendes Ergebnis des Weltkriegs die bolschewistische Oktoberrevolution, die unter dem Motto „Brot und Frieden“ weite Teile des Proletariats hinter sich vereinen konnte und auch in vielen anderen europäischen Ländern kam es zu Räteerhebungen, die nur mit der geballten Kraft der Konterrevolution niedergeschlagen werden konnten. Doch nicht nur historisch, sondern auch theoretisch wird hier einiges ausgelassen.
Die Bewusstseinslage der Proleten, ihre subjektive Integration, leitet
sich für UG aus der objektiven Verstaatlichung bzw. Integration ab. Das
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft stellt sich allerdings etwas
komplexer dar, wie man der psychoanalytisch informierten, marxistischen
Subjekttheorie entnehmen kann.
In den freudomarxistischen Diskussionen und denen der Kritischen Theorie, die angesichts des Ausbleibens des automatischen Fortschritts in der Geschichte und des Aufkommens der faschistischen Massenbewegungen geführt wurden, ging es stets um die Frage, wie es dazu kommen kann, dass Teile des Proletariats und vor allem des Kleinbürgertums sich kapitalistische Interessen zu eigen machen, also subjektiv den Standpunkt des Kapitals vertreten und dies beispielsweise durch das Einnehmen nationalistischer Positionen äußern. Max Horkheimer formulierte diese Fragestellung folgendermaßen: „Es wäre zu erforschen, wie die psychischen Mechanismen zustande kommen, durch die es möglich ist, dass Spannungen zwischen den gesellschaftlichen Klassen, die auf Grund der ökonomischen Lage zu Konflikten drängt, latent bleiben können.“ (Horkheimer 1988: 60). Durch die Integration der Psychoanalyse in die marxistische Gesellschaftstheorie konnte gezeigt werden, wie die äußere Gewalt vermittelt über die familiäre Sozialisation zu einer im Über-Ich verankerten inneren wird und sich dabei autoritäre und passive Subjekte herausbilden, die sich lieber mit den bestehenden Mächten identifizieren, anstatt die Gesellschaft als in der Praxis veränderbar zu begreifen (siehe beispielsweise: Freud StA VII:23-30; Reich 1934; Fromm, Horkheimer, Marcuse 1987; Adorno 1995). Die dabei verwendeten Begriffe wie Unbewusstes, Trieb, Über-Ich und Verdrängung sind aber solche des Subjekts und seiner historisch gewordenen Natur, aber keineswegs solche der Außenwelt. Für diese gelten weiterhin die Kategorien einer historisch konkreten, materialistischen Gesellschaftsanalyse, wie es Horkheimer auch in dem angeführten Zitat deutlich macht. Aus dieser Perspektive geht es nicht nur darum, „was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat, als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist.“ (MEW 2: 38).
Dass die Interessen der Lohnabhängigen selbst widersprüchlich sind (abhängig von der nationalen Reichtumsproduktion und gleichzeitig nur gegen die Profitinteressen der Einzelkapitale durchsetzbar); dass der Klassenkonflikt aller objektiven und subjektiven Integration zum Trotz bestehen bleibt und dass die Produktion nationalen Reichtums damit weiterhin auf durchaus erfahrbarer Ausbeutung basiert, kommt bei UG nicht mehr in den Blick. Entsprechend verschweigt UG, dass die Beteiligung der Proleten am nationalen Reichtum immer durch die Artikulation proletarischer Interessen in sozialen Kämpfen durchgesetzt werden musste und den Lohnabhängigen nicht einfach von den Herrschenden aus akkumulationsstrategischen Rücksichten geschenkt wurde. Denn in einer Gesellschaft, die objektiv immer wieder zur Desintegration und Krise treibt, vollzieht sich Integration nicht bruchlos. Materialistische, auf Befreiung zielende Kritik muss in der Lage sein, solche Bruchstellen zu sehen und die Verhältnisse von Immanenz und Transzendenz, von Aktualität und Potentialität, zu bestimmen und die bestehenden Widersprüche zu denken.
Es gilt zu betonen, dass das Klassenbewusstsein – als gegen die reale
Bewusstseinslage zu entwickelndes – dazu in der Lage ist, den stets
latenten Klassenkonflikt in emanzipatorischer Perspektive auszutragen.
Es wäre das Antidot, um die subjektive Integration des Proletariats
aufzubrechen und entsprechend das genaue Gegenteil von Nationalismus. Es
ist ein frontaler Angriff auf die kapitalistischen Ideologien, das
Bewusstsein darüber, dass Lohnarbeit dumm und krank macht und deswegen
auf einer weltweiten Ebene überwunden werden muss. Wo ein solcher Bezug
fehlt, der zugleich ein Bezug zu den realen Problemlagen und Interessen
der Lohnabhängigen ist, landet man in Sackgassen. Im unmittelbaren
Anschluss an die oben zitierte Interviewpassage klingt das bei UG dann
so:
„Wir überlegen, was wir selbst relevant und wichtig finden, und versuchen, andere davon zu überzeugen, Angebote zu schaffen und Mitstreiter zu gewinnen.“ (ND 25.1.2014)
Hier wird also – ohne zu analysieren, wer denn ein Bedürfnis nach der Überwindung der bestehenden Gesellschaftsordnung haben könnte – eine PR-Strategie mit linksradikalem Inhalt vorgeschlagen. Die unglückliche Vereinigung von Positivismus und Ableitungsmarxismus in diesem Interview, die das Begreifen realer Widersprüche verunmöglicht, führt in die aporetische Wahl zwischen Resignation, die sich aus dem totalen Verblendungszusammenhang begründet, für UG aber natürlich nicht infrage kommt, und Idealismus, der sich in einer Mischung aus Diskurspolitik (andere überzeugen) und Marketing (Angebote schaffen – was in der Regel heißt: Kampagnen starten) verheddert. Es wird abstrakt die ganze Gesellschaft adressiert und gehofft, dass sich nach und nach immer mehr Leute dieser Bewegung anschließen werden. Nur: Wer außerhalb der „Szene“ soll sich von Parolen wie #Kommunismussupergeil, „Kommunismus statt Schweinesystem“ oder „Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse“ angesprochen fühlen?20
4.Praxis
Nach der theoretischen Betrachtung der aktuellen Situation nun der Sprung in die Praxis. Die zu Beginn der Krise aufgekommenen Hoffnungen, dass die Krise auch in Deutschland, dem imperialistischen Zentrum Europas, zu verschärften sozialen Konflikten emanzipatorischen Gehalts führen würde, haben sich bisher nicht erfüllt. Der Großteil der Menschen scheint eine Haltung von grün bis tiefbraun einzunehmen, die eine Verteidigung des Standorts Deutschland als alternativlos akzeptiert. Zu den Abwehrkämpfen abseits linksradikaler Wunschprojektion und tatsächlicher, aber marginalisierter, Intervention lässt sich mit der Stadt-AG, Avanti Berlin festhalten: „Abwehrkämpfe gibt es, doch antikapitalistische Ansätze oder gar Utopien stoßen auf Desinteresse.“ (Avanti Berlin: 2013). Anders sieht es auf Grund der dramatischen Konsequenzen in den stärker betroffenen Ländern aus, nur fehlen auch dort bisher sichtbare Erfolge. Die durchaus beachtenswerten Aktionen und Prozesse der Solidarisierung und Selbstorganisierung konnten die krisenpolitischen Angriffe der Troika nicht abwehren. Zudem kommt es zu keiner nennenswerten Verbindung zwischen den Betroffenen dort und den weniger Betroffenen hier. Dagegen haben reaktionäre, vermeintliche Krisenlösungen Hochkonjunktur, wie die Europawahlen 2014 zeigten: der Front National in Frankreich, die United Kingdom Independence Party, die Jobbik in Ungarn oder die Alternative für Deutschland konnten hohe Wahlergebnisse erzielen. Bis tief ins bürgerliche Lager zeigen sich starke Tendenzen nach rechts. Auf den Montagsdemonstrationen seit 2014 absorbierte eine komplett verballerte, antisemitische Verschwörungsideologie das Unbehagen der Menschen mit den klassisch linken Themen Frieden und Antimilitarismus. Mit PEGIDA und Co., gegen Ende des Jahres, trat offen zu Tage, wie es um den Bewusstseinsstand der sogenannten Mitte der Gesellschaft steht. Die herrschende Politik reagiert, wie Anfang der 1990er, mit einer Verschärfung der Asylregelungen.
Aus dieser kurzen Bestandsaufnahme lässt sich für uns nur der Schluss ziehen, dass es umso dringender einer linken Politik bedarf, die sich aus ihrer Zurückgezogenheit und dem Zurückgedrängtsein herausarbeitet. Auf der einen Seite antifaschistisch, mit dem offensiven Entgegentreten rechter Tendenzen von populistisch bis radikal und andererseits mit der Verbreitung eigener Analyse und der solidarischen Intervention in bestehende und dem Führen eigener Klassenkämpfe. Von Beginn der Krise an ist es vermessen gewesen, in die Krise und die damit verbundene eigene Politik alle Hoffnung auf ein emanzipatorisches Vorhaben zu setzen. Angesichts der Gefahr und bitteren Realität reaktionärer Krisenantworten bleibt uns jedoch nichts anderes übrig, als jetzt unsere eigenen Analysen, unsere Politik und Alternativvorschläge kritisch zu hinterfragen und umso schärfer in die Auseinandersetzungen zu gehen.
Welche übergreifenden Kriseninterventionsversuche der Linken gab es bisher? In der öffentlichen Wahrnehmung: Die Demonstrationen „Wir zahlen nicht für eure Krise“ 2009 und 2010, die abgesagte Bankenblockade der AG Georg Büchner im Oktober 2010, der Aktionstag des M31-Bündnisses im März 2012 und die Blockupy-Aktionen 2012, 2013 und 2014. Während M31 versuchte, eine antikapitalistische, antiautoritäre Antwort auf die Krise zu geben, ging es in den anderen Versuchen eher darum, breite Bündnisse des Protests gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung und anderer Krisenakteur*innen zu schmieden. Kapitalismuskritische und antikapitalistisch organisierte Akteur*innen wollten in einer großen Klammer an feststehenden Tagen „einen öffentlichen Streit um die […] Krisenpolitik entfachen“ (Blockupy im Mai 2012: 9). Eine darüber hinausgehende Basisarbeit mit Krisenbezug blieb zeitlich und räumlich weitestgehend marginal und konnte das Ziel eines tatsächlichen Eingriffs in die Krisendynamik nicht erreichen.
Unser Strategiepapier kann nicht der Ort der vertieften
Auseinandersetzung mit vergangenen Interventionsversuchen sein. Hier
lediglich eine Anmerkung zu Blockupy, die auf unseren Praxis-Vorschlag
einstimmen soll: Blockupy ist es gelungen, auf der Aktionsebene
gesellschaftliche Kräfte zur Form des Protests über einen längeren
Zeitraum zu bündeln und auch immer wieder die eigene Politik-Form zu
verändern und sich über die Zeit z.B. in Richtung Arbeitskämpfe und
Transnationalität zu entwickeln. Über die gemeinsame Praxis wurde so ein
gemeinsamer Raum für Politik eröffnet. Fraglich erscheint uns jedoch,
wie die unterschiedlichen Bündnispartner*innen zusammen die Protestebene
überwinden wollen, ohne ein Verständnis der gegenwärtigen
Herrschaftsformationen zu teilen. Der Ort für eine inhaltliche
Annäherung scheint über die gemeinsame Praxis geschaffen, wir bleiben
gespannt, ob sich dies auf die organisierenden Schwergewichte auswirkt
oder eher dem Zufall und Einzelinitiativen am Rande von Konferenzen
überlassen wird.
Seitdem sich der Großteil der radikalen Linken von Arbeitskämpfen entkoppelt hat und ohne gesellschaftlich verankerte Bewegung agiert, sind Events die vorherrschende Form der eigenen Politik geworden. Grundsätzlich halten wir Großmobilisierungen weiterhin für einen wichtigen Bestandteil politischer Arbeit, wenn es darum geht, sichtbar zu werden und gesellschaftliche Konflikte zuzuspitzen, Meinungshoheiten medial zumindest zu kontrastieren und einen gemeinsamen Ausdruck ansonsten vereinzelter Tageskämpfe zu finden. Doch geben erfolgreich organisierte Großdemonstrationen und „Blockaden“ einer EZB oder ähnlichen Zielen mit Systemcharakter nur Auskunft über eben unsere Fähigkeiten der Organisation und Mobilisierung und nicht unserer gesellschaftlichen Wirkung. Bezogen auf „uns“, die Organisierenden und Demonstrierenden, muss festgestellt werden, dass es nicht einfach darum gehen kann, Zehntausende auf die Straße zu bringen, die in ihrer Freizeit den Kapitalismus kritisieren, um ihm danach wieder voll und ganz zur Verfügung zu stehen.21Bezogen auf die bisher befriedeten lohnabhängigen Zuschauer*innen lässt sich sagen, dass ein kritisches Bewusstsein eben äußerst selten als von außen herangetragene Position in Form von Demonstration, Flugblatt und Medienbericht entsteht. Inwiefern wir die systemrelevanten Akteur*innen mit unseren Events unter Druck setzen, ist schwer zu sagen. Das Geheule der Gegenseite ob eines gesellschaftlichen Auseinanderbrechens vor und nach jedem Event ist nicht viel mehr als kalkulierte Angstmache. Der Kostenfaktor eines verlorenen Arbeitstages durch die Blockade eines Geschäfts ist unwesentlich, verglichen mit der alltäglichen Verwertung. Unsere Solidaritätsbekundungen mit den Kämpfenden anderer Ländern blieben das, was sie eben sind: verbale Äußerungen. Was es unserer Ansicht nach in den hiesigen Verhältnissen hingegen braucht, ist eben die kontinuierliche dezentrale, aber strategisch fokussierte Aktivität in Produktion und Reproduktion, also dort, wo Alltag und Kritik ihre momentane Trennung überwinden könnten. Nur diese könnte uns in die Lage versetzen, das Funktionieren des kapitalistischen Systems, auch im Sinne anderer Betroffener, zu behindern. Erst auf Grundlage dieser im Alltag verankerten Strukturen würde ein Event mehr sein als Protest, eben der oft benannte, aber selten eingelöste „Kristallisationspunkt“ vorhandener Kämpfe.
Der M31-Ansatz war zunächst der Versuch einer krisenbezogenen transnationalen Organisierung. Ziel war es hierbei, sich nicht auf den Protest zu beschränken, sondern gemeinsam wirksamen Widerstand an den Orten zu leisten, wo es um die Bedürfnisse der Menschen (im Betrieb, den Unis etc.) geht. Ein Ergebnis der Zusammenarbeit war das M31-Generalstreikpapier (M31-Netzwerk 2013a,b), in dem der Vorschlag eines transnationalen Netzwerks kritischer Solidarität unterbreitet wurde. Doch gerade in der angedachten Vernetzung taten sich einige Probleme auf. Der Versuch, zunächst innerhalb der radikalen Linken Mitstreiter*innen für diese Idee zu finden, um dann lokale Aktionsbündnisse auf die Beine zu stellen und die geführten Kämpfe auf einen möglichen europäischen Generalstreik hin zu bündeln und sichtbar werden zu lassen, scheiterte. Dazu führten neben dem offenliegenden Fakt der Unbestimmbarkeit eines möglichen Streikdatums und damit einer fehlenden konkreten Mobilisierung auch andere Faktoren. Der Inhalt des Generalstreikpapiers ließ vieles unkonkret und damit viele Interpretationsmöglichkeiten, was vielleicht nicht unbedingt andere Gruppen dazu motivierte, sich dem Projekt anzuschließen. Unklar bleibt auch, inwiefern das Konzept der kontinuierlichen (und eigentlich wichtigeren) Aufbauarbeit der Vernetzung von der Symbolik des Generalstreiks verdeckt wurde, denn auch die Vernetzung mit anderen Kämpfen verlief nur schleppend, und das umso mehr, als dass keine tragfähige Basis entstand, die bei der Ansprache potenzieller neuer Partner*innen Zugkraft hätte entwickeln können. Sicherlich ist die Ungleichzeitigkeit von gesellschaftlichen Kämpfen ein Problem dabei gewesen, aus den Startlöchern zu kommen, andererseits hätte es aber auch mehr Gruppen und Zusammenhänge gebraucht, die das Projekt gemeinsam tragen. Die somit ins Leere laufende Vernetzung ohne konkrete Kämpfe und konkrete Perspektive schlief schließlich auf Bundesebene ein. Dabei muss sich das Netzwerk auch an die eigene Nase fassen. Es hat es nicht geschafft, untereinander eine breitere Diskussion über die strategische Ausrichtung des Netzwerks voranzutreiben.
Soviel zur Vergangenheit, jetzt zu unserem Strategie-Vorschlag,
ausgehend von den beschriebenen Beobachtungen und Erfahrungen und
aufbauend auf unserem aktuellen Diskussionsstand. Letzteres sei noch
einmal betont, um zu unterstreichen, dass wir nicht davon ausgehen, eine
Lösung für das Dilemma der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit der
Linken gefunden zu haben, sondern gemeinsam ernsthaft nach Auswegen
suchen wollen. In unserem folgenden Vorschlag unterscheiden wir Inhalt,
Organisation und die angedachte Praxis.
Inhaltlich geht es uns um nichts weniger als die soziale Revolution, aufbauend auf unserem oben dargelegten Verständnis von kapitalistischer Gesellschaft und Klassenkampf. In diesem Sinne verstehen wir die soziale Revolution als Überwindung der Klassenverhältnisse und als Prozess der Selbstaufhebung des Proletariats und der Abschaffung der Lohnarbeit. Dieser hier umrissene Ansatz soll in Abgrenzung zu Kategorien wie der Multitude oder konstituierender Macht (Hardt, Negri), oder auch einem bloßen gemeinsamen Forderungskatalog (Roth, Papadimitriou), Grundlage unserer politischen Arbeit sein. Das häufig konstatierte oder gesuchte Gemeinsame der Kämpfe ist zunächst nicht – ontologisch verbürgt – als Positives gegeben bzw. lässt sich nicht als politisches Programm vorgeben. Das Gemeinsame besteht zunächst als Negatives, als geteilter Problemzusammenhang, und das Positive kann sich erst im Kampf dagegen als Gemeinsames entwickeln. Die von uns hier entfaltete erweiterte Kategorie des Klassenbewusstseins ist theoretischer Ausgangspunkt unseres Strategievorschlags, um die Protestierenden und Kämpfenden – also nicht zuletzt auch uns selbst – zu einer Reflexion ihrer/unserer jeweiligen gesellschaftlichen Position zu provozieren, die nicht bei einer Politik der ersten Person stehenbleibt, sondern auf die gesellschaftliche Totalität als den gemeinsamen Bezugspunkt abhebt. Dabei geht es nicht darum, vorhandene Kämpfe unter dem Begriff des Klassenkampfes zu subsumieren, sondern diese viel eher wieder um die mit dem Klassenbegriff verbundenen Aspekte kapitalistischer Vergesellschaftung zu erweitern. Es geht also um den Versuch, den spezifischen Kampf um 2% mehr Lohn oder gegen die Maßnahmen der Agentur für Arbeit über die unmittelbaren Interessen hinaus zu ‚politisieren‘. In der Praxis vermittelt sich der gesellschaftliche verbindende Problemzusammenhang im Prozess der praktischen Solidarisierung. Solidarität ist dabei sowohl Voraussetzung für das praktische Entstehen von Klassenbewusstsein wie auch als dessen Resultat zu begreifen. Durch die Versuche, die Durchsetzung der eigenen Interessen mit der Durchsetzung anderer Interessen – die auch durchaus gegensätzlich sein können – zusammenzuführen, entstehen praktisch motivierte Fragen nach realen Trennungs- und Verbindungslinien zwischen den Kämpfenden im gesellschaftlichen Funktionszusammenhang. Auf dieser Grundlage können die Möglichkeiten gemeinsamer Praxis diskutiert werden und erst durch diese geteilte Perspektive kann ein wirklicher Austausch, eine gemeinsame Politik unter den Kämpfenden entstehen.
Ausgehend von der momentanen Situation in der BRD geht es uns
zunächst darum, die oft zu findende Trennung zwischen den „politischen
Gruppen“ (also denen mit Bezug zur gesellschaftlichen Totalität) und den
für konkrete Verbesserungen Kämpfenden aufzuheben. Für die Praxis
bedeutet das schlicht (das Einfache, das schwer zu machen ist): dort
hinzugehen, wo die Lohnabhängigen Probleme kriegen und sich gegen diese
auflehnen, und sie nach Möglichkeit und Absprache zu unterstützen.
Solche Ansätze einer praktischen Solidarität gibt es immer wieder und
immer noch von Einzelpersonen, Gruppen und auch punktuell durch größere
Bündnisse, aber eben nicht forciert als langfristige, übergreifende
Organisierung, welche wir hier vorschlagen wollen. Damit
Solidarisierungsprozesse nicht einfach wieder verpuffen, bedarf es einer
Verfestigung der entstehenden Kommunikations- und
Koordinationsstrukturen in einer Organisierung, die vor allem als
Informations- und Kommunikationsstruktur fungiert. In ihr können
Erfahrungen geteilt, reflektiert und weitergegeben werden, sowie
gemeinsame Aktionen zeitlich, räumlich und inhaltlich koordiniert
werden. Ziel einer solchen Organisierung muss es unseres Erachtens sein,
die Selbsttätigkeit der Kämpfenden zu fördern, ganz in dem oben
erwähnten Sinne, dass Emanzipation das Selbsttätigwerden in der
Geschichte bedeutet.
Drei Dimensionen halten wir hierfür zunächst für sinnvoll, welche zwar möglichst zeitnah, aber eben auch in ihrer je notwendigen Zeit nebeneinander wachsen sollen. Auch wenn wir im Sinne einer verständlichen Darstellung den unterschiedlichen Dimensionen im Folgenden bestimmte Aufgaben zuweisen, ist es uns wichtig zu betonen, dass alles auf allen Ebenen im Sinne der Selbsttätigkeit geschehen kann und muss:
1. Politische Gruppen und politisierte Kämpfe (dazu zählen für uns z.B. auch linke Gewerkschaftsinitiativen) organisieren sich nach ihren eigenen Interessen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und gehen solidarisch auf die Kämpfe in ihrer Umgebung/Sparte zu und unterstützen diese möglichst in einer regionalen Basisorganisierung. Dies ist die Ebene einer konkreten Vernetzung, welche an den Alltagsinteressen der Menschen (im Betrieb, der Uni, in der Hausarbeit etc. pp.) ansetzt und hier die Basis, wie auch Kontakte und Orte (real, wie virtuell) für eine gemeinsame solidarische Politik schafft. Damit einher geht für uns die gegenseitige Hilfe durch Erfahrungsaustausch sowie technische als auch finanzielle Hilfe.
2. Eine überregionale Vernetzung der bereits politischen Gruppen/Kämpfe und regionalen Bündnisse ermöglicht es zunächst ganz praktisch, überregional handlungsfähig zu werden. Nach innen soll diese überregionale Verbindung unser Ort der gemeinsamen politisch-strategischen Beratung und politische Konstante sein. Jedoch soll sie dabei kein Ort der zentralen Entscheidungsgewalt über die Kämpfe vor Ort sein. D.h. die Initiativen der Basis müssen hier nicht abgesegnet werden. Ziel der Vernetzung ist es, zu einer möglichst gemeinsamen, koordinierten Praxis zu gelangen, die über alle kurzfristigen Mobilisierungen, Events und Standortlogiken (lokal, wie national) hinausweist und spürbar in die Reproduktion der Verhältnisse eingreift.
3. Der Aufbau eines Büros zur organisatorischen Unterstützung der Beteiligten. Dieser Punkt mag auf Grund der Erfahrungen mit Gewerkschaftsapparaten u.Ä. zunächst strittig klingen, ist aber von uns hauptsächlich als ein von den Beteiligten, wie von Außenstehenden erreichbarer und handlungsfähiger Informations- und Kommunikationsknotenstern gedacht (vgl. Dath 2014: 21), dessen Aufgabe es wäre, die direkten Verbindungen unter den Beteiligten zu stärken. Von hier kann und soll keine inhaltliche und organisatorische Linie vorgegeben werden, sondern die Selbsttätigkeit und Selbstorganisierung gefördert werden. Dies beinhaltet eben auch, dass es nicht das Ziel ist, alle Kommunikation über einen Punkt laufen zu lassen, sondern dass diese Struktur dazu beiträgt, den direkten Austausch zu unterstützen. Auf der anderen Seite kann das Büro die Aufgabe eines Verstärkers übernehmen, wenn es um dringende Aufrufe an möglichst viele Teile der Organisierung geht. Darüber hinaus kann es in seiner unterstützenden Rolle Presse- und Propaganda-Arbeit im Sinne der laufenden Kämpfe übernehmen, Mediation zwischen den Beteiligten vermitteln, Vollversammlungen und Kongresse sowie finanzielle Unterstützung für die Beteiligten organisieren. Für die Erarbeitung komplexer Themenbereiche und deren Bedeutung für die Kämpfe, wie z.B. einer Einschränkung des Streikrechts, könnte das Büro zudem innerhalb des Netzwerks nach Expert*innen suchen, die Einschätzungen dazu formulieren könnten und diese an die Beteiligten als Entscheidungshilfe weitergeben. Um Tendenzen der Verselbstständigung des Büros vorzubeugen und es auf seine Funktion als Informations- und Kommunikationsdienstleister zu reduzieren, sind die jeweils dort handelnden Menschen mandatgebunden, jederzeit abwählbar und möglichst nach dem Rotationsprinzip besetzt.
Alle drei Dimensionen (die praktische Soli-Arbeit, die politische Vernetzung und Reflexion sowie das Büro für organisatorische und inhaltliche Unterstützung) dienen der Schaffung von Verbindungen zwischen den verschiedenen Kämpfen, so dass sich die Basis auf der Straße und in den Betrieben verbreitert oder transnationaler Widerstand zu anstehenden Themen gleichzeitig wirkungsmächtig wird – eben das, worauf sich Polizeibehörden und andere Büttel so gern vorbereiten wollen (vgl. u.a. Schwerpunkt der Zeitung der Roten Hilfe 03.2014). Würde alles wie geschmiert laufen, so würden sich die Kämpfe immer mehr untereinander koordinieren; letztlich auch die Arbeit in Form einer politischen Gruppe, wie wir sie heute in unserer Defensivposition praktizieren, überflüssig werden. Mehr noch: Die unterschiedlichen Basisorganisationen, könnten als Keim einer sich herausbildenden Rätedemokratie und der umfassenden gesellschaftlichen Selbstverwaltung fungieren und so die Trennung von Politik und Ökonomie aufheben. Die von uns vorgeschlagene Art einer sozialrevolutionären Organisierung gibt es momentan nicht, sie muss aufgebaut werden.22Wie eine solche Organisierung konkret gestaltet und praktisch geschaffen werden kann, ist für uns die entscheidende Frage, welche beantwortet werden muss, und dies kann nicht von uns allein geleistet werden.
Konkreter können wir an dieser Stelle noch nicht werden, da uns einschlägige Erfahrungen fehlen. Hinsichtlich einer negativen Bestimmung unseres Strategie-Vorschlags können wir jedoch schon festhalten: Diese Skizze beinhaltet eben auch die Notwendigkeit, ein strategisches Verhältnis zu Links-Parteien und DGB-Gewerkschaften oder jeweiligen ideologischen Untiefen der Lohnabhängigen einzunehmen und innerhalb der Kämpfe Position zu beziehen und untragbare Positionen zu marginalisieren oder eben, wo notwendig, Brüche zu vollziehen. D.h. um eine wirklich kritisch-solidarische Auseinandersetzung mit ggf. zu ziehenden Konsequenzen werden wir nicht herumkommen. Klar ist jedoch, dass die bestehenden Apparate nicht unseren hauptsächlichen Bezugspunkt darstellen. D.h. unser Ziel ist es also nicht, sie möglichst weit nach links zu verschieben, wie es momentan von einigen Gruppen der radikalen Linken versucht wird, denn ein solches Vorhaben stößt schnell auf seine objektiven Grenzen. Stattdessen sollte es eher darum gehen, Selbstorganisationsprozesse entlang der eigenen Bedürfnisse und Interessen zu unterstützen.
Ziel unserer Strategie ist es, klassenbewusst eine emanzipatorische Gegenmacht zu Staat und Kapital aufzubauen, die insbesondere in Krisenzeiten eine praktische wie theoretische Alternative zu reaktionären Lösungsvorschlägen bieten kann. Also eine Politik, die den tatsächlichen Kampf mit den Herrschaftsverhältnissen wieder dort aufnimmt, wo sie sich direkt entfalten. An diesem Vorschlag ist vieles aufregend, aber wenig neu. Ansätze einer solchen Form der Organisierung finden sich etwa bei der Allgemeinen Arbeiter-Union – Einheitsorganisation (AAU-E) in der 20er Jahren oder beim Sozialistischen Büro (SB) in den 70ern, von dem vor allem sein sogenannter Arbeitsfeldansatz für die heutige Zeit wieder fruchtbar zu machen wäre.23In der Gegenwart gibt es Initiativen Gewerkschaftslinker und revolutionärer Basisgewerkschaften24, die betriebliche Kämpfe als Kampf gegen das Lohnsystem begreifen und deren Politikansätze in die zu beschreitende Richtung weisen. Unser Politik-Vorschlag beruht auf einer Reaktualisierung und Repolitisierung des Klassenbegriffs, der auch Kämpfe gegen weitere Herrschaftsverhältnisse mit einschließt und eine praktische Verbindung der Kämpfe leisten soll. Was von dieser Idee eingelöst werden kann, ist eine Frage der gemeinsamen Praxis und nicht allein der Theorie.
-------
Verwendete Literatur:
Adorno, Theodor W. (1995): Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt
Anderson, Perry (2012): Deutsche EU-Hegemonie und »blaue Blume der Demokratie«, in: Luxemburg 2/2012, S.12-19.
Antifa Kritik & Klassenkampf (2015): Krise – Klasse – Organisierung, in: Nowak, Peter (Hrg.): Ein Streik steht, wenn mensch ihn selber macht, Münster
Avanti Berlin, Stadt AG (2013): Jenseits des Mietspiegels. In: Analyse und Kritik 9/2013, http://www.akweb.de/ak_s/ak586/19.htm
Basisgruppe Antifaschismus Bremen (2012): Der Klassenkampf und die Kommunist*innen. Ein Strategievorschlag, http://basisgruppe-antifa.org/wp/der-klassenkampf-und-die-kommunistinnen...
Camus, Albert (1969): Das mittelmeerische Denken, in: Ders.: Der Mensch in der Revolte, Hamburg
Claussen, Detlev (1982): Die List der Gewalt. Soziale Revolutionen und ihre Theorien, Frabkfurt a.M.
Dalla Costa/Mariarosa (1972): women and suberversion of community, https://libcom.org/library/power-women-subversion-community-della-costa-...
Dath Dietmar (2014): Klassenkampf im Dunkeln. Zehn zeitgemäße sozialistische Übungen, Hamburg.
Deutschmann, Christoph (1973): Der linke Keynesianismus, Frankfurt a.M., http://www.mxks.de/files/other/Deutschmann.LinkerKeynes.html.
Freud, Sigmund (1973): Charakter und Analerotik, in: Ders., Studienausgabe Band VII, Frankfurt, S. 23 – 30
Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft (2009): Thesen zur Krise, in Kosmoprolet, Heft 2.
Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft (2013): Krisenlösung als Wunschkonzert, in: Analyse + Kritik 580.
Fromm, Erich/ Horkheimer, Max/ Marcuse, Herbert (Hrsg.) (1987): Studien über Autorität und Familie – Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Springe
Harvey, David (2009): Was tun? Und wer zum Teufel tut es? in: Luxemburg 1/2009, S. 100-109.
Horkheimer, Max (1988): Geschichte und Psychologie, in: Ders., Gesammelte Schriften Band 3, Frankfurt, S. 48 – 69
Kettner, Fabian (2006): Die Besessenen von Gesara, http://rote-ruhr-uni.com/texte/kettner_multitude.com
Krahl, Hans-Jürgen (2008): Zum Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein, in: Ders., Konstitution und Klassenkampf, 5. veränderte Aufl. 2008, S. 336-353
M31-Netzwerk (2013a): Europäische Generalstreiks sind auch unsere Sache!, http://strikem31.blogsport.eu/files/2013/04/M31-Aufruf_mai_2013-Copy.pdf
M31-Netzwerk (2013b): Erklärung des M31- Netzwerkes zur aktuellen Debatte über die Unterstützung eines europäischen Generalstreiks., http://strikem31.blogsport.eu/files/2013/08/nachtrag-zum-diskussionspapi...
Madörin, Mascha (2007): Neoliberalismus und die Reorganisation der Care-Ökonomie, in: Denknetz Jahrbuch 2007, Zürich
Marcuse, Herbert (1970): Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, München
Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band 1 (MEW 23), Band 2 (MEW 24) und 3 (MEW 25), Berlin.
Marx, Karl: Die deutsche Ideologie, in: MEW 1, Berlin
Marx, Karl: Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, in: MEW 2, Berlin
Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in MEW 42, Berlin
Mattick, Paul (2012): Business as usual. Krise und Scheitern des Kapitalismus, Hamburg.
Negt, Oskar (1972): „Nicht nach Köpfen, sondern nach Interessen organisieren! Aktuelle Fragen der Organisation“, in: SB (Hg.) (1973): Für eine neue sozialistische Linke. Analysen, Strategien, Modelle, Frankfurt a.M., S. 216 – 226
Negri, Antonio (2003): Rückkehr. Alphabet eines bewegten Lebens. Gespräche mit Anne Dufourmantelle. Aus dem Französischen von Thomas Atzert. Frankfurt am Main/New York
Ortlieb, Claus Peter (2013): Fin de partie. Eine allgemeine Geldentwertung ist nur eine Frage der Zeit, in: konkret, Heft 8/2013.
Reich, Wilhelm (= Parell Ernst) (1934): Was ist Klassenbewusstsein? Ein Beitrag zur Diskussion über die Neuformierung der Arbeiterbewegung, Kopenhagen/Paris/Zürich
Robinson, Joan (1969): Kleine Schriften zur Ökonomie, Frankfurt a.M.
Roth, Karl-Heinz/Papadimitriou, Zissis (2013): Die Katastrophe verhindern. Manifest für ein egalitäres Europa, Hamburg.
Sexpol (1934): Thesen über die Neuformierung der Arbeiterbewegung, in: H.-P. Gente (1970): Marxismus, Psychoanalyse, Sexpol, Frankfurt, S. 311 – 31
Sozialistisches Büro (1969): Warum machen wir ‚links‘?, in: SB (Hg.) (1973): Für eine neue sozialistische Linke. Analysen, Strategien, Modelle, Frankfurt a.M., S. 9-13
Sozialistischer Lehrerbund (1969): modelle, in: links. Sozialistische Zeitung, Offenbach, zitiert nach: Oy, Gottfried (2007): Spurensuche Neue Linke. Das Beispiel des Sozialistischen Büros und seiner Zeitschrift links, S. 26, http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Papers_Spurensuche.pdf
Wetzel, Wolf (2012), Blockupy – erfolgreich gescheitert?, https://wolfwetzel.wordpress.com/2012/05/24/blockupy-erfolgreich-geschei...
Winker, Gabriele (2011), Soziale Reproduktion in der Krise – Care Revolution als Perspektive, in: Das Argument 292, Hamburg
»Wir sind nicht die Bewegung«. Ein Gespräch mit drei AktivistInnen über Chancen und Gefahren ihrer Organisierungsvorhaben, in: Neues Deutschland vom 25.01.2014
„…ums Ganze!“ (2009): Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit. Zur Kritik des kapitalistischen Normalvollzugs
- Damit ist weder gemeint, dass wir lediglich die eine richtige Theorie bräuchten, noch, dass es allein an der radikalen Linke läge, ob sie eine gesellschaftliche Relevanz erheischen kann oder nicht. [zurück]
- Ein politisch-praktisches Positionspapier ist nicht der richtige Ort, um dies theoretisch auszuführen. Näheres hierzu findet sich etwa in den Thesen zur Krise von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft (2009). [zurück]
- Wenn er dies tut, fungiert er nicht mehr als ideeller Gesamtkapitalist, sondern als realer Kapitalist und ist den selben ökonomischen Zwängen ausgesetzt wie jeder andere Kapitalist auch. [zurück]
- „Strategie“ unterstellt hierbei nicht das, was in vielen Neoliberalismuskritiken gemeint ist, nämlich: dass es sich bei der Durchsetzung neoliberaler Krisenlösungsmodelle lediglich um einen intentionalen Akt mächtiger Akteur*innen (bevorzugt der Chicago Boys) handelt. Natürlich gab und gibt es einen gezielten neoliberalen Klassenkampf von oben mit entsprechend repressiv-gewaltsamen Mitteln. Als bloß repressiver hätte er sich aber nicht verstetigen können, er bedarf der ideologischen Einbindung und muss Bedürfnissen breiterer Bevölkerungsteile (bspw. dem nach mehr ‚Freiheit’ und ‚Mitbestimmung’ im Produktionsprozess) entgegenkommen. „Strategie“ meint deshalb im Foucaultschen Sinne eine von niemandem durchschaute, konfliktive Verflechtung verschiedener sozialer Kräfte, die auf verschiedenen Feldern auf verschiedene Weise versuchen, einen ‚historischen Notstand’ zu bearbeiten und dadurch eine Situation hervorbringen, die so niemand intendiert hat, aber dennoch funktional als Lösung dieses Notstands gelesen werden kann. [zurück]
- „Ist diese Betrachtung der Funktionsweise der Wirtschaft richtig – und dafür spricht die gesamte bisherige Geschichte des Kapitalismus –, dann kann es für die seit 2007 in so dramatischer Weise zutage getretenen Probleme keine wirkliche Lösung geben außer jener tiefen Depression, deren Vermeidung seit vierzig Jahren das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik ist.“ (Mattick 2012: 108). [zurück]
- Wobei es nicht nur um eine Delegitimation einzelner Repräsentant*innen (seien es Einzelpersonen oder Parteien) oder Repräsentationsmodi geht, sondern um eine Delegitimation des Staats als sozialer Form, um eine Destruktion des ‚Systemvertrauens’. [zurück]
- Die Grundidee des Keynesianismus ist es, die Wirtschaft über den Hebel der Nachfrage (Konsum und Investitionen – oder in Marxscher Terminologie: individuelle und produktive Konsumtion) zu steuern. Unter Linkskeynesianismus lassen sich jene Interpretationen der Theorie von John Maynard Keynes verstehen, „die in den von Keynes empfohlenen Maßnahmen der staatlichen Finanzpolitik oder einer ihnen entsprechenden Gewerkschaftspolitik einen Ansatzpunkt für die Realisierung eines Programms sozialer und demokratischer Reformen zugunsten der Arbeiterschaft sehen“ (Deutschmann 1973: 1). Er unterscheidet sich vom (Rechts-)Keynesianismus vor allem dadurch, dass a) die Frage gestellt wird, inwiefern die staatliche Wirtschaftssteuerung eine gesellschaftlich nützliche Produktion forciert, und b) die Dysfunktionalität einer ungleichen Einkommensverteilung hervorgehoben wird, da jene, die ein hohes Einkommen haben, es nicht voll verkonsumieren, und jene, die ein niedriges Einkommen haben, gerne konsumieren würden, ihnen dafür aber die Mittel fehlen. Als zentrale Akteur*innen für den Ausgleich der Einkommensverteilung gelten neben den Staaten die Gewerkschaften. Es bleibt jedoch weiterhin das Ziel, die Wirtschaft in Richtung kontinuierliches Wirtschaftswachstum zu lenken. [zurück]
- Eine Spaltung der Linken in Etatist*innen und Antiautoritäre, wie sie von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft gefordert wird (2013), ist in dieser Perspektive und wenn es darauf ankommt, die verheerenden sozialen Folgen der Krisenpolitik zu verhindern, wenig sinnvoll. Eine solche Praxis folgt u.E. auch nicht notwendig aus der Krisenanalyse und Staatskritik der FuFdkG, die wir weitestgehend teilen. [zurück]
- Der kapitalistische Widerspruch zwischen wertabstraktiver und stofflicher Reichtumsform lässt sich eben auch vom Keynesianismus nicht aufheben. Insofern gilt immer noch „Jeder Erfolg der Arbeiter vertieft die Krise.“ (Programm der I.W.W, Chicago 1933) [zurück]
- Diese sozialrevolutionäre Herangehensweise wird in aller Regel jedoch durch das linkskeynesianische Versprechen sozialverträglichen kapitalistischen Wirtschaftens verhindert. So heißt es etwa bei Joan Robinson, der zentralen Vordenkerin des linken Keynesianismus: „Augenscheinlich ist die Arbeiterbewegung nicht daran interessiert, auf der ganzen Linie einen Vorstoß in Richtung auf den Sozialismus zu machen. Warum sollte sie dann nicht die Rolle eines Juniorpartners im Kapitalismus akzeptieren und ihn mit allen Kräften unterstützen, damit er prosperiert und Dividenden zahlen kann?“ (1969: 48) [zurück]
- Nachdem Berthold Huber, bis November 2013 Vorsitzender der IG Metall, die spanischen Gewerkschaften wegen zu hoher Lohnabschlüsse kritisiert hatte, bezeichnete er die für den 14. November 2012 europaweit geplanten Streiks im Vorfeld als voluntaristischen Unfug. [zurück]
- Eine partielle praktische Zusammenarbeit mit Gewerkschaften ist damit allerdings keineswegs ausgeschlossen, schließlich stellen sie für viele Lohnarbeiter*innen noch immer einen zentralen Bezugspunkt für Kämpfe in den Betrieben dar. Das in ihnen – gerade auf der unteren Funktionärsebene – existierende Wissen über die Bedingungen und Möglichkeiten von Arbeitskämpfen und die Kontakte zu Belegschaften sind Ressourcen, die eine sozialrevolutionäre Organisierung nicht ungenutzt lassen sollte. [zurück]
- Mit Events sind hier Großdemonstrationen, symbolische Blockaden und Festivals mit dem Ziel, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, gemeint. [zurück]
- Zur Erläuterung: Parteilich ist das Totalitätsbewusstsein Krahl zufolge, wenn es zum „Bewusstsein der Massen“ vermittelt ist, „in ihre Erfahrung“ eingeht (ebd. 343) und zu kollektiver Interessenorganisation führt. Produktives Konsumtionsbewusstsein bezieht sich auf einen speziellen, von Krahl verwendeten Produktionsbegriff, der auch den „metaökonomischen“ Gehalt hat, „Prinzip der Geschichte“ (343) zu sein; Produktion ist „auf den Fortschritt und die Befreiung der Bedürfnisse“ (344) gerichtet und ermöglicht „autonome Lebenstätigkeit“ (344). Konsumtionsbewusstsein meint – vor dem Hintergrund, dass Konsumtion immer auch Produktion ist (vgl. MEW 42: 25ff.) – das Bewusstsein über diese emanzipative historische Dimension der (im sozialrevolutionären Klassenkampf durchzusetzenden) Bedürfnisbefriedigung. [zurück]
- Die Bezugnahme auf dieses Konzept bedeutet nicht, dass dieses den originellsten oder ausgefeiltesten Entwurf in dieser Richtung darstellt. Vielmehr kommt es hier zur Sprache, weil es einen wichtigen aktuellen Bezugspunkt in der linken Praxisdiskussion bildet, wie etwa durch die Aktionskonferenz „Care-Revolution“ deutlich wurde, die vom 14. bis 16.03.2014 in Berlin stattfand und erste Schritte hin zu einer Vernetzung der sozialen Kämpfe in diesen Bereichen unter einer gemeinsamen Klammer unternahm. [zurück]
- Mit erstem operiert – ohne sich dessen bewusst zu sein – der Teil der Bewegung, der sich stark an Hedonismuskonzepten orientiert („Drogen, Techno, Antifa“), mit dem zweiten eher der grün-alternative Teil der Linken. [zurück]
- So ist etwa die personale Liebe ohne die Subjektform der bürgerlichen Gesellschaft sowie die in ihr herrschende, spezifische Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit undenkbar. Das bürgerliche Subjekt ist zwar formell und rechtlich mit einem freien Willen ausgestattet, aber trotzdem überall ohnmächtig abhängig von den verdinglichten Imperativen der Kapitalakkumulation und in der Öffentlichkeit dieser Gesellschaft überall ihrer (stummen) Gewalt ausgesetzt. Die Liebe erscheint dann als ein Glücksversprechen und Refugium vor diesen Zumutungen. Liebe und Sinnlichkeit gründen daher auf Einsamkeit, Hass und Gewalt, bieten aber auch eine Wunscherfüllung. In ihr volles Recht könnte sie erst gesetzt werden, wenn das Verhältnis der Menschen zueinander und zur Welt ein solidarisch-befreites wäre und es keiner privatistischen Flucht mehr bedürfte. Im Folgenden geht es entsprechend nicht um eine subsumtionslogische Kategorisierung von wahren und falschen Bedürfnissen, sondern darum, den Doppelcharakter historisch gegebener Bedürfnisse hervorzuheben. [zurück]
- Problematisch wird die von Winker und anderen Care-Revolution-Aktivist*innen vorgeschlagene Strategie hingegen an einem anderen Punkt, nämlich wenn es um konkrete politische Handlungsschritte geht. Die von ihnen vorgeschlagene „Realpolitik“, die darauf abzielt, den Care-Bereich der Kapitalverwertung zu entziehen, ist unserer Meinung nach nicht real. Denn bis die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse soweit entwickelt wären, dass das Kapital bereit wäre, eine derartige Verringerung der Mehrwertrate zuzulassen, die die von Winker vorgeschlagenen Maßnahmen bedeuten würde, müssten sie bereits so stark in unserem Sinne entwickelt sein, dass es bereits um wesentlich mehr gehen könnte. Winker versteht es zwar, die Entwicklungen der Care-Ökonomie auf die Totalität der ökonomischen Prozesse rückzubeziehen, will dann aber gerade nicht auf diese Totalität einwirken. Insofern trägt diese „Realpolitik“ eher zur Staatsillusion denn zum Klassenbewusstsein bei. [zurück]
- Als Beispiel für Theorien, die sich auf der Suche nach einem neuen revolutionären Subjekt in ideologischen Verstrickungen festgefahren haben, steht die „Multitude“ von Michael Hardt und Antonio Negri, den zentralen Theoretikern des Postoperaismus und relevanter Bezugspunkt verschiedener linker Strömungen. Fixiert auf die Form von Organisation und den Netzwerkcharakter sozialer Bewegungen, findet bei ihnen eine weitreichende Abstraktion von deren Inhalten statt. Die Multitude ist nach Hardt/Negri, vereinfacht gesagt, immer gerade dort, wo sich überhaupt etwas bewegt. So fallen Antiatomkraft-Aktivist*innen, Anti-Globalisierungs-Bewegung sowie diverse religiöse Fundamentalist*innen und die Euro-Maidan-Bewegung unter den Begriff der Multitude. Während der dümmere Teil der Bewegungslinken auch die letztgenannten Gruppen wirklich für unterstützenswert hält, sind Hardt/Negri hier einen Schritt weiter. Ihnen fiel auf, dass die Multitude auch eine ‚dunkle Seite‘ hat, welche ihnen selbst nicht ganz geheuer ist. Formal passen diese Bewegungen ins Multitudekonzept, dabei haben wollen die Theoretiker*innen des Postoperaismus sie jedoch nicht. Nicht nur abstrahieren Hardt/Negri von jeglichen Inhalten sozialer Bewegungen, sie verkennen auch den Charakter ihrer materiellen Basis. So kommen sie zu der schlichtweg unsinnigen Annahme, die materielle Reproduktion der Gesellschaft sei heute auf Grund der Entgrenzung der Arbeitszeit und der Zunahme der Kultur- und Kopfarbeit nicht mehr entfremdet. Die Menschen seien heute gar „kommunistischer als früher“ (Negri 2003: 41). Es ginge also nur noch darum, die „parasitären Kräfte“, die der Multitude in der Zirkulationssphäre ihr Arbeitsprodukt streitig machten, zu beseitigen. Für eine nähere kritische Auseinandersetzung mit dem Multitudekonzept, siehe Kettner (2006). [zurück]
- In diesem Absatz sollte anhand eines bekannteren linksradikalen Akteurs, der das Klassenkonzept ablehnt, deutlich gemacht werden, inwiefern diese Ablehnung theoretisch unbegründet ist und welche praktischen Probleme man sich dadurch einkauft. Dabei stützten wir uns auf einen bereits sechs Jahren alten Text, dessen Inhalt allerdings durch das zitierte Interview aus den Jahr 2014 bestätigt wurde. Dennoch stellt natürlich auch das UG-Bündnis keinen monolithischen Block dar, deswegen sei hier auf die UG-Gruppe BA-Bremen verwiesen, die in einem Strategiepapier Überlegungen zum Klassenkampf vorlegt haben, die unseren nicht unähnlich sind (vgl. BA 2012). [zurück]
- Frei nach Wolf Wetzel (2012)} Und ergänzend hierzu: „Eine bestimmte Berufsrolle im kapitalistischen System übernehmen […] und gleichzeitig nicht auf politisch-verändernde Arbeit zu verzichten durch Rückzug auf private Freizeitpolitik erfordert die Ausfächerung ganz bestimmter, niemals ‚reiner‘ Aktions- und Arbeitsformen, die der objektiven Doppelexistenz unter den bestehenden gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen entsprechen“ (Sozialistischer Lehrerbund 1969) [zurück]
- Uns ist klar, dass solche Reisepläne in Richtung Utopia zunächst einigermaßen lächerlich wirken. Doch wer von Strategie redet, darf von ihrer Umsetzung nicht schweigen. Ihre Umsetzung aber hängt in der Praxis nicht vom starken Willen der Strateg*innen ab, sondern – wie eingangs bereits erwähnt – von Prozessen, deren Verlauf nicht in ihren Händen liegt. Daher die relative Hilflosigkeit der Schritt-für-Schritt-ins-Paradies-Pläne, die meist der Grund dafür ist, dass sie belächelt werden. Doch letztlich führt kein Weg in eine befreite Gesellschaft daran vorbei, gemeinsam praktische Ziele auszuloten und zu setzen und zu versuchen sie zu erreichen. [zurück]
- Bei dem Sozialistischen Büro handelt es sich um ein Produkt der Organisierungsbemühungen nach der Revolte von 1968 und nach dem Zusammenbruch des SDS, das sich zwischen dem organisationsfeindlichen spontaneistischen Flügel und den sich ahistorisch an leninistisch-autoritären Parteikonzepten orientierenden K-Gruppen positionierte. Dementsprechend orientierte sich das SB mit seinem sog. Arbeitsfeldansatz vor allem an bereits existierenden Basisgruppen von Menschen, die sich in ihrem alltäglichen Lebensumfeld zur Durchsetzung ihrer eigenen Bedürfnisse und Interessen organisierten. Das SB selbst verstand sich als „Organisator eines Produktionszusammenhangs“ (Negt 1972) und bündelnde Dach dieser Gruppen, das gemeinsame Taktiken und Strategien abstimmen sowie die Alltagspraxis theoretisieren kann. Es wollte dies etwa durch die Herausgabe vielfältiger Publikationen von der Zeitung links, über den Roten Pauker bis zur Broschürenreihe „Betrieb und Gewerkschaft“ sowie die Organisation von Kongressen gewährleisten. Im Mittelpunkt der politischen Arbeit des SB standen die Selbsttätigkeit der Lohnabhängigen und die reale Machtentfaltung in ihrem unmittelbaren Lebens- und Arbeitsfeld. Ein Ansatz, der eine produktive Verbindung von Politik und Alltagsleben ermöglichte. Gegen Ende der 1970er nach dem „Deutschen Herbst“ und der allmählich beginnenden rechten und neoliberalen Gegenoffensive verschwand der übergreifende, politische Charakter des SB aber zunehmend. In Folge dessen versickerte es allmählich im klein-klein der Betriebsarbeit und wurde zunehmend reformistischer. [zurück]
- Zum Beispiel die FAU (www.fau.org), Wobblies (www.wobblies.de), TIE (www.tie-germany.org), die jourfixe-Initiative in Hamburg (jourfixe.hamburger-netzwerk.de) oder der Klassenkämpferische Block Berlin (http://klassenkampfblock.blogsport.de/ [zurück]
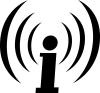

Hm
Als Diskussionsgrundlage finde ich den Text interessant und einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wundere ich mich immer wieder, was in der autonomen Linken plötzlich als neue Strategieideen entdeckt wird. Eure Punkte 1 - 3 am Ende z.B.: so ähnlich funktionieren die Strukturen von FAU & Wobblies - seit vielen Jahren. Viele Diskussionen der Linken wurden schon vor hundert Jahren ausgiebig diskutiert und die Beschäftigung mit den Ansätzen der historischen FAUD oder der KAPD & AAU wären auch für heutige Linke immer noch sehr lohnenswert. Und so mancher Text von Rudolf Rocker ist trotz seines Alters moderner und emanzipativer als heutige Antifakampfrethorik.
Texte zum Rätekommunismus: https://www.anarchismus.at/ueber-den-tellerrand-blicken/raetekommunismus
Anarchosyndikalistische Theorie: https://www.anarchismus.at/texte-anarchosyndikalismus/anarchosyndikalist...
Rudolf Rocker - Der Kampf ums tägliche Brot: https://www.anarchismus.at/texte-anarchosyndikalismus/anarchosyndikalist...
Viva Autonomia! Texte zu Vergangenheit & Gegenwart der Autonomen: https://www.anarchismus.at/die-autonomen