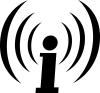In Berlin erkennen die Sportminister aus aller Welt erstmals die Probleme des Sports an – und beziehen Stellung gegen die großen Verbände. Von C. Spiller
Der Mann aus Simbabwe möchte eigentlich nur ein kleines Wort einfügen lassen, in die offizielle "Berliner Erklärung", auf die sich die Sportminister der Welt gerade einigen. "Herr Präsident", beginnt er etwas zerstreut im riesigen Saal eines Berliner Luxushotels, seine Bitte wird in sieben Sprachen übersetzt. Doch der Konferenzpräsident aus Mozambique weist ihn freundlich aber bestimmt darauf hin, dass er damit noch ein wenig warten müsse, so weit seien sie noch nicht. Der Mann aus Simbabwe entschuldigt sich und nickt verständnisvoll, nur um ein paar Minuten später zu erkennen, dass er diesmal seinen Einsatz verpasst hat. Die entsprechenden Absätze wurden gerade ratifiziert. "Es scheint, ich bin entweder zu früh oder zu spät", sagt er. Schmunzeln im Saal.
500 Sportminister und Funktionäre aus 137 Ländern trafen sich am Mittwoch und Donnerstag in Berlin zur Weltsportministerkonferenz. Es ist erst die fünfte überhaupt seit 1976, was bedeutet, dass die obersten Sporthüter der Welt nur etwa alle zehn Jahre zueinander finden. Das ist relativ selten, nicht verwunderlich also, dass es durchaus einiges zu besprechen gab im berühmten 1.500 Quadratmeter großen Ballsaal, wo die Teppiche tief sind und das Licht warm.
Probleme hat der Weltsport ja genug: Doping, Wettmanipulation, die Monopolistenstellung der großen Verbände, die den Ausrichterländern von Fußball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen frech die Bedingungen diktieren. Irgendwann, das haben auch die Sportminister erkannt, bekommen sie ein Problem. Wenn Sport nämlich unglaubwürdig wird, verliert er seine Legitimation. Und so ganz nebenbei kann man mit ihm dann auch viel schlechter Geld verdienen – oder Politik machen.
Für einige wachsweich, für andere knallhart
Während diese Probleme die Themen unserer, der ersten Welt sind, geht es anderenorts um ganz elementare Dinge: um die Möglichkeit, überhaupt Sport treiben zu können.
Und so handelt der erste große Komplex der nun verabschiedeten "Berliner Erklärung" vom "Zugang zum Sport als fundamentales Grundrecht für alle." Inklusion ist der Fachbegriff. Sport treiben soll jeder können, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, gesundheitlicher Beeinträchtigung, kulturellem und sozialem Hintergrund, wirtschaftlichen Mitteln oder der sexuellen Orientierung. Darauf wurde sich nun verständigt.
Nach kurzen Beratungen auf dem Podium kommt der Mann aus Simbabwe doch noch zu seinem Recht. Er darf das Wort "schulisch" einfügen. Und so wird künftig sichergestellt, dass Sportunterricht zum verpflichtender Teil der primären und sekundären "schulischen" Ausbildung wird. Keine weltbewegende Änderung, doch der Fall zeigt, wie schwierig und zäh ein politischer Prozess sein kann. Vor allem, wenn die ganze Welt mitreden will.
Man könnte die Formulierungen der "Berliner Erklärung" als wachsweich kritisieren. "Aber was für deutsche Ohren wachsweich klingt, ist für andere Länder knallhart", sagte Sylvia Schenk, Vorstandsmitglied von Transparency International, die eine der Berliner Konferenzen leitete. Die Antikorruptionsexpertin steht nicht im Verdacht, bei den Problemen des Sports ein Auge zuzudrücken. Sie sagte: "Es war ein guter Tag für den Sport."
Tatsächlich sind einige Teile der Erklärung bemerkenswert klar geraten. Zum Beispiel der, der sich um die großen Sportveranstaltungen, die Mega-Events, dreht. Großveranstalter wie Fifa und IOC werden aufgefordert, für Transparenz bei der Vergabe und Ausrichtung der Events zu sorgen.
Ging es beim Thema Nachhaltigkeit bislang nur um Ökologie, sollen künftig auch ökonomische und soziale Aspekte eine Rolle spielen. Zudem sollen finanzielle, technische und politische Anforderungen an solche Veranstaltungen abgesenkt werden, um auch kleineren Staaten die Möglichkeit zu geben, etwa Olympische Spiele durchführen zu können.
Bemerkenswert offen äußerte sich sogar der Innenminister: "Wir müssen den Verbänden, die an der ein oder anderen Stelle zur Großmannssucht leiden, Grenzen aufzeigen", sagt Hans-Peter Friedrich (CSU). Bemerkenswert auch deshalb, weil Friedrich immer wieder fordert, Deutschland müsse dringend mal wieder Olympische Spiele ausrichten. Ob sich die Chancen darauf nach solch deutlichen Worten erhöhen oder verringern, wird man sehen.
Rahmenwerk für nationale Gesetze
Die Integrität des Sports war das dritte große Thema. Es wurde eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Doping und Spielmanipulationen beschlossen. Zudem wird über strafrechtliche Sanktionen gegenüber den Tätern zumindest nachgedacht. Der Passus ist auch für Deutschland interessant, wo es noch immer keinen Straftatbestand Sportbetrug gibt. "Ob wir strafrechtliche Veränderungen brauchen, müssen wir prüfen. Ich halte nicht für ausgeschlossen, dass sportliche Sanktionen nicht ausreichen", sagte der Innenminister. Über die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich dann ausschließlich mit Sportdelikten befassen, werde diskutiert.
Die "Berliner Erklärung" mit ihren 16 DIN-A4-Seiten ist für einige Teilnehmer eine kleine Sensation. Erstmals überhaupt hat die Sportpolitik anerkannt, dass es bestimmte Probleme gibt, die den Sport als Ganzes gefährden. "Ich weiß, manche haben jetzt erwartet, da kommen jetzt schon die großen konkreten Punkte. Aber so läuft ein politischer Prozess nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass wir schon so viel Konkretes in die Erklärung kriegen", sagte Schenk.
In einem nächsten Schritt soll das Papier im kommenden Jahr als Unesco-Konvention ratifiziert werden. Rechtlich bindend ist sie nicht. Aber sie könnte als eine Art Rahmenwerk für nationale Gesetzgebungen dienen. "Es ist jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass das Papier nicht in der Schublade verschwindet", sagte Sylvia Schenk.