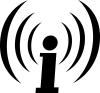Die Wirtschaftskrise ist real und nicht nur ein Mittel zur Durchsetzung deutscher Vorherrschaft in der EU. Linke reagieren ratlos auf die europäische Krisenpolitik. Dass der Aktionstag am 31. März in Frankfurt an der EZB-Baustelle stattfinden soll, können sie nicht begründen.
von Felix Baum
Dass es den Griechen und immer stärker auch anderen Südeuropäern an den Kragen geht, stößt in Deutschland auf Einverständnis, ja Genugtuung. Wenn die Bild-Zeitung gegen die »Pleite-Griechen« hetzt, dann im Wissen, damit den Geschmack des Publikums, also vor allem der Lohnabhängigen zu treffen. Komfortabel gestützt auf solches Massenbewusstsein, präsentiert sich der deutsche Staat zurzeit als Rammbock der Austerität in Europa, fordert immer neue Einschnitte in soziale Systeme, drängt auf »Schuldenbremsen« in den Verfassungen, versteigt sich, berauscht von seiner neuen Macht, sogar zu dem tolpatschigen Vorschlag, einen Sparkommissar als deutsch-europäischen Statthalter in Athen einzusetzen, also jeden Anschein demokratischen Procederes aufzugeben und das faktische Diktat über Griechenland in aller Offenheit zu errichten. Nach innen ganz Nationalmutti, die auch mal schimpfen muss, aber eigentlich ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte »der Menschen« hat, gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach außen die thatchereske Domina des Kapitals, die den verlotterten Griechen Disziplin einpaukt.
Kein Wunder also, dass sie dieser Tage in Griechenland auf Plakaten von Demonstranten oder in Zeitungskarikaturen immer öfter mit Hitlerbart zu sehen ist, und dass sich der Zorn der mit Sparprogrammen Traktierten weithin gegen Deutschland richtet. Aber auch darüber hinaus, bis in die Staatenwelt und internationale Wirtschaftspresse hinein, sorgt die deutsche Politik für Entsetzen, weil sie die Krise bislang verschärft hat und der Verdacht, die deutsche Medizin könne den griechischen Patienten am Ende umbringen, nicht von der Hand zu weisen ist. Im sturen Beharren auf Sparen, Kürzen und Sparen und Kürzen scheint sich erneut der deutsche Hang zum Irrationalismus Bahn zu brechen, weshalb wieder ein german problem in den internationalen Debatten beschworen wird. Flugs werden auch bei Linken in Deutschland alte Reflexe wach. Erst neulich war in dieser Zeitung von Anton Landgraf zu lesen, es sei nun »höchste Zeit, den Betriebsfrieden aufzukündigen und sich mit den europäischen Protesten gegen den wahnhaften deutschen Sparzwang und seine Herrschaftsallüren zu solidarisieren. Schließlich war es noch nie so einfach, antideutsche Positionen zu vertreten. Verbündete finden sich in Europa dafür zur Genüge.« (Jungle World 5/2012)
Ein für antideutsche Linke eher unüblicher Solidaritätsappell, doch bei den erhofften Verbündeten handelt es sich größtenteils um rechte, nationalistische, populistische Kräfte oder um Linke, die ebenfalls so sehr auf nationalen Pfaden wandeln, dass sie von ersteren kaum zu unterscheiden sind. Nicht griechische Linksradikale kleben Merkel den Hitlerbart an. Sie haben im Gegenteil alle Hände voll damit zu tun, der nationalistischen Deutung des Sparterrors als Angriff aus dem Ausland entgegenzutreten. Denn allemal wichtiger als die Frage, wer da gerade Sparprogramme durchdrückt, ist die Frage, warum dies geschieht und welche Alternativen es dazu gibt, solange die kapitalistische Produktionsweise nicht aufgehoben wird. Insofern kratzt die Rede von einem »wahnhaften deutschen Sparzwang« nicht einmal an der Oberfläche, sondern führt geradewegs in die Irre des Keynesianismus.
Was der deutsche Staat derzeit in Europa durchpeitscht, ist nichts anderes als das klassische Maßnahmenpaket des Internationalen Währungsfonds (IWF), der auch diesmal an vorderster Front dabei ist, um den griechischen Lohnabhängigen das Fell über die Ohren zu ziehen. Sparen in der Krise ist hart und hat nicht nur einmal, etwa im Falle Argentiniens 2001/2002, in den Staatsbankrott geführt. Als »wahnhaft« kann diesen Kurs aber nur bezeichnen, wer sich im Besitz der vernünftigeren wirtschaftspolitischen Konzepte wähnt, wie also etwa Attac, die Linkspartei und andere Keynesianer. Sie meinen, Staatsverschuldung könne kein Problem sein und etwas Besseres als mehr Sozialausgaben und höhere Löhne sei dem Kapital gar nicht zu raten, würde so doch die Massenkaufkraft gestärkt und im Nu die Krise überwunden.
Kein Wort verlieren sie über die nachlassende Dynamik des Kapitals, die seit Jahrzehnten nur durch eine immer gewaltigere Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten kaschiert wurde, seit Beginn der achtziger Jahre aber in einer Serie von Schuldenkrisen und seit 2009 im großen Schlamassel der Weltwirtschaftskrise zutage getreten ist. Und keinen Schimmer haben sie von einer Produktionsweise, die sich von Kindesbeinen an nie anders bewegt hat als durch den ewigen Zyklus von Boom und Crash. Die am Anfang des griechischen Dramas stehende, durchaus begründete Skepsis von Investoren, ob die kümmerliche Wirtschaftskraft Griechenlands dauerhaft einen riesigen Schuldenberg tragen kann, muss folgerichtig in ein perfides Manöver von Spekulanten und Ratingagenturen umgedeutet werden, denn nur so passt die Tatsache ins Bild, dass der nun drohende Staatsbankrott Griechenlands ohne das Eingreifen der Troika schon 2010 eingetreten wäre, als Ergebnis eben des deficit spending, von dem die Keynesianer nie genug kriegen können.
Seit Ausbruch der Krise stehen die Regierungen vor der Wahl »zwischen der Pest einer anhaltenden Depression, die eine Gefahr sozialer Unruhen mit sich bringt, und der Cholera von Konjunkturausgaben, die nur begrenzt wirksam sind und die Defizite in gefährliche Höhen treiben«, wie Paul Mattick in seinem Buch zur Krise »Business as Usual« kürzlich formuliert hat. Und so haben die Keynesianer gegen die Neoliberalen Recht, wenn sie die von den Sparprogrammen verschärfte Abwärtsspirale beklagen, und die Neoliberalen haben gegen die Keynesianer Recht, wenn sie angesichts maroder Staatsfinanzen weiteres Schuldenmachen für keine gute Idee halten. Die Chaotisierung der Politik, das große Hauen und Stechen unter den europäischen Staatsführern, zeugt von der Unlösbarkeit des Widerspruchs. In der Praxis herrscht blindes Durchwursteln; während die Deutschen als bad cop auf knallharte Austerität drängen, kauft die Europäische Zentralbank (EZB) als good cop die Ramschanleihen südeuropäischer Staaten, die sonst niemand mehr haben will.
Dass es »ums Ganze« geht, ist nach Lage der Dinge insofern eine nüchterne Feststellung, gegen dieses Ganze auf die Straße zu gehen, allerdings meist hilfloser Aktionismus. Der »europäische Aktionstag gegen den Kapitalismus« am 31. März, zu dem linksradikale Gruppen zurzeit mit einem einwandfrei staatsfeindlichen Aufruf mobilisieren, könnte eine freundliche Geste an die protestierenden Griechen werden, schließlich stehen dann auch mal andere im Tränengas.
Aber schon in der Wahl der EZB als Kundgebungsort in Frankfurt kommt die verdrängte Ratlosigkeit zum Vorschein, denn warum gerade dort, weiß niemand so recht. Sie sei »eines der zentralen politischen Instrumente, mit denen die starken Länder der Eurozone, vor allem Deutschland und Frankreich, versuchen, die kapitalistische Krise auf dem Rücken der Lohnabhängigen hier und vor allem in Südeuropa zu lösen«, sagen die Organisatoren und fordern eine »Stilllegung der EZB-Baustelle«, so als könne man gegen das Kapitalverhältnis wie gegen die Startbahn West demonstrieren und als sei Krisenbewältigung anders als gegen die Lohnabhängigen überhaupt denkbar (von der Ironie, dass es zwischen der EZB und Deutschland gerade knirscht, ganz abgesehen).
Insofern sind solche Demonstrationen, wie sympathisch begründet sie auch sein mögen, vor allem Ersatzhandlungen. Die Krux in Deutschland liegt darin, dass der Sozialchauvinismus der Lohnabhängigen nicht so sehr auf »falschem Bewusstsein« beruht als vielmehr auf der richtigen Feststellung, im Bund mit Unternehmern und Staat bislang einigermaßen ungeschoren durch die Krise gekommen zu sein. Anders als der griechische Staat, der außer Verarmung und Polizeiknüppeln nichts mehr anzubieten hat, hat sich der deutsche auch als Schutzmacht der einheimischen Arbeiterklasse profiliert, indem er etwa etliche Milliarden für die Kurzarbeit ausgegeben hat. Während die prekären Ränder der Klasse gewachsen sind, konnte sich ihr gewerkschaftlich organisierter Kern einigermaßen behaupten. Es stimmt, dass die Lohnzurückhaltung des DGB in den vergangenen zehn Jahren Deutschlands Konkurrenzfähigkeit gestärkt und somit zu den Exportüberschüssen beigetragen hat, die sich im Süden Europas als Defizite niederschlagen.
Es stimmt aber auch, dass diese Einbußen von einem hohen Niveau aus erfolgt sind. Kein BASF-, Siemens- oder VW-Arbeiter schuftet für Löhne, wie sie in Griechenland üblich sind, und der völlig mittellosen Proletarierin in Lissabon muss das deutsche Arbeitslosengeld II als beinahe paradiesisch erscheinen. Die eigene Lage bewerten aber alle an der der anderen. Das Glück, kein Grieche zu sein, versüßt das Pech, Arbeiter zu sein. Darin besteht der allem Anschein nach unverrückbare Grund für die praktische Ratlosigkeit der Radikalen hierzulande. Sie einzugestehen, wäre ein erster Schritt. Und vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, wie man einen ganz anderen Vergleichsmaßstab einführen könnte, nämlich die gesellschaftlichen Möglichkeiten, um die auch der vergleichsweise passabel bezahlte Lohnsklave betrogen bleibt.