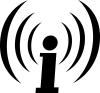Drogen, Rocker und Kriminalität - die zwei Kilometer lange Eisenbahnstraße im boomenden Leipzig hat ein finsteres Image. Doch die Magistrale hat auch viele positive Seiten. Ein Besuch auf Deutschlands angeblich schlimmster Straße.
Leipzig - . Nagelstudios, Wettbüros, orientalische Restaurants und eine gutbürgerliche Imbissstube reihen sich in der Eisenbahnstraße aneinander. Die frühere Einkaufsmeile im Leipziger Osten wird in Medien als „gefährlichste Straße Deutschlands“ bezeichnet. Ein großes mediales Echo über Drogenhandel, Fehden zwischen verfeindeten Familienclans und Bandenkriminalität haben ihr Image ruiniert und das gesamte Viertel in Verruf gebracht. Diesen Sommer sorgte eine tödliche Schießerei im Rocker-Milieu für neue Schlagzeilen über das Leipziger Sorgenkind. Gleichzeitig zieht die Gegend um die Eisenbahnstraße aber auch junge Leute, Studenten und Künstler an, die sich mehr um steigende Mieten als um Kriminalitätsstatistiken sorgen.
Im Haus mit der Nummer 113 ist wenig von einer finsteren Eisenbahnstraße zu spüren. Im großen Schaufenster des alten Gebäudes wirbt ein buntes Plakat eine „Küche für alle“ an, während drinnen eine Gruppe Kinder aus der Nachbarschaft unter Missachtung jeglicher Klangregeln munter auf eine große Trommel einprügelt. Von dem Lärm völlig unberührt fegt ein junger Mann in modischer Dreiviertel-Jeans beflissen Kartoffelschalen vom Boden. Weiter hinten in der Küche kämpfen viele freiwillige Köche um wenig Platz vor den Töpfen, in denen Reisnudeln und Gemüse für ein veganes Abendessen brutzeln.
„Wir wollen ein Wohnzimmer für den Stadtteil sein“, sagt Yu Ohtani. Mit seiner ordentlichen Pagenkopf-Frisur und dem hochgeknöpften Karo-Hemd unter der feinen Strickjacke wirkt der 32-Jährige in dem von ihm selbst ins Leben gerufenen Chaos beinah etwas fehl am Platz. Sein Verein „Japanisches Haus“ organisiert neben der Mitmach-Küche, bei der es Essen gegen eine Spende gibt, außerdem Konzerte, Ausstellungen und Aktionen für Geflüchtete.
Dass immer mehr junge Menschen und Studenten in das Viertel ziehen und sich beteiligen, freut Othani sehr. Der Doktorand, der zurzeit in Stadtplanung promoviert, wohnt selbst seit etwa vier Jahren in dem Gebäude. Anfangs hatte er von Drogenkriminalität und Bandenkriegen gar nichts gewusst. Außer ein paar Fahrraddiebstählen habe er aber auch nie Probleme mit dem alltäglichen Leben auf der in Verruf geratenen Straße gehabt. „Es ist schon okay hier und vor allem spannender als in anderen Vierteln. Die vielen verschiedenen Menschen machen den Reiz aus. Für mich ist das gelebte Urbanität.“
Laut Polizeisprecherin Maria Braunsdorf sehen das nicht alle so locker wie Othani. Das Sicherheitsgefühl vieler Anwohner sei zum einen durch sich tatsächlich häufende religiöse und ethnische Konflikte, aber auch durch die Berichterstattung der Medien extrem geschwächt worden. Ein immer lauter werdender Ruf nach mehr Polizeipräsenz habe dann dazu geführt, dass im Sommer 2014 ein zusätzlicher Polizeistandort „Eisenbahnstraße“ eingerichtet wurde.
Der Kriminalitätsatlas der Stadt Leipzig zeigt anhand einer orangenen Färbung, dass in dem Gebiet um die Eisenbahnstraße im Jahr 2015 tatsächlich mehr Straftaten verübt wurden als in anderen Stadtteilen. Mit im Schnitt etwa 16 000 Delikten pro 100 000 Einwohnern liegt die Quote aber noch unter der des dunkelrot markierten Stadtzentrums. Natürlich sorgen Delikte wie Taschen- und Ladendiebstähle, die die Innenstadt statistisch an die Spitze treiben, nicht für die Schlagzeilen, die der Eisenbahnstraße weit über Leipzigs Stadtgrenzen hinaus zu zweifelhaftem Ruhm verhalf.
Dass Drogenhandel, -konsum und damit verbundene Beschaffungskriminalität zum Alltag im Viertel gehören, weiß Streetworker Tom Ney nur zu gut. Er und seine Kollegin kennen die Verstecke der Dealer und der Abhängigen im Stadtteilpark Rabet. Regelmäßig drehen sie dort ihre Runden, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und gebrauchte Spritzen einzusammeln. In eine wirklich brenzlige Situation sei er bei der Arbeit auf der Eisenbahnstraße noch nie geraten. „Hier ist es auch nicht schlimmer als an anderen sogenannten sozialen Brennpunkten in Deutschland“, sagt Ney.
In ihrem Kontaktladen in der Eisenbahnstraße 11, dem seit Langem der Ruf „Druffy-Bude“ anhaftet, bieten die Streetworker mehrmals wöchentlich einen offenen Treff an. „Viele Klienten, die in den 90ern mit Heroin angefangen haben, sind eben mitgewachsen“, erklärt Ney. Vor einiger Zeit wurde entschieden, das vom Jugendamt geförderte Angebot für Leute bis maximal 26 Jahre auszurichten. „Wir kontrollieren hier keine Personalausweise und auch deutlich ältere Klienten können sich einen Kaffee und saubere Spritzen abholen, aber wir verweisen sie dann an andere Stellen“, sagt Ney.
Während sich früher schon mal bis zu 20 Personen in den zwei kleinen Räumen der Streetworker aufgehalten hätten, geht es heute verhältnismäßig ruhig zu. Der Kicker-Tisch findet wenig Beachtung, in der Küche bedient sich ein langhaariger Rollstuhlfahrer am Müsli-Buffet und dazu schallen die 257ers mit „Mein Holz“ aus den Musikboxen.
Vor einem alten Desktop-PC kauert Sebastian und löffelt eine heiße Tüten-Suppe. Mehr als zwei seiner gerade mal 23 Lebensjahre verbrachte er auf der Straße, drei weitere im Gefängnis. Mittlerweile hat er einen festen Wohnsitz und hin und wieder einen Gelegenheits-Job. Zum Treff kommt er wegen des Internets und weil er den Streetworkern viel zu verdanken habe. Heroin habe er in seinem Leben noch nie angerührt. Von Marihuana, Crystal und Kokain sei er allerdings noch nicht ganz weg. „Hier in der Eisenbahnstraße kenne ich viele Dealer, aber wenn man was braucht, kann man in Leipzig überall was kriegen“, sagt Sebastian, zupft dabei etwas verlegen am Ärmel seines Kapuzenpullis und entblößt einen seiner extrem weißen, dünnen Unterarme.
Die Entwicklung der zu DDR-Zeiten belebten Einkaufsstraße zum Drogenumschlagspunkt nahm bereits in den 90er Jahren ihren Lauf. Die Nähe zur Innenstadt, viele leerstehende Häuser und ein insgesamt niedriges soziales Niveau hätten dies begünstigt, erklärt Ralf Elsässer vom Quartiersmanagement Leipziger Osten. Im Auftrag der Stadt Leipzig arbeitet er unter anderem an der Verbesserung des Images des Eisenbahnstraßen-Viertels.
Elsässer erinnert sich noch gut daran, wie vor über zehn Jahren vergeblich darum gekämpft wurde, zur Aufwertung eine Einrichtung von gesamtstädtischer Bedeutung in den Leipziger Osten zu holen. Ein Kino, ein Theater oder ein Krankenhaus gibt es zwar bis heute nicht, stattdessen mache der Zuzug von etwa 1000 Menschen pro Jahr die Gegend immer lebenswerter. Elsässer schätzt, dass Studenten, Migranten und alteingesessene Bewohner mittlerweile zu je einem Drittel vertreten sind.
Dass die Probleme, mit denen er täglich konfrontiert wird, durch den Zuzug neuer Menschen und eine Aufwertung des Viertels gelöst werden, glaubt Streetworker Ney nicht. In den letzten Jahren hat er eher eine Verdrängung beobachtet. Weniger leerstehende Gebäude bedeuteten eben auch weniger Rückzugsräume und eine Verlagerung des Konsums in den öffentlichen Raum. „Ich habe absolut nichts dagegen, wenn Studenten aus der alternativen Szene Wohnhäuser herrichten. Problematisch wird es erst, wenn Investoren das tun“, sagt Ney.
„Eigentlich ist der schlechte Ruf für uns ganz gut und dass es hier nicht so sauber ist wie in anderen Stadtteilen“, findet Ohtani. Dass die wachsende Beliebtheit des Viertels bereits Einfluss auf den Wohnungsmarkt genommen hat, bekam auch er bereits zu spüren. Als sein Verein 2012 die Räumlichkeiten des „Japanischen Hauses“ bezog, zahlte er nur 60 Cent pro Quadratmeter. Dieses Jahr erhöhte der Vermieter den Quadratmeterpreis auf 3,50 Euro und rückt damit etwas näher an den Leipziger Durchschnitt von 5,08 Euro heran.
Angesichts solcher Entwicklungen von Gentrifizierung zu sprechen, hält Ralf Elsässer für überspitzt. „In erster Linie freut es mich, dass das Image nicht mehr wie ein schwerer Sack am Stadtteil hängt.“
Von Anika Reker