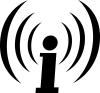Jan Robert von Renesse wollte Holocaust-Überlebenden Renten zuerkennen – und ist genau deswegen selbst zu einem Angeklagten geworden.
Am Morgen des 10. März 2016 betritt der Richter Jan Robert von Renesse den Gerichtssaal 1.120 im Landgericht Düsseldorf. Es ist der vielleicht schwerste Gang seines Lebens. Denn von Renesse kommt nicht, wie sonst, durch das Richterzimmer. Er nimmt den Saaleingang und setzt sich auf die Anklagebank.
Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat ein Disziplinarverfahren gegen Renesse angestrengt – wegen vermeintlicher "Rufschädigung der Sozialgerichtsbarkeit". Doch in Wahrheit geht es hier um weit mehr. Es geht um die Frage, wie unabhängig ein Richter in Deutschland wirklich sein darf. Jan Robert von Renesse, ein Richter vor Gericht. Wie konnte es dazu kommen?
Die Geschichte beginnt vor zehn Jahren. Im Juli 2006 öffnet Renesse seine erste sogenannte Ghettorenten-Akte. Vier Jahre zuvor hatte der Bundestag einstimmig das Gesetz zur "Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto" verabschiedet. Holocaust-Überlebende, die während des Zweiten Weltkriegs in Ghettos gearbeitet hatten, konnten nun einen Antrag auf eine Arbeitsrente stellen. Etwa 88.000 Anträge gingen daraufhin bei der Rentenkasse ein, die meisten aus Israel und Amerika. 93 Prozent davon wurden abgelehnt, da sie den Voraussetzungen nicht genügten.
In der Folge klagten viele Überlebende gegen diese Entscheidung – und einige Fälle landeten auf dem Tisch von Jan Robert von Renesse, damals 39 Jahre alt, Richter am Landessozialgericht NRW in Essen. Ein Mann mit hervorragenden Beurteilungen und der Aussicht auf eine große Justizkarriere.
Sein erster Ghettorenten-Fall geht Renesse ans Herz. "Ich kenne diese Akte noch heute auswendig", sagt er. Er findet darin handgeschriebene Briefe auf Russisch. Renesses Großmutter stammte aus St. Petersburg, sie brachte ihm einst ihre Sprache bei. "Die Klägerin war eine spät nach Israel ausgesiedelte Witwe mit einer ganz kleinen Rente. Sie schrieb von sich und ihrem Mann, die im Ghetto gehungert hatten, und bat nur darum, dass Deutschland jetzt etwas für sie tun möge."
Doch Deutschland tat erst einmal gar nichts, außer den Betroffenen komplizierte, ausschließlich auf Deutsch verfasste Fragebögen zuzusenden. Die Holocaust-Überlebenden sollten ihre genaue Tätigkeit und die Arbeitsstelle benennen, Arbeitszeiten angeben, die Namen von Vorgesetzten. Nach mehr als 60 Jahren.
Renesses Frau ist Polin, ihr Großvater wurde im KZ Stutthof ermordet, ihr Vater als Zwangsarbeiter nach Magdeburg verschleppt. Als er vor 15 Jahren eine Zwangsarbeiterentschädigung aus Deutschland bekam, war der alte Mann sehr bewegt. Endlich war er als Opfer offiziell anerkannt worden. Renesse weiß um die große Bedeutung dieser Fälle. "Was, wenn mein Schwiegervater so ein Schreiben bekommen hätte, in dem quasi steht: ›Wir glauben dir erst mal gar nichts‹?" Renesse sagt auch, dass man natürlich nicht alles unbesehen glauben dürfe, "aber man muss doch mit den Menschen reden und sich nicht auf irgendein Formular verlassen".
Kurt Einhorn aus Düsseldorf hätte die Formulare am liebsten zerrissen. "Als hätte ich damals Tagebuch geführt! Ich wusste nicht einmal, ob ich am nächsten Tag noch leben würde!" Im Herbst 1941 wurde der Neunjährige mit seinen Eltern in das Ghetto Mogilew in Transnistrien verschleppt. Bald starben die Eltern an Typhus. Kurt überlebte, und um nicht zu verhungern, fuhr der Junge mit einer Schubkarre Leichen zum Friedhof. Der Lohn war ein bisschen Essen. Für diese Arbeit hätte er theoretisch Anspruch auf eine Ghettorente. Doch auch ihm blieb sie zunächst versagt. Denn das Gesetz von 2002 besagt, dass man beweisen muss, freiwillig im Ghetto gearbeitet und dafür ein Entgelt bekommen zu haben. Einige zogen vor Gericht, doch in Nordrhein-Westfalen hatten sie kaum eine Chance. Die Richter gaben gewöhnlich den Rentenversicherungen recht. Auch sie kommunizierten mit den Betroffenen lediglich mittels Formularen. Jan Robert von Renesse hielt es anders.
Der idealistischer Querulant
Gleich beim ersten Fall macht er etwas, was an seinem Gericht völlig unüblich ist: Er will die Russin persönlich anhören. Achtmal reist er insgesamt nach Israel, lässt sich von 120 Holocaust-Überlebenden den Ghettoalltag schildern. Er beauftragt Historiker, Gutachten zu erstellen. Am Ende sieht Renesse in etwa 60 Prozent der Fälle das Anrecht auf eine Ghettorente begründet. Und schert damit eklatant aus der Spruchpraxis seiner Kollegen aus, die fast 90 Prozent der Klagen abweisen.
Renesse geht den anderen Richtern auf die Nerven. So viel Einsatz sei unnötig, zu teuer, man könne doch alles in den alten Entschädigungsakten nachlesen. Immer mehr wird er zum Außenseiter, fühlt sich in seiner Arbeit behindert. "Die Kollegen waren gegen meine Art, die Verfahren zu führen", sagt er. Sie mischten sich ein, verhinderten Beweiserhebungen, sagten hinter seinem Rücken Gerichtstermine in Israel ab, hoben Kostenbeschlüsse zulasten der Rentenversicherung auf. So schildert er es.
Im Juni 2009 aber erzielt Renesse einen großen Erfolg, indem sein ungewöhnlicher Weg durch die Änderung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in Kassel bestätigt wird. Als freiwillige Arbeit im Ghetto wird von nun an jede Beschäftigung eingestuft, bei der der Antragsteller zwischen Arbeit und Hungertod entscheiden musste. Zum "Entgelt" gehörten auch Brot oder Suppe. Alle abgelehnten Anträge, Tausende, sollen neu überprüft werden. Für Renesses Kollegen am Landessozialgericht ist das wie ein Kinnhaken. Plötzlich nervt der idealistische Querulant nicht einfach nur, jetzt beschert er seinen Kollegen auch noch jede Menge Überstunden.
Dann bittet die beklagte Rentenversicherung Rheinland die Richter um ein Treffen. Auf Wunsch der Behörde sollen sie ein halbes Jahr keine Ghettorenten-Verfahren mehr verhandeln. "Um unnötigen Aufwand zu vermeiden und im Sinne der Erledigung", heißt es in den Gesprächsprotokollen, die der ZEIT vorliegen. Die Richter folgen dem Wunsch und stoppen die Bearbeitung von fast 1.500 Ghettorenten.
Für die Geschäftsführerin der Rentenversicherung Rheinland, Annegret Kruse, ist das ein legitimer Vorgang. "Es gibt ja kein Redeverbot, wenn Verfahren in diesem Lande betrieben werden." Man habe ausloten wollen, wie viele Fälle es gebe und wie man diese schnell erledigen könne – "zugunsten der Berechtigten". So kann man das sehen.
Man kann es aber auch sehen wie Jan Robert von Renesse, der die Absprache für einen massiven Verstoß gegen die Gewaltenteilung und eine fatale Verzögerung hält. "Jede Woche hatten wir Tote unter den Klägern", sagt er. Als Einziger bearbeitet er seine etwa 100 Fälle weiter. Dafür kassiert er einen Vermerk in seiner Personalakte: "Verursacht Reibungsverluste", was so viel heißt wie: "Er gehorcht nicht". 2010 wird er von allen Ghettorenten-Fällen abgezogen und in einen anderen Senat versetzt. Renesse wendet sich an die Presse – und bekommt von der damaligen Präsidentin des Landessozialgerichts einen Maulkorb. 2010 klagt er vor dem Richterdienstgericht wegen der Verletzung seiner richterlichen Unabhängigkeit, doch die Klage wird abgewiesen. Die Kammer fühlt sich nicht zuständig. Immer wieder bittet Renesse das Justizministerium, tätig zu werden, er beklagt sich auch über Mobbing – ohne Erfolg. So sei er in das kleinste Zimmer versetzt worden, sogar seine Heizung sei trotz Beschwerden nicht repariert worden.
2012, nach drei Jahren Krach, wendet er sich mit einer Petition an den Bundestag. Er fordert eine längere rückwirkende Zahlung der Ghettorenten, prangert die Zustände in der nordrhein-westfälischen Justiz an und beschwert sich, den Holocaust-Überlebenden werde kein faires Verfahren zuteil, da die Kläger nicht angehört würden. Die Petition hat Erfolg. Sie bewirkt, dass der Bundestag 2014 das Gesetz zugunsten der ehemaligen Ghettoarbeiter ändert. Die Überlebenden bekommen Nachzahlungen in fünfstelliger Höhe. Doch nicht alle Kläger erleben das. Auch Kurt Einhorn, der als Junge Leichen zum Ghettofriedhof transportierte, stirbt kurz zuvor. Nur gut die Hälfte aller Antragsteller erhält ihre Rente.
Die erfolgreiche Petition besiegelt die Karriere des Richters. Der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty leitet gegen ihn ein Disziplinarverfahren ein – unter anderem "wegen Verletzung der Wahrheitspflicht in dienstlichen Angelegenheiten (...) und der Verpflichtung zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten im Dienst". Oder, wie es ein Sprecher des Ministeriums formuliert: "Das Fehlverhalten sehen wir darin, dass er in einem Brief an den Bundestagspräsidenten geäußert hat, dass in der nordrhein-westfälischen Justiz Absprachen getroffen werden, um bewusst Holocaust-Überlebenden zu schaden. Das ist so nicht richtig, und das kann die Justiz so nicht stehen lassen."
"Ein Armutszeugnis für die Justiz"
Doch wie kann es sein, dass das Ministerium das Ansehen der Justiz durch Renesses Petition beschädigt sieht, sich jedoch keineswegs daran stört, dass durch Absprachen zwischen Vertretern von Judikative und Exekutive etwa 1.500 Fälle für ein halbes Jahr nicht bearbeitet werden? Für den Sprecher ist die Sache klar: "Das Treffen ist durch ein Richterdienstgericht bewertet worden, und das ist zu der Auffassung gekommen, dass kein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit vorliegt."
Für Peter Pfennig, den Sprecher der Fachgruppe Gewaltenteilung in der "Neuen Richtervereinigung", sind Absprachen, die sich auf den Inhalt des Verfahrens auswirken, völlig unzulässig. "Zum Inhalt einer Sachentscheidung gehört auch, wann sie getroffen wird. Hier war es so, dass gewisse Terminierungen abgesetzt werden sollten. Damit wurde direkt in die Entscheidungskompetenz des jeweiligen Richters eingegriffen!" Pfennig beobachtet mit Sorge, wie mit Renesse umgesprungen wird. Eine Disziplinarklage wegen einer Petition – "das sind ganz neue Methoden. Es ist doch sein Bürgerrecht. Die Justiz kann niemandem vorschreiben, in welcher Form er sich zu beschweren hat. Dass von Renesse die Beschädigung des Ansehens der Justiz vorgeworfen wird, ist ein Armutszeugnis für die Justiz."
Auch Wolfgang Meyer, ehemaliger Senatsvorsitzender am Bundessozialgericht in Kassel, hält die Härte, mit der das Land NRW gegen den Richter vorgeht, mindestens für ungewöhnlich. Er hat selbst erlebt, welchem Spießrutenlauf sich Renesse in Essen ausgesetzt sah: "Ich habe zweimal mitbekommen, dass sich Kollegen sehr abfällig über ihn geäußert haben. Die Formulierungen waren zum Teil so hasserfüllt, dass ich mir dachte, er könnte Opfer eines Mobbings geworden sein." Wolfgang Meyer weiß, wie es sich anfühlt, mundtot gemacht zu werden. Als er 2006 ein einziges Urteil zugunsten von Ghettorenten-Klägern fällte und ähnlich argumentierte wie Renesse, war sein 4. Senat stante pede alle Ghettofälle los. "Der Hauptgrund war – und das ergibt sich auch aus mir vorliegenden ministerialen Aktenauszügen –, dass der 4. Senat unter meinem Vorsitz eine politisch unliebsame Rechtsprechung durchführte."
Zurück ins Düsseldorfer Landgericht. Vier Jahre dauert das Verfahren gegen Richter Renesse an diesem 10. März nun schon, als er, neben seinem Anwalt sitzend, einen Stoß Akten aus seiner Ledertasche holt. Er rechnet fest damit, verurteilt zu werden, aber er ist vorbereitet. Jeden seiner Punkte hat er mit Beweisen unterfüttert. Allerdings wird die Verhandlung bereits nach 30 Minuten beendet – ohne dass er ein Wort hätte sagen können. Das Gericht schlägt eine gütliche Einigung vor. Beide Seiten willigen ein, die Gespräche wieder aufzunehmen. Gibt es bis zum 19. April, so heißt es damals, keine Einigung, droht das Richterdienstgericht Renesse mit einer "ultra petita". Das bedeutet, das Urteil könnte das von Justizminister Thomas Kutschaty geforderte Strafmaß von 5.000 Euro übersteigen. Denkbar wäre vom Verweis bis zur Suspendierung aus dem Richterdienst dann vieles.
Nach der Sitzung steht Renesse mit gemischten Gefühlen da. Einerseits gebe es die Aussicht auf eine Einigung, doch andererseits: "Die Drohung, dass es noch schlimmer kommen könnte, ist schon bedrückend." Renesse wäre inzwischen bereit, dem Justizminister entgegenzukommen und nie mehr öffentlich über das Thema zu sprechen. Er ist mürbe nach vier Jahren Disziplinarverfahren. "Man lebt die ganze Zeit mit diesem Mühlstein um den Hals, hat für nichts anderes mehr Kraft. Gerade für mich als Richter, der des Berufs wegen einen absolut sauberen Leumund haben soll, ist so was einfach nur schrecklich."
An diesem 10. März, als er der ZEIT sein wohl letztes Interview zur Ghettorente gibt, weiß Renesse noch nicht, dass die vereinbarte Frist am 19. April verstreichen und die Einigungsgespräche scheitern werden. Für den 13. September ist stattdessen ein neuer Gerichtstermin anberaumt worden. Was er aber weiß, ist, dass nicht nur mit fairen Mitteln gekämpft wurde. Um das zu verstehen, muss man noch einmal an den Anfang der Geschichte zurückkehren, ins Jahr 2007. Renesse wandte sich damals an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Um Opfern und Richtern den mühsamen Weg durch die Rentenbürokratie zu ersparen, schlug Renesse eine Pauschalzahlung von 5.000 Euro und weitere 100 Euro monatliche Rente für alle vor, deren Antrag für glaubhaft befunden wurde. Das Ministerium lehnte jedoch mit Verweis auf die mangelnde "Wirtschaftlichkeit" ab.
Renesse entschloss sich, bei der Anhörungsstelle für Holocaust-Überlebende im israelischen Finanzministerium um Unterstützung zu werben. Deren Mitarbeiter haben seit Jahrzehnten Erfahrung mit Entschädigungsverfahren. Doch das Justizministerium verbot ihm die Kontaktaufnahme. Das Schreiben des Ministeriums an den damaligen Präsidenten des Landessozialgerichts findet sich in den Akten von Renesses Widersacher – der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Und die zeigte sich damals mit dem Verbot zufrieden. "Im Ergebnis", heißt es in einer Mail des Datenschutzbeauftragten der DRV an Kollegen, "wurden hier Herrn Richter Dr. Renesse Grenzen (...) gesetzt." Doch wie konnten solche Interna zur Rentenversicherung gelangen?
Das Justizministerium betont, das Dokument nicht verbreitet zu haben. Unterzeichnet wurde es von einem Mitarbeiter im Justizministerium namens Joachim Nieding. Seit 2013 ist dieser Präsident des Landessozialgerichts in Essen. Und war damit als Vorgesetzter Renesses unmittelbar in den nun geplatzten Einigungsprozess involviert.