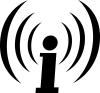Steigende Mieten und hohe Baukosten verstärken den Druck auf die letzten unsanierten Wohnungen in den Städten. Manche Vermieter versuchen, die Altmieter loszuwerden. Die wehren sich immer heftiger.
Als er das erste Mal von der Rigaer Straße 94 hörte, hatte der Investor die Millionenrendite wohl schon vor Augen. Schließlich steht dort eines der letzten unsanierten Gebäude im ansonsten aufmöblierten Berliner Szenebezirk Friedrichshain. Ein schöner Altbau, errichtet um 1900 in einer ruhigen Straße mit Kopfsteinpflaster, dicken, hohen Bäumen, dazu eine hervorragende Anbindung an U- und S-Bahn.
Gut, da war dieses Problem, dass ein paar linksradikale Rabauken zu absurd niedrigen Mieten in dem Haus wohnten und außerdem noch die Erdgeschossräume besetzt hatten und dort eine illegale Kneipe und eine Werkstatt betrieben.
Aber die wird man mit ein paar Tricks schon los, dachte sich der Investor vermutlich, gründete eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln, ließ die Firma das Haus kaufen und nach einer gewissen Schonfrist dann als ersten Akt die Kneipe und die Werkstatt räumen. Das war am 22. Juni.
Investor versteckt sich hinter Briefkastenfirma
Was dann passierte, machte bundesweit Schlagzeilen: Fast jede Nacht brannten seitdem in Berlin Autos, wurden Farbbomben geschmissen und Scheiben eingeschlagen. Vor zwei Wochen lieferten sich 3800 Randalierer mit 1800 Polizisten eine der größten Straßenschlachten seit den Häuserkämpfen in den 80er-Jahren.
Wenige Tage später entschied das Berliner Landgericht, dass die Räumung von Kneipe und Werkstatt illegal war. Man feierte eine Wiedereröffnungsparty. Und der Investor konnte sich vermutlich nur über eines freuen: dass er sich hinter einer Briefkastenfirma versteckt hatte und daher niemand sein Auto oder sein Haus anzünden konnte. Auch weiterhin hält er sich bedeckt, aus Angst vor Bedrohungen oder Racheaktionen.
Der Fall ist extrem, und doch zeigt er mustergültig, wie sich der Kampf um die letzten unsanierten Wohnungen in gefragten Lagen zuspitzt. Jahrzehntelang konnten Entwickler und Investoren mit Luxussanierungen von Mehrfamilienhäusern relativ einfach gute Gewinne erzielen.
Wer mit Sanierungen Geld verdienen will, muss Risiken eingehen
Doch der Markt ist eng geworden. Es gibt immer weniger Objekte, die infrage kommen. Viele Häuser sind fertig, neue Bewohner sind eingezogen, die Gentrifizierung schreitet voran. Wer jetzt noch mit Sanierungen Geld verdienen will, der muss sich an immer riskantere Schrottimmobilien wagen – oder an solche wie die Rigaer Straße 94, die aus politischer Sicht etwa so attraktiv ist wie ein Kindergarten auf einer Sondermülldeponie.
Die Aussicht auf Rendite ist dennoch verlockend. Denn obwohl die Kosten für Grundstücke, Handwerker und für energetische Ausstattung immer weiter steigen, können Investoren wegen der enormen Nachfrage durch Zuzügler eine ordentliche Marge erzielen – sei es durch den Verkauf als Eigentumswohnung oder mit einer deutlichen Mieterhöhung. Voraussetzung in beiden Fällen: Die alten Mieter müssen raus. Irgendwie.
Frühere Abrisshäuser werden nun saniert
Der Run auf die letzten unsanierten Altbauten hat vor allem in ostdeutschen Städten zugenommen, wo in Hinterhöfen und Seitenstraßen noch viele klapperige Altbauten vor sich hindämmern. Manche stehen seit vielen Jahren leer, die Fensterscheiben zerschlagen, die Dächer löchrig, die Holzböden durchweicht. Manche sind aber auch noch bewohnt.
Höhere Nachfrage, steigende Grundstückspreise und mangelnde Alternativen lenken das Interesse der Entwickler jetzt auf solche Objekte. "Häuser, bei denen man vor ein paar Jahren noch mit einem Abriss gerechnet hätte, werden jetzt entdeckt und saniert", bestätigt Raik Säbisch vom Verband Privater Bauherren (VPB) in Leipzig.
In der Innenstadt von "Hypezig", wie die Stadt wegen des neuerlichen Booms genannt wird, gebe es auch noch einige besetzte Häuser. "Die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren nach und nach geräumt", erwartet Säbisch.
Ohne Entmietungen geht es nicht
Die Rigaer Straße wird also nicht das letzte Rückzugsgefecht der Besetzer sein. Und während sich die Gruppen in der Nummer 94 auf die nächste Räumung vorbereiten, kann man direkt nebenan besichtigen, was sich mit einer modernisierten Immobilie verdienen lässt.
Im Haus Nummer 26 wird gerade eine sanierten Zweizimmerwohnung mit 65 Quadratmetern angeboten. Die Wohnung hat einen billigen Laminatboden, keine Einbauküche, aber immerhin sind Fenster und Bäder neu gemacht. Die Kaltmiete: 722 Euro. Das sind elf Euro pro Quadratmeter. Dabei liegt die Durchschnittsmiete für diese Größe und Lage laut Mietspiegel bei 5,62 Euro.
Solche Preissprünge sind nur machbar, wenn die bisherigen Mieter weichen. Denn bestehende Mietverträge sind vor großen Erhöhungen geschützt. Maximal elf Prozent der Modernisierungskosten, bezogen auf eine Wohnung und auf das Jahr gerechnet, dürfen auf die Nettokaltmiete aufgeschlagen werden.
Von sechs auf elf Euro, wie in der Rigaer Straße, kommt man unter Einhaltung dieser Regel jedenfalls nicht. Da in vielen Städten aber immer mehr zahlungskräftige Zuzügler immer drängender nach Wohnungen suchen, ist die Versuchung für Investoren groß, zu "entmieten", wie es im Branchenjargon heißt. "Der Druck auf Mieter im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen hat in den letzten Jahren zugenommen", sagt Ulrich Ropertz, Sprecher des Deutschen Mieterbundes.
Vermieter setzen auf Zermürbungstaktik
Seit Jahren häufen sich die Berichte aus den Ortsverbänden des Mieterbundes und erreichen die Zentrale in Berlin. Deshalb kennt Ropertz die Tricks der Vermieter genau: "Um Mieter loszuwerden, reicht oft schon eine Modernisierungsankündigung aus", sagt der Sprecher. "Zieht der Mieter nicht aus, greifen Vermieter oft in die Psycho-Kiste, schicken Abmahnungen, Mieterhöhungen, Kündigungen und so weiter, mit dem einzigen Ziel, Mieter mürbe zu machen."
Manche Vermieter würden auch versuchen, Mietparteien aus dem Haus zu kaufen: "Die vermeintliche Alternative: Entweder in der Wohnung bleiben, lange Umbauarbeiten mit entsprechenden Einschränkungen in Kauf nehmen und danach die teure, für viele unbezahlbare Miete zahlen oder bei einem sofortigen Auszug 2000 Euro auf die Hand bekommen."
Es gibt Vermieter, denen ist jedes Mittel recht, um die alten Bewohner mit ihren Billigmieten loszuwerden. Da fällt wochenlang das Fernsehen, die Heizung oder der Strom aus, da werden Mieter gezwungen, sich ein Dixie-Klo im Hof zu teilen, weil die Bäder leider saniert werden müssen. Da werden Dächer abgedeckt und so lange offen stehen gelassen, bis ein heftiger Regen die Wohnungseinrichtung des Obergeschosses ruiniert.
Mieter werden vorübergehend in Ausweichwohnungen umquartiert, die dann nur halb so groß oder so hässlich sind, dass man sich doch fragt, ob man sich nicht gleich selbst eine schönere Wohnung sucht. Es ist eine dauerhafte Zermürbungstaktik, bei der fast jeder früher oder später aufgibt.
Rausschmiss startet mit fristloser Kündigung
Nicht so Sven Fischer, ein sportlicher, glatzköpfiger Typ mit Berliner Schnauze. Der 46-jährige Catering-Unternehmer und seine Familie sind die letzten verbliebenen Mieter des Hauses Kopenhagener Straße 49, einem Gründerzeit-Mehrfamilienhaus im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Seit die Berliner Immobilienentwickler Bert und Wulf Christmann das Haus im Jahr 2013 kauften, befindet sich Fischer im Krieg mit den Brüdern.
Kurz nach dem Verkauf des Hauses vor drei Jahren habe die Christmann Holding angekündigt, das Haus energetisch sanieren zu wollen: neue Fenster, Zentralheizung, Wärmedämmung. Das Mietshaus sollte in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Für 4500 Euro pro Quadratmeter hätten die Mieter ihre Wohnungen aber auch selbst kaufen können. Laut Mieterverein lag dieser Preis damals 1000 Euro über dem ortsüblichen Tarif.
Ein Mieter nahm das Angebot an. Für den Rest ging der Kampf los. Zunächst habe Christmann eine Reihe fristloser Kündigungen an Mieter geschickt, erzählt Fischer. Nach der ersten Kündigungswelle seien die Bauarbeiten losgegangen: "Unser Haus wurde monatelang eingerüstet und mit Bauplane ummantelt", sagt Fischer. Die Folge: kaum Tageslicht oder frische Luft in den Wohnungen.
Bauarbeiter reißen Schornstein ab
Ein Mieter nach dem anderen gab auf. "Viele Leute hat es regelrecht krank gemacht, hier noch weiter zu wohnen." Fischer dagegen wurde mit jedem Vorfall kampfeslustiger. Während er mit seiner Familie im Sommerurlaub war, brachen Bauarbeiter von oben durch die Badezimmerdecke seiner Dachwohnung und flexten den Wasserboiler ab.
Einige Tage später stellte Fischer fest, dass die Bauarbeiter auch den Schornstein herausgerissen und mit Brettern zugenagelt hatten. Weil es keinen Abzug mehr gab, war Fischers Gasetagenheizung unbrauchbar: kein warmes Wasser, keine Heizung mehr.
Mittlerweile ist der Schornstein wieder aufgebaut. Bis auf Fischer, seine Familie und ein befreundetes Pärchen sind alle Mieter ausgezogen. Zu sechst teilen sie sich eine auf zwei Wohnungen verteilte WG. Die anderen Wohnungen wurden verkauft, nur das Team Fischer wehrt sich weiter.
Christmann will deren Miete von 644,23 Euro kalt auf 2927 Euro warm erhöhen. Fischer will das nicht akzeptieren. "Ich bin es meinen zwei Töchtern schuldig, ich will ein Exempel statuieren." Wenn die Töchter, 15 und 11, erwachsen sind, soll es immer noch bezahlbare Wohnungen in Berlin geben. Fischer sagt, er werde seinen Beitrag dafür leisten.
Sanierer: "Die Angriffe gehen ins Persönliche"
Man hätte gern gehört, was die Brüder Christmann dazu sagen. Die "Welt am Sonntag" bat die beiden am Freitagvormittag, sich im Laufe des Tages zur Kopenhagener Straße zu äußern. Bert Christmann antwortete, die Anfrage sei ihm zu kurzfristig, und verwies auf ein Interview, das er im vergangenen Jahr der "Welt" zu dem Thema gegeben hatte.
Damals hatte Christmann gesagt, der Einbruch bei Fischer sei nicht in Ordnung gewesen. Er gehe aber auf das Konto der Baufirma, nicht auf seines. Der Krieg mit dem letzten Mieter sei auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Wie man sich fühlen solle, wenn man im Gerichtssaal Dutzenden Gentrifizierungsgegnern mit Trillerpfeife gegenübersitze? Christmann: "Die Angriffe gehen ins Persönliche."
In der Immobilienbranche spricht man nicht gern über solche Dinge. Niemand will mit schwarzen Schafen in Verbindung gebracht werden, die für ihre Rendite über Mieterexistenzen gehen. "Wenn man sauber und sozial verträglich arbeiten will, lohnen sich Sanierungen nicht mehr", sagt ein Berliner Immobilienentwickler, der sich heute auf Neubauten konzentriert.
Bis vor knapp zehn Jahren machte seine Firma nichts anderes, als Mehrfamilienhäuser aufzukaufen, sie aufwendig zu sanieren und die Wohnungen anschließend teurer zu verkaufen oder zu vermieten. Rentieren konnte sich das aber eben nur, wenn ein großer Teil der früheren Mieter auszog – entweder gegen eine Abfindung oder durch natürliche Fluktuation. "Das funktioniert heute nicht mehr, weil die Leute aufgrund der enorm gestiegenen Mietpreise in ihren alten Wohnungen festsitzen", sagt der Unternehmer.
In Berlin ziehen die Menschen nicht mehr um
2010 hatte Berlin noch eine Mieterfluktuation von zehn Prozent. Aktuell sind es nur noch drei Prozent. Auch wer eigentlich lieber den Stadtteil wechseln will, gern einen Balkon hätte oder ein Zimmer mehr oder weniger braucht, bleibt in seinem ungeliebten Apartment sitzen. Die Alternative wäre einfach zu teuer.
Die Menschen sind in ihren Mietwohnungen gefangen. Da ist dann auch eine großzügige Abfindung nicht mehr attraktiv. "Loswerden können Hausbesitzer ihre Mieter daher oft nur noch, indem sie sie mit fiesen Tricks rausekeln", sagt der Entwickler, der sich inzwischen komplett auf Neubauprojekte spezialisert hat.
Zudem steigen die Sanierungskosten selbst immer weiter, was den Renditedruck noch weiter erhöht. Der Leipziger Bauherren-Berater Säbisch geht bei einem maroden Altbau von 2000 Euro Kosten pro Quadratmeter Wohnfläche aus. Die "Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen" (Arge) in Kiel rechnet sogar mit bis zu 2500 Euro – jedenfalls wenn das ganze Haus auf den Kopf gestellt, der gesamte Grundriss geändert wird und Barrieren beseitigt werden. Viele Materialien haben sich verteuert. Und die Handwerksbetriebe sind so stark ausgelastet, dass sie, anders als noch vor zehn Jahren, hohe Preise verlangen können.
Auflagen für KfW-Kredite treiben die Kosten hoch
"Es gibt einen weiteren Kostentreiber", sagt Arge-Geschäftsführer Dietmar Walberg: die staatseigene Förderbank KfW. Wer ein Haus energetisch saniert und dafür Fördermittel der KfW nutzen will, muss dafür immer strengere Vorgaben erfüllen. "Bei der Gestaltung der Förderung durch die KfW liegt der Fokus eher auf einer möglichst hohen Energieersparnis. Soziale Aspekte haben weniger Relevanz."
Gemeint ist: Bekommt ein Haus eine Dämmschicht nach den aktuell gültigen Vorgaben sowie eine Öko-Heizung, sieht sich der Vermieter anschließend dazu gezwungen, die Miete deutlich zu erhöhen – trotz Förderung. "Zwangsläufig zwei bis vier Euro" müssten auf die Kaltmiete aufgeschlagen werden, um in den Bereich der Wirtschaftlichkeit zu kommen, so Walberg.
Im Bereich des sogenannten bezahlbaren Wohnraums sei das kaum möglich. Und die Ersparnis bei den Heizungskosten sei für Mieter meistens enttäuschend. "Uns ist kaum eine energetische Modernisierung bekannt, bei der die Ersparnis höher als 50 Cent pro Quadratmeter gelegen hätte", so Walberg. Die berühmte Warmmieten-Neutralität sei "ein Märchen".
Nächste Mietrechtsreform soll Erhöhungen stärker deckeln
Allerdings beobachtet Experte Säbisch in Leipzig auch, dass die Bauträger einfach deshalb höhere Preise verlangen, weil sie es können. Es ist also beides: Höhere Kosten einerseits und höhere Gewinnspannen andererseits sorgen dafür, dass Mieter ihre angestammten Stadtteile verlassen müssen.
Eine zweite Mietrechtsreform soll das verhindern. Laut Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums dürfen Vermieter künftig statt elf Prozent nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen. Zusätzlich soll es eine Kappungsgrenze geben, die Mieterhöhungen für eine Dauer von acht Jahren auf drei Euro pro Quadratmeter deckelt.
Mieterbund-Sprecher Ropertz begrüßt das zwar, ist aber auch skeptisch: "Für Vermieter, deren Ziel es ist, Mieter aus der Wohnung herauszumodernisieren, spielt die Frage, ob acht oder elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umgelegt werden können, kaum eine Rolle. Diese Vermieter modernisieren in aller Regel teuer und umfassend." Und dann lasse man es darauf ankommen.
Das Geschäft mit dem Dachausbau
Wer keine kompletten Häuser mehr zum Modernisieren findet, dem bleibt oft nur noch der Dachgeschossausbau. Fährt man durch deutsche Innenstädte, muss man nicht lange suchen um einen eingerüsteten Dachstuhl zu finden. In der einstigen Billigwohnstand Berlin hat das Geschäft mit den sogenannten Dachrohlingen absurde Züge angenommen.
Im beliebten Bötzowviertel verkauft eine Immobilienfirma beispielsweise gerade ein unausgebautes Dachgeschoss für 537.000 Euro. Um daraus eine funktionierende Wohnung mit Aufzug und fließendem Wasser zu machen, müsste man vermutlich nochmal das gleiche Geld drauflegen.
Fairerweise muss man sagen: Eine Sanierung ist für Mieter natürlich nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Im Gegenteil: Viele Menschen freuen sich, wenn das Haus, in dem sie leben, frisch gestrichen wird, der Kohleofen durch eine Zentralheizung ausgetauscht oder die Sanitäranlagen auf den neusten Stand gebracht werden – solange die Kosten im Rahmen bleiben.
Und in strukturschwächeren Gegenden Deutschlands wie dem Ruhrgebiet oder auch traditionellen Arbeitervierteln deutscher Großstädte sind Vermieter ohnehin dazu gezwungen, kosteneffizient zu renovieren. Es gibt dort keine Abnehmer für Luxuswohnungen. Selbst die tollste Dachterrasse mit Jacuzzi und die extravaganteste Designerküche würden kaum einen Yuppie in einen Plattenbau in Berlin-Marzahn locken.
Kostendeckend zu sanieren, ist schwierig
"Es ist ein sehr schmaler Grat, eine Wohnung kostendeckend zu sanieren, ohne die Mieter zu verdrängen", sagt Klaus Freiberg, Vorstandsmitglied des Dax-Konzerns Vonovia, mit rund 344.000 Wohnungen der größte private Vermieter des Landes. Der Bestand umfasst viele ehemalige Werkswohnungen, jedes Jahr werden etwa drei Prozent davon energetisch modernisiert.
Die Mieten würden durchschnittlich um zwei Euro pro Quadratmeter steigen und lägen danach meist immer noch unter dem Durchschnittspreis bei Neuvermietungen. "Das halte ich für sozial vertretbar." Grundsätzlich sei es schwierig, alle Mieter glücklich zu machen. "Die Menschen werden immer älter. Daher würde es absolut Sinn machen, überall Aufzuganlagen anzubringen – aber wenn der Großteil der Mieter sich dagegen wehrt, dann lassen wir es bleiben."
Trotzdem hat auch Vonovia regelmäßig Ärger. In Mainz-Oberstadt zum Beispiel, wo der Konzern gerade zwei Wohnungsblocks mit 48 Parteien saniert. Anfang Juni wurden die Balkone abgerissen. Vonovia will neue, vier Quadratmeter größere Balkone anbringen. "Die alten waren sanierungsbedürftig", sagt Freiberg. Einige Mieter haben sich beim Mieterbund und in der Lokalpresse beschwert. Die alten Balkone seien noch gut gewesen, die neuen Balkone erhöhten die Quadratmeterzahl der Wohnung und machten sie unnötig teurer.
Wegen der Widersprüche strich der Konzern eine andere geplante Renovierungsmaßnahme: So werden die alten Fenster nun doch nicht durch neue ausgetauscht. Das war dann vielen auch wieder nicht recht, sagt Freiberg: "Postwendend haben sich andere Mieter bei uns gemeldet, die nun doch die neuen, dreifachverglasten Fenster haben möchten."