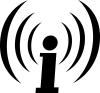Am Dienstagabend wurde über Demonstrationen diskutiert, also auch über Legida
»Leipzig, Hauptstadt der Demonstrationen – gerät der Straßenprotest zum Ritual?«, fragte die Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Talkgäste in der Albertina. Dann folgte: Leipzig ist besser als Dresden und Linksextremismus ist auch böse. Zum Schluss zeterten die Wutbürger.
Dienstagabend, neuer Vortragssaal in der Universitätsbibliothek Albertina, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat zum Talk geladen. »Gerät der Straßenprotest zum Ritual?«, fragen die Gastgeber. Moderator Holger Tschense, SPD-Mitglied und geschasster früherer Leipziger Ordnungsbürgermeister, konstatiert: »Profidemonstranten« bevorzugen offenbar Leipzig, jedenfalls sei die Zahl der Demonstrationen hier viel höher als etwa in Nürnberg oder Hannover. Die naheliegende Erklärung: Weil es in Sachsen ein enormes gesellschaftliches Problem gibt – doch das will keiner der Gesprächsgäste so direkt sagen. Stattdessen werden die bekannten Standpunkte ausgetauscht.
Jürgen Vormeier, Richter am Bundesverwaltungsgericht, erzählt etwas zum Versammlungsrecht – dem politischen Kampfrecht der Minderheit, das auch eine Gegendemo in Hör- und Sichtweite einschließt, nicht jedoch eine Sitzblockade, die hier in Sachsen als Straftat behandelt wird. Ine Dippmann, freie Radiojournalistin und Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, berichtet von ihren Erfahrungen auf Pegida- und Legida-Demonstrationen, bei denen auf der Bühne gehetzt und die Reporterin später von Wutbürgern angegriffen wurde. DGB-Regionalgeschäftsführer Erik Wolf hält die Fahne der Weltoffenheit Leipzigs gegenüber Dresden hoch und formuliert sozialliberale Positionen gegen Legida. Weil hier so viel Widerstand geleistet werde, sei der Ruf besser als der des Regierungssitzes an der Elbe. Und zu guter Letzt ist da noch Gerold Hildebrand, Projektleiter Linksextremismusprävention in der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, der die anderswo längst verworfene Extremismustheorie wiederkäut.
Es kommt, wie es kommen muss: Der eher liberal eingestellte Teil von Podium und Publikum verteidigt seine Position gegen die Rechtspopulisten. Die konservative Gegenseite tut so, als würde sie politisch verfolgt, anstatt zuzugeben, dass sie in Wirklichkeit die Regierungsgeschäfte in Bund und Land führt. Die Wutbürger im Publikum schimpfen auf die Jugendlichen, die »Nie wieder Deutschland« und »Gegen Bullen« rufen, und wiederholen ihre Mantras, man werde völlig zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt.
Es gibt nur wenige Lichtblicke an diesem Diskussionsabend, etwa wenn der selbst konservative Bundesverwaltungsrichter den Projektleiter Linksextremismusprävention widerlegt, der behauptet hat, es gebe Straftatbestände wie Propagandadelikte, die nur Rechtsextremisten begehen könnten (ergo sei die höhere Zahl rechter Straftaten letztlich falsch). Nein, die gleichen Tatbestände gebe es in ostdeutschen Bundesländern auch für Linke, sagt der Richter. Da ist der Kämpfer gegen Linksextremismus kurz bloßgestellt. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, kurz darauf weiter ein dramatisches Bild links motivierter Gewalt zu zeichnen – und Neonazimorde einfach unerwähnt zu lassen.
Es ist wie immer: Die rechte Gegenseite will einfach nichts hören. Sie findet es mindestens genauso gefährlich, wenn jemand »Bullenschweine« ruft, wie gegen Ausländer zu hetzen. Dass die Polizei bewaffnet ist und sich verteidigen kann, während Flüchtlinge ihren Angreifern oftmals wehrlos gegenüberstehen, spielt hier offenbar keine Rolle.
Die Debatte verharrt beim alten Problem: Die rechte Position gibt nicht zu, dass sie eigentlich strukturelle Ungleichheit will, dass es ihr um Machtausübung geht und dass Gewalt dieser Ausrichtung immanent ist. Die linke Seite wiederum ist von vornherein in Verteidigungshaltung dafür, dass sie für Freiheit, Gleichheit und Solidarität, gemeinhin menschenfreundliche Werte, auf die Straße geht. Und immer muss sich eine linke Position rechtfertigen für Leute, die Fensterscheiben zertrümmern und Autos kaputt machen – während die rechte Position auf die Angriffe auf Flüchtlinge gar nicht eingeht oder einfach behauptet, das habe mit ihr nichts zu tun.
Moderator Tschense findet in seinem Schlusswort, Diskussionsforen zu diesem Thema könne es gar nicht genug geben. Man will hinzufügen: So lange die Debatte nicht von der Stelle kommt, braucht man nicht mal eine neue Einladung zu schreiben.
CLEMENS HAUG