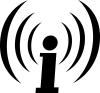Der Freiburger Clubstreit wirft eine alte Frage auf: Wonach wird entschieden, wer feiern darf? In Berlin ist die Türpolitik hart – und für einige härter.
Irgendwann merkte Momo Nizar, dass es an seinem schwarzen Bart liegt, seinem Teint. Er war 18, ein anständiger Junge, wie er sich selbst nennt, machte Abitur und keinen Ärger. Das wollte er mit seinen Freunden im Berliner Nachtleben feiern. Aber statt im Rausch, sagt Nizar, endete der Abend in einer Erkenntnis: "Es zählt nur, ob du blonde Haare hast." Sechs Diskotheken, sechs Türen, sechs Mal: "Sorry, heute nicht."
Heute ist Momo Nizar 27 Jahre alt. Er lebt in Berlin, der Stadt, in der er geboren wurde und aufgewachsen ist. Feiern geht er nur noch, wenn er den Türsteher oder Veranstalter kennt. Nie spontan. Der Aufwand lohne nicht, sagt er. Zu hoch sei die Wahrscheinlichkeit, dass er und seine Freunden abgewiesen werden. Wie er sind sie Deutsche, aber ihre Eltern oder Großeltern kommen aus der Türkei oder aus dem Iran. Nizars Eltern kommen aus Tunesien. Deswegen, sagt er, kamen sie damals nirgendwo rein, genauso wenig wie heute: "Die Türsteher denken sich, das ist wieder nur irgend so ein Achmed, der am Ende noch jemanden absticht."
"Irgend so ein Achmed", damit beschreibt Nizar die Schublade, in die er gesteckt wird. Die Türsteher sähen seinen dunklen Teint und würden daraus schließen: zu viel Temperament, zu viel Aggressionspotenzial. Ist Berlins Türpolitik rassistisch? "Auf jeden Fall", sagt Nizar. Und setzt, als ob keine Zweifel aufkommen sollen, hinzu: "hundertprozentig."
Vor eineinhalb Wochen ist ein Freiburger Club wegen einer öffentlich gewordenen Mail in die bundesweite Aufmerksamkeit geraten: Demnach hätten Besitzer des White Rabbit entschieden, Flüchtlinge, die sich nicht mit einem Aufenthaltstitel ausweisen können, pauschal abzuweisen. Das wären alle, deren Asylverfahren noch läuft; sie bekommen nur eine sogenannte Aufenthaltsgestattung. Die Geflüchteten sollen vermehrt sexuell übergriffig geworden sein und Taschendiebstähle begangen haben. In einem späteren Facebook-Post distanzierte sich der Club von der Forderung und stellte klar, dass sie nie umgesetzt worden sei. Es habe sich um einen internen Hilferuf gehandelt.
Dennoch, die Debatte wirft ein Schlaglicht auf einen alten Vorwurf: dass Menschen, vor allem Männer, die nicht typisch deutsch aussehen, ein größeres Problem haben, in Clubs zu kommen. Auch in Berlin, der Stadt, in der es die härteste Türpolitik Deutschlands geben soll.
"An der Clubtür wird geschaut: Passt das Publikum? Das hängt nicht vom kulturellen Hintergrund ab", sagt Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission Berlin. Der Verein vertritt viele Clubs der Stadt: vom Rockclub Sage über den Techno-Laden ://about blank bis zum Matrix Club an der Warschauer Straße. Fast überall haben sie das gleiche Problem: Es wollen an vielen Abenden mehr Menschen in die Clubs als hineinpassen. Eine Auswahl an der Tür sei daher nicht zu umgehen, sagt Leichsenring, und: "Das Ganze kann nicht wirklich demokratisch ablaufen."
Die Türsteher müssten innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen: Wer aussehe, als ob er nur Frauen anbaggern oder sich betrinken wolle, komme nicht rein. "Dann ist Ärger vorprogrammiert", sagt Leichsenring. Wie man das erkennt? Gruppengröße, Grad der Betrunkenheit, Erfahrungswerte. "Das sollte nicht diskriminierend verstanden werden." Ein Beispiel: "Wenn gegenüber von einem Club ein Flüchtlingsheim aufmacht und alle geschlossen rüberkommen, kann es schon passieren, dass sie abgelehnt werden. Das liegt dann aber nicht daran, dass sie Flüchtlinge sind. Schweden würden genauso abgelehnt werden."
Leichsenring betont, dass die Berliner Clubs etwas für Flüchtlinge tun. So sei im Herbst die Aktion Plus1 gestartet, bei der Veranstalter und Gästelistengäste aufgefordert werden, einen Euro zu spenden. Die Erlöse gehen an verschiedene Vereine, die sich für Flüchtlinge engagieren.
Wenn Momo Nizar die Türsteher gefragt hat, warum er nicht reinkommt, erzählten die etwas vom Outfit, oder sie sagten gleich: "Hau ab." Nizarist sich sicher, dass es an der Schublade liegt, in die er gesteckt wird. "Aber das sagen die dir nicht ins Gesicht, das dürfen sie nicht."
Vor zweieinhalb Jahren hat er das selbst getestet. Weil er wollte, dass sich etwas ändert, sagt er. Für Stern TV versuchten er und zwei Männer mit türkischem Migrationshintergrund es in verschiedenes Clubs: im Maxxim, Puro, 40seconds, E4, Adagio, Felix. Sie hatten sich herausgeputzt – und wurden fast überall abgelehnt, nur das Tube ließ sie rein. Danach tauschten sie die Klamotten mit drei Männern ohne Migrationshintergrund. Die hatten blonde Haare und kamen problemlos in jeden Club rein.
Behnam Mashoufi betreibt mit seiner Eventagentur das Clubkonzept Tube Station. Er sagt, er erlebe Berlin generell als offene Stadt. Auch im Tube spiele die Herkunft der Gäste keine Rolle. Ihnen werde auch mal Rassismus vorgeworfen, wie allen Clubs, sagt er. Aber die Vorwürfe gingen meistens von Menschen aus, die nicht hereingelassen wurden. Aber: "Das wird ja schon dadurch widerlegt, dass man ein buntes Publikum hat." Draußen bleiben müsse zum Beispiel, wer schon an der Tür schwanke, drängle oder lalle. Mashoufi betont: "Es gibt auch genug Deutsche, die deswegen nicht reinkommen."
Leichsenring von der Clubcommission unterscheidet außerdem zwischen Großraumdiskotheken und seinen alternativen Clubs. In den Großraumdiscos gehe es um das Sehen und Gesehenwerden, um den billigen Alkohol. "Bei uns geht es eher um die Musik." Um zu erkennen, wer wirklich zur Band oder zum DJ passe, würden Türsteher auch gern das Abendprogramm abfragen. Nur wer sich auskenne, komme rein.
Schadensersatz wegen Ungleichbehandlung
Egal ob in Großraumdisco oder kleiner Club: Es ist verboten, Menschen wegen ihres Aussehens pauschal vor der Tür abzuweisen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schreibt seit 2006 fest, dass niemand wegen seiner Rasse oder ethnischen Herkunft von öffentlichen Dienstleistungen ausgeschlossen werden darf. Im Zuge dessen kam es schon zu einigen Gerichtsverhandlungen mit unterschiedlichem Ausgang: In Leipzig wurden Clubbesitzer mit Verweis auf das AGG bereits erfolgreich verklagt,so bekam ein Syrer beispielsweise Schadensersatz zugesprochen. Auch in München verklagte ein Mann aus Burkina Faso mehrere Clubs. Zwei Klagen waren erfolgreich, eine wurde abgelehnt.
In Berlin sind der Landesstelle für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung solche Fälle nicht bekannt. Jedoch würden sich nicht alle Menschen mit solchen Erfahrungen bei ihnen melden, sagt eine Sprecherin. Die Gleichung "keine Fälle – kein Problem" stimme daher nicht: "Da stehen auch in Berlin zu viele persönliche Ausgrenzungserfahrungen dagegen."
Nizar nennt sich selbst einen "topintegrierten Deutschen". Er versteht die Türsteher sogar. Sie müssten eine Entscheidung treffen, wollten keinen Stress und bauten eben auf ihre Erfahrungswerte. Die Clubs seien auch nicht das einzige Problem. Er bemerke diese Form des Schubladendenkens in vielen Situationen. Wenn er zum Beispiel auf die Frage, wo er herkomme, antworte: Berlin. Die Leute würden dann immer fragen: Nein, ursprünglich? Nizar wüsste auch nicht, wie man das Problem vor Berlins Clubtüren lösen könne. Aber wenn alle über einen Kamm geschert würden, dann sei das eben: Rassismus.
Momo Nizar geht nicht mehr so oft feiern. Er ist verheiratet und macht seinen Master an der Technischen Universität in Berlin. Sein jüngerer Bruder zieht jetzt nachts um die Häuser. Er ist 22 Jahre alt. Von ihm weiß Nizar: Geändert hat sich nichts.