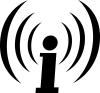Hoyerswerda. Die Flamme darf nur für einen Moment ans Ohr, den exakt richtigen Moment, das ist das Geheimnis. Lang genug muss er sein, damit die Härchen kurz aufglühen und dann mit einem leisen Knistern verglimmen. Kurz genug muss er sein, dass die Haut nicht verbrennt und der Kunde aufspringt. Es ist eine Frage des Maßes. Und der Erfahrung.
Naser Kassem war 13, als er begann, Haare zu schneiden und Bärte zu pflegen, in seiner Heimatstadt Sour. Vier Jahre war er in der Schule, dann trafen Bomben das Gebäude. Heute ist der Barbier, der sich am liebsten nur Naser nennen lässt, 40 und Tausende Kilometer von zu Hause entfernt. Aber die Arbeit hat sich für ihn nicht verändert. „Schwarze Haare, blonde Haare, Libanon, Hoyerswerda, egal“, sagt er.
Wenn Naser Haare entfernen will, holt er ein Feuerzeug aus einer Schublade. Wenn er Augenbrauen bearbeitet, greift er eine Rolle Garn, klemmt sich das Ende zwischen die Zähne, wickelt den Faden um seine Finger zu einer Schlinge und fährt damit über Wangen, Stirn, Lider. Dort, wo er herkommt, ist das ein vertrauter Anblick. Alle Barbiere machen das so. Dort, wo er jetzt lebt, ist es eine Attraktion. Ein älterer Herr, dem Nasers Kollegin die Haare schneidet, sieht ihm eine Weile schweigend zu. Dann fragt er: „Was macht er da eigentlich genau?“ Und schließlich: „Kann ich das nächste Mal auch einen Termin bei ihm bekommen?“
Nasers Geschichte handelt von Flucht. Aber mehr noch handelt sie von geglückter Ankunft. Und sie handelt von einer Stadt, die ihn aufgenommen hat, obwohl sie einmal für einen ganz anderen Geist stand. Vielleicht hat sie ihn aber auch so gut aufgenommen, gerade weil sie wegen ausländerfeindlicher Übergriffe berüchtigt war.
Es war vor zwei Jahren, eine gute Woche vor Weihnachten, als Naser, seine Frau Yasmin und die beiden Töchter den Libanon verließen. Yasmin, Krankenschwester von Beruf, hatte ihre Stelle verloren, weil sie zur verfolgten palästinensischen Minderheit gehört. Dabei brauchten sie Geld umso dringender, als ihre Ältere, Acil, mit einem zu großen Kopf geboren wurde. Sie braucht länger, um zu lernen, sprechen, laufen, alles kam später. „Krankenhaus, Schule, alles teuer“, sagt Naser. Er verkaufte sein Geschäft und bezahlte einen Schlepper. Am letzten Tag des Jahres 2013 kamen sie in Deutschland an.
Es wurde kein einfacher Beginn. Sie zogen in das erste Flüchtlingsheim, das gerade in Hoyerswerda eröffnet worden war. „Ein Zimmer für uns alle“, sagt Naser. Es war eng im Heim, der Ton unter den Flüchtlingen rau. Aber das war nicht das Schlimmste für Naser. „Das Schwerste“, sagt er, „war, nichts machen zu können.“ Den ganzen Tag warten und Al Dschasira gucken, das war für den Mann, der im Libanon zwölf Stunden am Tag arbeitete, unerträglich. Er begann, Fahrräder zu reparieren. Es sprach sich herum, bald brachte jeder sein Fahrrad zu ihm. Aber dann hatte eine Helferin im Heim die Idee, Naser könne doch ein Praktikum in einem Friseursalon machen. „Soll mal kommen“, sagte Heiko Schneider. So fing es an.
Schneiders Salon, „HaarSchneider“, liegt in einer Gasse der Altstadt, aber es ist ein sehr moderner Ort. Die Frauen, die hier arbeiten, heißen Stylistinnen, sie sind schwarz gekleidet, tragen kleine Knöpfe im Ohr, immer auf Empfang für interne Durchsagen. Schneider, ein Mann mit dunklem, lockigem Haar, ist kein Sozialarbeiter. „Meine Tochter lebt im Ausland. Da will ich auch, dass sie fair behandelt wird.“ Deshalb gab er Naser eine Chance. Er sagt aber auch: „Ich bin Unternehmer.“ Es geht nicht nur um Nächstenliebe.
Als Unternehmer sah er, dass Naser kein Deutsch konnte, dass er Kunden den falschen Kaffee brachte, weil er „Milch“, aber nicht das „ohne“ davor verstand. Er sah, dass Naser Haare manchmal kürzer schnitt, als die Kunden es wollten, weil er recht strenge Vorstellungen von Ordnung auf dem Kopf und im Gesicht hat.
Er sah aber auch, dass Naser extrem schnell lernte. Dass er anhand der Farben im Buchungssystem sah, was die Kunden wollten. Dunkelblau für Waschen und Schneiden, braun für Bartpflege, und so weiter. Und vor allem sah er, dass Naser etwas konnte, was sonst keiner konnte in Hoyerswerda. „Das Orientalische kannte hier ja bislang keiner.“
Dass sie Neuland betraten, merkte Schneider, als er Naser bei der Arbeitsagentur anmelden wollte. Einen Flüchtling anstellen? „So etwas“, sagte der Sachbearbeiter, „hatten wir hier noch nicht.“ Der gleiche Satz bei der Krankenkasse. Dennoch sagt Schneider heute: „Es war weniger bürokratisch, als ich befürchtet hatte.“ Man muss es nur wollen.
Die Hoyerswerdaer kennen jetzt jedenfalls ihren Barbier. Johannes zum Beispiel, 29, „im Tagebau tätig“, wie er sagt. „Kriege ich selbst so nicht hin“, sagt er, als er mit frisch gestutztem Hipster-Vollbart in die Gasse tritt. Oder Maik, „selbstständiger Handwerker“, muskelbepackter Oberkörper im T-Shirt. „Hat den richtigen Beruf ergriffen“, sagt er über Naser. Das ist, so wie er das sagt, ein großes Kompliment.
Naser ist der einzige Flüchtling, den Maik persönlich kennt. Hat sich seine Meinung über Flüchtlinge dadurch verändert? „Für mich“, antwortet Maik, „zählt sowieso nur, was einer macht oder nicht macht.“ Toleranz ist nicht selbstverständlich. Aber man kann sie sich verdienen.
Es gab andere Zeiten. 1991 war es, da randalierten Hunderte vor den Heimen von Flüchtlingen und Vertragsarbeitern. Ein Mob warf Steine, Neonazis griffen Menschen an. Bürger klatschten Beifall. Die Polizei konnte und wollte sie nicht stoppen. Hoyerswerda wurde zum Synonym für Fremdenfeindlichkeit – und zum Auftakt einer Serie von Übergriffen.
Den Menschen hier haben sich diese Tage eingebrannt. Nicht weit von dem Mahnmal, das an die Ausschreitungen erinnert, einem offenen Tor mit Regenbogen, trägt ein Rentner einen Stoffbeutel vom Supermarkt im Lausitz-Center nach Hause. Gerhard Meyer heißt er, 79, ehemaliger Bergingenieur. Meyer macht gern in Österreich Urlaub. „Aber wenn ich gefragt werde, woher ich komme, sage ich immer: aus der Nähe von Dresden.“ „Hoyerswerda“ kommt ihm nicht über die Lippen. Dafür sitzt die Scham zu tief.
Die Probleme der Stadt sind noch immer groß. Von einst mehr als 70 000 Einwohnern ist nicht mal die Hälfte geblieben, die Arbeitslosigkeit liegt bei 15 Prozent. Aber wenn man Menschen hier nach ihren Sorgen fragt, dann zählen sie die Flüchtlinge eher nicht dazu. „Ich hör’ immer, es gibt keine Unterkünfte für die, und dann reißen sie hier die Wohnblöcke ab“, sagt ein Rentner vor der Sparkassen-Filiale. „Das passt doch nicht zusammen.“ Sollen sie doch die Flüchtlinge da einquartieren. „Wär’ mir recht.“ Freital, Heidenau, all die Orte der Krawalle dieses Jahres liegen nur eine Autostunde entfernt. Hoyerswerda ist kein Paradies für Fremde. Es gibt gut zwei Dutzend Neonazis, im März beschmierten sie eine Turnhalle, in der Flüchtlinge unterkommen sollten. Aber es blieb doch einigermaßen ruhig. Für Jörg Michel hat das auch mit den Krawallen von damals zu tun: „’91 sitzt den Menschen in den Knochen. Uns ist klar: Hoyerswerda ist jetzt in der Pflicht.“
Michel, kräftig, über 1,90 Meter groß, dunkle Stimme, ist Pastor, sein kleiner Kirchbau liegt zwischen den mächtigen Plattenbaublöcken der Neustadt. Michel kam 1993 aus Görlitz hierher. Kein einfacher Posten, nicht mal jeder Zehnte ist hier evangelisch. Michel kann viel erzählen über die Verunsicherung der Menschen in den Neunzigern, den Verlust des Stolzes. Aber er erzählt auch von Zusammenhalt, vom Willen, die Stadt nicht noch mal den Fremdenfeinden zu überlassen.
Als 2006 Neonazis in Hoyerswerda demonstrieren wollten, haben sie eine Initiative gegen Rechtsextremismus gegründet. Und als 2013 das erste Flüchtlingsheim kam, haben Michel und Mitstreiter das Bündnis „Hoyerswerda hilft mit Herz“ ins Leben gerufen. 80 Bürger machen heute mit. Eine Frau hat Naser Kassem das Praktikum beschafft.
Mit Naser, dem Barbier, hat der Pastor vor einem Jahr seine Weihnachtspredigt begonnen. Die Kassems haben inzwischen eine Wohnung, drei Räume im Wohnkomplex VIII, „viel besser als Heim“, sagt Naser. Sie haben auch ein drittes Kind bekommen, Souyl, sieben Monate ist sie jetzt alt.
Aber ob es ein glückliches Ende für Naser und Yasmin in Hoyerswerda gibt, steht noch nicht fest. Über ihren Asylantrag ist bisher noch nicht entschieden. Dass sie vielleicht wieder zurückmüssen, beschäftigt Naser offenbar nicht. „Hoyerswerda gut“, sagt er.
Dann nimmt er sein Feuerzeug, und in der Luft legt sich der Geruch versengter Haare unter den Duft von Shampoo und Rasierwasser. Es ist eine Mischung, die Naser Kassem sehr bekannt vorkommt. Es riecht kaum anders als in seinem Salon in der alten Heimat.