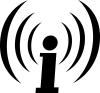Ein Lindauer Anwalt wird als Sohn eines SS-Soldaten Ehrenbürger einer toskanischen Gemeinde, wo einst sein Vater wütete
Lindau/San-Terenzo-Monti. Als die Mörder kommen, steht die Sonne noch nicht hoch über dem italienischen Ort San Terenzo-Monti in der toskanischen Provinz Massa-Carrara. Es ist der 19. August 1944, etwa neun Uhr. Romolo Guelfi hört die schweren Fahrzeuge der SS, die das Dorf von allen Seiten rasch einkesselt. Panik ergreift die Einwohner. Mütter pressen ihre Kinder an sich. Die Alten zögern, manche bleiben, andere fliehen. Die Menschen versuchen sich zu retten vor den deutschen Soldaten, die im Gepäck eine ebenso einfache wie perfide Rechenaufgabe haben: Um das befohlene Todessoll von 160 zu erfüllen, müssen sie noch 107 Zivilisten zusammentreiben. 53 Geiseln haben sie bereits aus Sant Anna di Stazzema geraubt und mitgebracht. Italienische Partisanen hatten Tage zuvor bei einem Angriff auf deutsche Einheiten 16 Soldaten der Waffen-SS getötet. SS-Sturmbannführer Walter Reder ordnete Rache an. Im Verhältnis 1:10.
Romolo Guelfi kann entkommen, noch bevor sich der tödliche Ring der SS schließt. Viele seiner Angehörigen aber nicht. Er versteckt sich auf einem Hügel gegenüber dem Dorf, zerrissen vom eigenen Überlebenswillen und der Sorge um die Verwandten, die der immer enger werdenden Schlinge aus deutschen Soldaten nicht mehr entkommen können. Er schlägt die Hände vors Gesicht, damit er das Menschengewimmel aus Todesangst und Gewalt dort unten nicht mehr sehen muss. Doch die Schreie der Kinder, der Mütter, der Väter und Großeltern kann er nicht ausblenden. Auf einem Gehöft namens Valla treibt die SS ihre Opfer zusammen, stellt sie der Reihe nach auf und erschießt 107 Einwohner mit zwei aufgepflanzten Maschinengewehren. Das jüngste Kind, das an diesem Tag ermordet wird, ist zwei Monate alt. Das älteste Opfer zählt 80 Jahre. Unter den Toten sind drei Angehörige von Romolo Guelfi.
Auch 61 Jahre später scheint wieder die Sonne über San Terenzo-Monti. Der Rechtsanwalt Udo Sürer aus Lindau ist mit seiner Frau und den beiden Kindern im Auto in den engen Straßen des Ortes unterwegs. Aber der hochgewachsene Mann ist nicht als Tourist gekommen. Was er eigentlich hier sucht, weiß er erst, als er es gefunden hat: In einer Sackgasse lässt er schließlich den Wagen stehen und wendet sich an einen alten Mann, der dort auf einer Bank sitzt. Sürer zögert kurz, bevor er Scusi sagt: „Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie ich nach Valla komme?“ Der Greis hebt den Kopf, blickt zu Sürer auf, stutzt und blinzelt in die Sonne. „Warum wollen Sie das wissen?“ Mit dieser Frage hat Udo Sürer nicht gerechnet. In seinem Kopf pocht es, als er für einen Augenblick darüber nachdenkt, ob es nicht besser ist, irgendeinen Grund vorzuschieben, der mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Doch dann sagt er: „Ich bin der Sohn eines SS-Soldaten, der am Massaker von Valla beteiligt war.“ Der Boden unter Sürer scheint zu wanken, während er auf eine Reaktion wartet. Der Greis aber lächelt und sagt: „Ah. Gut, dass Sie gekommen sind!“ Der Name des Alten ist Romolo Guelfi.
An diesem Tag im Jahr 2005 beginnt ein besonderer Annäherungsprozess zwischen den Menschen, die noch heute am kollektiven Trauma des Massakers leiden und dem Nachkommen eines Mannes, der durch seine Mittäterschaft geholfen hat, diese historischen Wunden zu schlagen. Sürer nimmt ab diesem Zeitpunkt regelmäßig an Gedenkveranstaltungen teil. Er erfährt, dass sein Vater insbesondere auch an der nahezu vollständigen Auslöschung des Dorfes Vinca, unweit von San Terenzo-Monti gelegen, beteiligt war. Er lernt noch mehr Zeitzeugen und deren Hinterbliebene kennen, gewinnt unter ihnen enge Freunde, und er wird sogar als Redner auf solche Gedenkfeiern geladen, auf denen er Sätze wie diesen sagt: „Im Gegensatz zu Ihnen habe ich keine nahestehende oder geliebte Person im Krieg verloren. Nur auf einen guten Vater musste ich verzichten. Denn dieser Mann, der, wenn auch verstümmelt, doch immerhin nach Hause zurückkehrte von diesen Massakern, war kein guter Vater. Wie hätte er auch einer sein können?“
Das intensive Nachdenken über diesen Vater beginnt bei Udo Sürer erst so richtig mit der Pubertät. „Über den Krieg, und was er dort erlebt hat, haben wir kaum gesprochen“, erinnert sich Sürer. Wenn doch, dann sei es um Anekdoten gegangen. Eines aber hat der Junge bald gespürt, nämlich, dass sein Vater der nationalsozialistischen Weltordnung trotz der Gräuel des Krieges nachtrauerte. „Er hat jede Woche so ein Blättchen bekommen – ,Deutsche Wochenzeitung’ hieß die, glaube ich.“ Udo Sürer liest die Pamphlete begierig, formt sich zunächst auch selbst ein rechtsnationales Weltbild und sympathisiert als Jugendlicher für kurze Zeit sogar mit der NPD. Es dauert aber nicht lange und der junge Mann wechselt ins politische Lager der SPD von Willy Brandt, was zu Konflikten in der Familie führt.
Zum endgültigen Bruch zwischen den nicht eben unkomplizierten Persönlichkeiten von Vater und Sohn kommt es 1974, als Sürer den Kriegsdienst verweigert: „Ich stand vor der dreiköpfigen Kommission, die in solchen Fällen das Gewissen prüft“, erinnert sich der heute 60-Jährige. Zu seiner Überraschung konfrontieren ihn die Prüfer mit dem Soldatentum des Vaters und verlesen sogar einen Brief, den dieser an die Kommission geschickt hatte. „Darin bezeichnet er den französischen Freund meiner älteren Schwester als ,wehrpolitischen Blindgänger’ und mich als Drückeberger.“ Außerdem wettert der Weltkriegsveteran gegen die Jugend allgemein und dass diese sich nicht entziehen dürfe, wenn es um das Vaterland gehe. Und: „Die Ehre der alten Soldaten darf nicht in den Schmutz gezogen werden!“ Mehr als zehn Jahre wird Sürer mit seinem Vater kein Wort mehr wechseln.
Inzwischen ist aus dem jungen Mann ein Rechtsanwalt geworden. 1988 kehrt er nach Lindau zurück und eröffnet eine Kanzlei. Intensiven Kontakt oder gar eine Aussöhnung mit dem Vater gibt es nicht.
Nach dessen Tod 1992 entdeckt der Jurist ein altes Soldbuch, das seinen Vater als Mitglied der Waffen-SS ausweist: 16.SS-Panzergrenadier-Division „Reichsführer SS“, die 1944 unter anderem für das Massaker von Marzabotto verantwortlich war. Sürer beginnt zögerlich mit Nachforschungen, besorgt sich Literatur über den Partisanenkrieg in den Bergen und stößt auf Bücher von Lokalhistorikern, die das ganze Ausmaß der Gräuel nachzeichnen und auch Belege dafür enthalten, dass sein Vater tatsächlich am 19. August 1944 unter den Soldaten war, die Romolo Guelfis Dorf einkesselten. „Ich muss sagen, dass mich diese Beweise in psychische Ausnahmezustände versetzt haben“, sagt Udo Sürer heute, dem man an Haltung, Mimik und Gestik ansieht, dass sein Leben über viele Klippen und Abgründe geführt hat. Und er weiht seine Geschwister und Halbgeschwister in sein neues Wissen über den Vater ein. Die insgesamt sechs Geschwister reagieren überwiegend positiv, zum Teil verstört oder gar nicht. Sürer ist bis heute überzeugt, dass diese ungefragte und schonungslose Offenheit richtig war: „Ich war und bin der Überzeugung, dass man die Wahrheit aushalten muss.“ Dass genau das schwer ist, hat Sürer am eigenen Leib, oder besser gesagt, an der eigenen Seele erfahren, die über weite Strecken hinweg unter dem historischen Familienerbe gelitten hat und noch immer leidet.
Sürer ist alles andere als das, was man sich gemeinhin unter einem Anwalt vorstellt. Sein Büro besteht aus zusammengewürfelten Möbeln, die nicht chic, sondern zweckmäßig sind. Es befindet sich im Erdgeschoss jenes Reihenhauses in Lindau, in dem schon seine Eltern gelebt haben. Seine Mandanten sind keine wohlhabenden Unternehmer oder wohlsituierte Scheidungsanwärter, sondern in der Mehrzahl Flüchtlinge und Migranten. Also Menschen, die kaum Geld haben und deren Vertretung finanziell betrachtet weniger attraktiv ist.
Zufall? Sürer zuckt mit den Schultern und verneint die Frage, ob er auch mit seinem Beruf etwas wiedergutmachen wolle, was sein Vater verbrochen hat. „Ich glaube nicht an eine Kollektivschuld. Aber ich glaube an eine kollektive Verantwortung“, sagt er. Überhaupt unterscheidet Sürer als Jurist den Begriff der Verantwortung sehr genau von Schuld. Er habe keinen Beweis dafür, dass überhaupt je ein Mensch direkt durch die Hand seines Vaters umgekommen sei. „Aber das spielt auch keine Rolle. Bei einem Banküberfall werden auch alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen, selbst wenn sie nur an der Ecke Schmiere stehen.“
Udo Sürer hat in den zehn Jahren seiner regelmäßigen Besuche in den Orten der Massaker nie Menschen getroffen, die ihn abgelehnt hätten. „Den Betroffenen war es eine Last, mit mir über die Geschehnisse von damals zu sprechen, aber auch eine Erleichterung“, sagt Sürer, der nie – auch nicht bei Überlebenden – um Vergebung für seinen Vater gebeten hat. Warum nicht? Die Antwort gibt der Rechtsanwalt mit einem Auszug einer Rede, die er 2008 in Vinca gehalten hat: „Der erste Grund ist, dass die Grausamkeit der damaligen Ereignisse eine Größenordnung erreicht hatte, die mit einem einfachen Vergebungswort nicht angemessen zu würdigen ist. Der zweite Grund ist, dass eine Vergebung voraussetzt, dass der Schuldige bereit ist, für seine Taten zu bezahlen und dann auch selbst um Vergebung zu bitten. Ein diesbezügliches Bewusstsein habe ich bei meinem Vater nie festgestellt, und jetzt kann man ihn nicht mehr fragen.“
Sürer selbst hat in den vergangenen zehn Jahren viel dafür getan, dass sein persönliches Familienkapitel exemplarisch in die Erinnerungsarbeit vieler Menschen einfließen konnte. 2008 kommen auf seine Initiative hin Zeitzeugen nach Lindau und berichten vom Leid der finsteren Tage. Roberto Oligeri antwortet bei dieser Gelegenheit auf die Frage, wie es nach all dem möglich ist, den Deutschen offen zu begegnen: „Nur, wenn wir uns diese Dinge mitteilen können, ist der Anfang einer Freundschaft möglich, es geht um Mitdenken und Mitleiden und – das Leben ist stärker als der Tod.“ Ein noch größeres Treffen, das Udo Sürer für 2010 geplant hatte, scheitert schließlich an den finanziellen Mitteln.
Dennoch: Offenbar hat die spröde und zutiefst unsentimentale Art des Udo Sürer die Menschen in Italien von seiner Aufrichtigkeit überzeugt. Der Lindauer wird Ehrenmitglied bei den italienischen Partisanen – eine Würdigung, die vor ihm vermutlich noch kein Deutscher erfahren hat, dem „European Resistance Archive“ ist auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ jedenfalls kein weiterer Fall bekannt. Mehr noch: Der Rat der Gemeinde Fivizzano, zu dem San Terenzo-Monti und Vinca inzwischen gehören, hat ihm Anfang Mai die Ehrenbürgerwürde für seine Friedens- und Versöhnungsarbeit verliehen. Nur sehr wenigen Deutschen – zumal Prominenten wie Konrad Adenauer oder Joseph Beuys – ist eine solche Ehre in Italien zuteilgeworden. Eine Ehre, für die sein Vater wohl kein Verständnis gehabt hätte. Denn in dessen Welt galt als ehrlos, wer auf Feinde zuging. Und als Drückeberger, wer lieber reden als schießen wollte. Und als Blindgänger, wer Gewalt ablehnte. Und wie wohl der Satz von Romolo Guelfi in den Ohren des Vaters geklungen hätte? Jener Satz, der Udo Sürer bis heute wie ein Mantra im täglichen Leben begleitet: „Gut, dass Sie gekommen sind!“