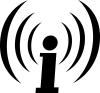Direkt aus dem dpa-Newskanal
Rom/Genf (dpa) - Im Mittelmeer sind nach bisher unbestätigten Informationen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) drei weitere Schiffe mit Flüchtlingen in Seenot geraten.
Dies habe ein Anrufer, der sich angeblich auf einem der Boote befand, berichtet, sagte ein IOM-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auf einem Schiff, das am Sinken sei, befänden sich nach Angaben des Anrufers 300 Menschen, 20 von ihnen seien gestorben.
Der IOM-Sprecher betonte, die Informationen seien noch unbestätigt und an die italienische Küstenwache weitergeleitet worden. Weitere Details, etwa zur Position der Schiffe, konnte er nicht nennen.
Unterdessen schwindet die Hoffnung, nach der verheerenden Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer weitere Überlebende zu finden. "Momentan gibt es nur 24 Leichen, aber nach den schrecklichen Erzählungen (von Überlebenden) scheint es, dass Menschen im Boot eingesperrt waren", sagte der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi dem Radiosender RTL 102,5. Es sei sehr schwer zu ermitteln, was genau passiert sei. Bei dem Unglück am Wochenende vor der libyschen Küste könnten weit mehr als 700 Menschen umgekommen sein.
Die Leichen der 24 Migranten wurden am Montag nach Malta gebracht. Sie sollen obduziert und dann auf dem Inselstaat bestattet werden, wie die Zeitung "Times of Malta" berichtete. An Bord des italienischen Rettungsschiffes "Gregoretti" waren auch Überlebende, die nach Italien gebracht werden sollten. Renzi sagte, Libyen habe sich bereiterklärt, weitere Leichen des Unglücks aufzunehmen, falls sie gefunden werden sollten.
Nach Aussagen eines Überlebenden waren 950 Menschen an Bord des Schiffes, das nach der Abfahrt in Libyen gekentert war. Darunter waren auch viele Kinder. Die italienische Küstenwache teilte mit, 28 Menschen seien gerettet worden. Die Suche nach weiteren Vermissten ging weiter.
Nach Aussagen eines Überlebenden aus Bangladesch, der von der Staatsanwaltschaft in Sizilien befragt worden war, waren viele Menschen im Laderaum eingeschlossen. "Die Schmuggler haben die Türen geschlossen und verhindert, dass sie herauskommen", sagte er laut italienischer Medien.
Wie Europa auf die Situation im Mittelmeer reagieren kann, wollen heute in Luxemburg die EU-Außen- und Innenminister bei einem Krisentreffen besprechen. Die Europäische Union müsse so schnell wie möglich dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen im Mittelmeer umkämen, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier bei seiner Ankunft in Luxemburg. Er warnte aber vor zu großen Erwartungen. "Ganz schnelle Lösungen" werde es sicherlich nicht geben. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin: "Es ist allen in der Bundesregierung klar, dass gehandelt werden muss." Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei tief bestürzt über den Tod der Flüchtlinge.
Der italienische Außenminister Paolo Gentiloni forderte mehr Engagement anderer Länder. "Es ist nicht mehr haltbar, dass man auf einen europäischen Notstand nur mit italienischen Mitteln und Verpflichtungen antwortet." Renzi sagte RTL: "Die Schmuggler sind die neuen Sklavenhändler. Ihnen müssen wir den Krieg erklären."
Einen ersten erfolg gab es in Palermo: Dort zerschlug die Polizei einen internationalen Schleuserring. Die Männer aus Afrika sollen mit großem Gewinn Flüchtlinge in EU-Staaten, darunter auch nach Deutschland, geschleust haben.
Wenige Meter vor der Küste der griechischen Touristeninsel Rhodos lief derweil ein Flüchtlingsschiff auf Grund. Medienberichten zufolge starben mindestens drei Menschen, darunter ein vierjähriges Kind. Nach Angaben der Küstenwache wurden 80 Menschen gerettet. Wie viele Migranten insgesamt an Bord waren, war demnach zunächst unklar. Über die Ägäis versuchen Schleuserbanden, Migranten und Flüchtlinge von der türkischen Küste nach Westeuropa zu bringen.
Nach Angaben der italienischen Justiz warten in Libyen bis zu eine Million Flüchtlinge auf die Überfahrt nach Europa. Dies gehe aus den ihnen vorliegenden Daten hervor, sagte Maurizio Scalia von der Staatsanwaltschaft in Palermo. Die Migranten kämen vor allem aus Syrien und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara.