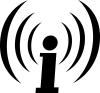Dresden. Weiße Wände, zwei graue Bettgestelle mit dünnen Matratzen, zwei hohe Schränke, ein kleiner Fernseher - das Zimmer, in dem Khaled gewohnt hat, wirkt karg. Auf dem Bett, in dem der 20-jährige Flüchtling aus Eritrea bis vor wenigen Tagen schlief, sitzen mehrere junge Männer, unterhalten sich leise. Seitdem ihr Freund und Mitbewohner am 13. Januar erstochen im Hinterhof der Dresdner Plattenbausiedlung gefunden wurde, nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt, haben sie Angst.
„Es ist hier zu gefährlich“, sagt am Mittwoch Hbdelwahab, einer von
sieben Mitbewohnern, die zuletzt mit Khaled zusammenlebten. Gemeinsam
mit anderen berichtet er von Pöbeleien und Angriffen in den vergangenen
Wochen, einer wurde angespuckt, der 27-Jährige Walid vor wenigen Tagen
von einer Gruppe junger Männer mit heißer Flüssigkeit aus einer
Thermoskanne übergossen. Auf die Eingangstür der Vierzimmerwohnung im
Stadtteil Leubnitz-Neuostra haben Unbekannte ein Hakenkreuz gemalt. Das
wurde mittlerweile entfernt. Dagegen ist das Loch noch gut zu sehen, als
jemand gegen die Tür trat.
Die jungen Männer fürchten wegen
dieser Erfahrungen, dass auch der gewaltsame Tod von Khaled eine
rassistische Tat gewesen sein könnte. Hintergründe und Motiv seien
weiter unklar, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.
Die Ermittlungen wegen Totschlags gegen unbekannt laufen. Die Behörden
ermitteln in alle Richtungen. Politiker hatten vor Spekulationen gewarnt
und appelliert, die Ergebnisse der Untersuchungen abzuwarten. Die
Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass an der Leiche keine Hinweise auf
Fremdeinwirkung festgestellt worden seien. Erst die Obduktion ergab,
dass der Mann durch Messerstiche in Hals und Brust getötet worden war.
In
den nächsten Tagen wollen die Flüchtlinge in der Wohnung bleiben, um
das Geschehene zu verarbeiten, zu trauern. Aber wenn die Männer aus dem
nordostafrikanischen Eritrea an ihre Zukunft denken, wollen sie nur
eins: weg. Nicht nur raus aus dem grauen Plattenbauviertel, sondern raus
aus Dresden. Weil es in anderen Stadtteilen ähnlich sei, sagen sie.
„Viele Leute in Dresden mögen uns nicht.“ Mit einem dringenden Hilferuf
haben sich die jungen Asylbewerber an Stadt, Politik, Polizei und Bürger
gewandt. „Wir brauchen schnelle Hilfe“, heißt es in dem am Mittwoch
veröffentlichten Schreiben. Die Männer beklagen, dass es kaum Austausch
mit Dresdnern oder Initiativen gibt, zudem sei es für Flüchtlinge
schwierig, Sprache und Kultur kennenzulernen. „Weil wir in einer
Umgebung leben, in der niemand mit uns sprechen will.“
Seitdem
jeden Montag Pegida-Anhänger durch die Straßen ziehen, fühlen sie sich
noch unsicherer als vorher. Auch der Ausländerrat Dresden berichtet von
Musliminnen, die sich mit Kopftuch kaum noch auf die Straße trauen. Der
Sächsische Flüchtlingsrat bestätigt, dass manche Ausländer Angst in der
Stadt hätten. Am vergangenen Wochenende erinnerten in Dresden Tausende
bei einem mehrstündigen Marsch an den getöteten Asylbewerber, darunter
viele Freunde von Khaled. Seitdem der 20-Jährige tot aufgefunden
wurde, betreuen Sozialarbeiter der Stadt und der Arbeiterwohlfahrt seine
sieben Mitbewohner verstärkt. „Wir sind mit den Flüchtlingen im
Gespräch und werden uns gemeinsam mit ihnen über das weitere Verfahren
abstimmen“, sagte Stadtsprecher Kai Schulz auf Anfrage. Auch vorher
kümmerte sich ein Sozialarbeiter um die jungen Männer - genügend Zeit
blieb allerdings kaum. Nach Angaben der Stadt kommt auf rund 200
Asylbewerber im Schnitt ein Sozialarbeiter.
Khaled schaffte,
wovon viele seiner Landsleute träumen: Er flüchtete aus Eritrea über den
Sudan nach Libyen, gelangte auf einem Flüchtlingsschiff nach Italien,
kam später nach Deutschland. Sein Bruder, der auf einem anderen Schiff
die Überfahrt wagte, kam dabei ums Leben. Seit September lebte Khaled in
Dresden. Sein Mitbewohner Hbdelwahab beschreibt ihn als bescheiden,
unauffällig und freundlich. Khaled habe gern Fußball gespielt und davon
geträumt, hier zu studieren. Seine Freunde und Mitbewohner sind sich
einig: „Wir wünschen uns einfach eine Chance, hier Fuß fassen zu können,
uns zu bilden und hier zu arbeiten.“