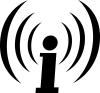Die Kundgebungen gegen den neuen Antisemitismus sind ungewöhnlich für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Selten setzten sie auf öffentlichen Protest. Die Straße jetzt zu mobilisieren, hat gute Gründe.
Es passiert nicht oft, dass Deutschland - wie am vergangenen Sonntag - eine von der jüdischen Gemeinschaft organisierte Demonstration erlebt. Über Jahrhunderte zogen es jüdische Institutionen vor, hinter der Bühne zu agieren und sich auf den Schutz der staatlichen Autoritäten zu verlassen. Dies hat gute Tradition. Der Historiker Yosef Hayim Yerushalmi sprach in diesem Zusammenhang von der „vertikalen Allianz“. Bereits im Mittelalter unterstanden die Juden dem Schutz der höchsten Autorität: des Kaisers. Sie waren stolz darauf und sprachen davon, nicht wie die Bauern der Umgebung „Diener von Dienern, sondern Diener von Herren“ zu sein. Doch der Schutz durch den hohen Herrn war nur dann von Nutzen, wenn des Kaisers Gewalt vor Ort wirkte. Dies war weder im Mittelalter noch in der Neuzeit immer der Fall. Oft waren es die Instanzen der näheren Umgebung, die über das Schicksal der Juden befanden. Ihr Urteil fiel oft weniger günstig aus.
Auch im Nachkriegsdeutschland beruhte die deutsch-jüdische Existenz lange Zeit auf dem Prinzip der vertikalen Allianz. Es waren die Bundespräsidenten und Kanzler, die Kardinäle und Landesbischöfe, die im Interesse der Nation und der Kirchen auch das jüdische Leben in Deutschland garantierten. Vor der Straße dagegen hatte man nach den Jahren der Naziverfolgung noch mehr Angst als zuvor. Die Regierung konnte man nach 1945 auswechseln, doch wer wusste, wie lange es dauern würde, bis die Umerziehung der Menschen nach den Jahren der Diktatur wirkte? So war es die Politik jüdischer Institutionen, die Sicherheit ihrer Mitglieder von den obersten Instanzen garantieren zu lassen. Hinter verschlossenen Türen konnte man ungestört den Antisemitismus verdammen und Staatsverträge schließen.
Es gab wenige Ausnahmen. So etwa ein jüdischer Protest am 10. August 1949 in München gegen die „Süddeutsche Zeitung“. Das Blatt hatte den Leserbrief eines gewissen „Adolf Bleibtreu“ publiziert, der loswerden musste, was ihm „der Ami“, bei dem er beschäftigt sei, über die Juden gesagt habe: das Bedauern darüber, „dass wir nicht alle vergast haben, denn jetzt beglücken sie Amerika“.
Die Wut der jüdischen Volksseele
Eine solche anonyme Zuschrift zu veröffentlichen, gerade einmal vier Jahre nachdem die Gaskammern ihren Betrieb eingestellt hatten, ließ die Emotionen hochkochen. Die gewaltsame Demonstration, bei der Pflastersteine flogen und die Polizei Schlagstöcke einsetzte, machte deutlich, wie viel angestaute Aggression es zwischen den in Deutschland wohnenden Holocaust-Überlebenden und der deutschen Bevölkerung nach 1945 noch gab.
Nur noch einmal in jenen frühen Jahren entlud sich der Zorn der jüdischen Bevölkerung über deutschen Antisemitismus in Straßenprotesten. Nach dem Freispruch für Veit Harlan durch ein Schwurgericht gingen Anfang der fünfziger Jahre zahlreiche Mitglieder jüdischer Gemeinden auf die Straße. Sie wollten sich mit dem Urteil gegen den Regisseur des antisemitischen Hetzfilms „Jud Süß“ nicht abfinden, das Harlan zugebilligt hatte, sich im Befehlsnotstand gegenüber Goebbels befunden zu haben.
Dann verstummten die Straßenproteste. In dem Maße, in dem sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland etablierte und ihre Kontakte zur politischen Führung ausbaute, setzten ihre führenden Vertreter vor allem auf diplomatische Kanäle. Der langjährige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Werner Nachmann, spielte die Empörung in seinen Gemeinden immer wieder herunter, auch wenn in der jüdischen Volksseele Wut über die Karrieren ehemaliger Nationalsozialisten oder den Erfolg neuer Nazis kochte. Als viele jüdische Gemeindefunktionäre offensiv mit der NS-Verstrickung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger umgehen wollten, nahm Nachmann diesen in Schutz.
Protest unter Freunden
Es sollte mehr als drei Jahrzehnte dauern, bis Juden wieder öffentlich protestierten. In den achtziger Jahren war eine Generation bereits im Nachkriegsdeutschland geborener Juden herangewachsen. Sie vertraute auf die Institutionen der Bundesrepublik und war mit deren demokratischen Strukturen so weit verwachsen, dass sie sich nicht scheute, Bürgerproteste zu initiieren. Als 1985 das Theaterstück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ von Rainer Werner Fassbinder im Frankfurter Schauspielhaus aufgeführt werden sollte, besetzten Mitglieder der jüdischen Gemeinde, unter ihnen der spätere Zentralratsvorsitzende Ignatz Bubis und zahlreiche Angehörige der jüngeren Generation, die Bühne. Bereits einige Monate zuvor hatten jüdische Studentenverbände Demonstrationen gegen den Besuch von Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl auf einem Friedhof mit Waffen-SS-Gräbern in Bitburg organisiert.
In den fast dreißig Jahren seither meldeten sich jüdische Vertreter zwar stärker in der Öffentlichkeit zu Wort, doch organisierte Straßenproteste oder Bühnenbesetzungen waren nicht mehr angesagt. Es bedurfte schon der offen antisemitischen Sprechchöre im Rahmen von Kundgebungen gegen Israel, versuchter Anschläge auf Synagogen und gewalttätiger Überfälle auf jüdische Bürger, um die jüdische Gemeinschaft jetzt wieder auf die Straße zu holen.
Dabei blieb man allerdings weitgehend unter Freunden und seinesgleichen. Von einem Aufstand der Massen, wie vor Jahren bei den Lichterketten, konnte keine Rede sein. Dabei war aber die Elite der Gesellschaft. Auf dem Podium versammelt waren Bundeskanzlerin, Bundespräsident, Kardinäle und andere Amts- und Würdenträger. Die vertikale Allianz funktionierte wieder einmal prima, auch auf der Straße. Die Straße selbst aber zu mobilisieren - dies wird die wichtigste Herausforderung im Kampf gegen den neuen Antisemitismus bleiben.