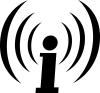Anwohner wollten eine Initiative gründen, um über die Probleme in dem Park zu sprechen. Sie müssten zunächst über die Ursachen dafür nachdenken, so ein Kritiker.
taz: Herr Müller, am Dienstagabend wollte sich eine Anwohnerinitiative für den Görlitzer Park gründen. Sie haben mit anderen die Veranstaltung, zu der rund 60 Menschen gekommen waren, eskaliert. Warum?
Rafael Müller*: Ich habe die Veranstaltung nicht gesprengt. Viele, die da waren, hat der Aufruf der Initiative geärgert. Auch, wenn sich die Gruppe von Rassismus distanziert, reproduziert sie alle üblichen Ressentiments. Nämlich: Die Schwarzen verkaufen unseren Kindern Drogen. Die sind laut, die sind dreckig. Sie fassen unsere Frauen an. Das wird dann grün-alternativ „Sexismus“ genannt. Auf die Ursachen, warum gerade Geflüchtete aus Afrika im Park Drogen verkaufen, wird dabei gar nicht geguckt. Sie dürfen schließlich nicht arbeiten und haben keine andere Möglichkeit, als Flaschen zu sammeln oder Gras zu verkaufen.
Auf der Homepage der Initiative steht ausdrücklich, dass sie niemanden vertreiben, sondern neben dem Drogenhandel auch Flohmärkte und Feste organisieren wollen. Was ist daran schlecht?
An Flohmärkten ist nichts auszusetzen. Auf ihrer Internetseite sagen sie aber auch, dass sie die Initiative des Bezirks begrüßen. Die zeigt sich in erster Linie in einer Zunahme der Polizei- und Ordnungsamtskontrollen. Das schafft Stress, Angst und Aggression. Die Zunahme der Aggression will die Initiative ja gerade bekämpfen, insofern ist es widersinnig, den Bezirk für die Kontrollen zu loben.
Die Initiative konnte ihre Pläne gar nicht vorstellen, sondern wurde sofort niedergeschrien. Sollte man nicht miteinander sprechen statt sich mundtot zu machen?
Die Frage ist, wer hier wen mundtot macht. Wenn man wirklich Veränderung schaffen möchte, sollte man sich zu den Ursachen des Handels wie dem Arbeitsverbot zumindest positionieren.
Sie meinen, die Anwohner hätten zunächst ihre Solidarität mit dem Protest der Flüchtlinge zum Ausdruck bringen sollen?
Ja. Das wäre eine ganz andere Gesprächsgrundlage gewesen. Ich vermisse bei denen Solidarität und Empathie.
31, heißt eigentlich anders. Er wohnt am Görlitzer Park und unterstützt die Flüchtlinge
Es ist nun aber so, dass Leute zunehmend genervt sind von den Spalieren an den Parkeingängen und dem Handel. Wenn man sich anschreit, statt miteinander zu reden, dann verfestigen sich die Fronten doch nur.
Sicher. Ich selbst habe niemanden niedergeschrien. Bei anderen drückt sich da der Frust aus, weil sie von systematischer Diskriminierung betroffen sind, weil sie nicht genug Kohle verdienen, um sich abends was zu essen zu leisten.
Sie sprechen von Flüchtlingen aus der Schule, die auch bei der Veranstaltung waren?
Die werde ich jetzt sicher nicht kritisieren. Viele, die im Park Drogen verkaufen, würden sofort jeden anderen Job nehmen. Die machen das nicht gerne, es ist teilweise nicht mit ihrer Religion zu vereinbaren. Sie würden sich einen anderen Kontakt zu den Anwohnern wünschen. Den gibt es auch, etwa wenn Nachbarn und Geflüchtete wie für diesen Samstag gemeinsam eine Demo organisieren.
Wie könnte man mehr Empathie schaffen?
Man muss sich in die Leute reinversetzen: Was macht es mit Menschen, wenn sie ohne Perspektive, ohne Versicherung, ohne Versorgung leben, mit 15 Leuten in einem Raum schlafen, von denen ein Teil traumatisiert ist? Dann gehen sie raus und sehen andere, die frisch geduscht aus ihren Häusern kommen und zu ihrem Job radeln. Da baut sich Frust auf. Deshalb ist ein Dialog wichtig. Und dafür braucht man Empathie. Die erwarte ich in erster Linie von der Mehrheitsgesellschaft. Und nicht von denen, die von den Privilegien ausgeschlossen sind.
Zu einem Dialog gehört aber, dass man die Interessen beider Seiten ernst nimmt – also auch die der genervten Anwohner.
Sicher muss man auch die Interessen der Anwohner ernst nehmen. Die Flüchtlinge sind aber auch Anwohner. Und gemessen daran, dass sie nicht arbeiten und nicht reisen dürfen, jederzeit damit rechnen müssen, von der Polizei mitgenommen zu werden – da hat das Bedürfnis der anderen Anwohner, nicht durch Spaliere laufen zu wollen, einfach weniger Gewicht.
INTERVIEW ANTJE LANG-LENDORFF