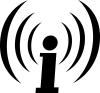Mit Asylbewerberheimen ist es ähnlich wie mit Windrädern: Viele wollen sie, nur nicht in der eigenen Nachbarschaft. Dasselbe gilt für Sozialwohnungen, wie eine Kölner Lokalposse illustriert. Dort wünschen sich ehrenwerte Bürger die Stadtmauer zurück, damit die Flodders ante portas bleiben. Und ein Adenauer-Enkel will das Prekariat am liebsten entlang der Bahndämme ansiedeln, damit die "guten Viertel" rein bleiben. Von Hans D. Rieveler.
Der verstärkte Zustrom von Asylbewerbern und die Reaktionen der Bevölkerung darauf sind derzeit ein beliebtes Thema. Dabei drängt sich der Eindruck auf, dass es mit der vielbeschworenen Willkommenskultur nicht allzu weit her ist. Willkommen oder zumindest egal sind Flüchtlinge für viele offenbar nur, solange sie nicht ins eigene Viertel ziehen.
In einer Umfrage für das Fernsehmagazin "Kontraste" gaben 35 Prozent der Befragten an, "ein großes bis sehr großes Problem damit" zu haben, wenn in ihrer Nachbarschaft ein Asylbewerberheim eröffnet werden sollte. Am Ende des Infotextes dazu heißt es:
Interessant: Es sind nicht, wie man annehmen könnte, vor allem sozial schwache Bürger, die Ressentiments haben: Von denjenigen, die weniger als 1500,- Euro monatlich verdienen, lehnen zwar 34 Prozent Asylbewerber in ihrer Nähe ab. Von denen aber, die mehr als 3000 Euro pro Monat verdienen, haben 40 Prozent große Probleme mit Asylbewerbern.
Interessant ist vor allem, dass "man" gemeinhin annimmt, Fremdenfeindlichkeit würde mit steigendem Einkommen abnehmen.
Tatsächlich scheint es kaum einen Ort zu geben, an dem die Ansiedlung eines Asylbewerberheims ohne Proteste vonstatten geht. Nicht nur in Hellersdorf, auch in beschaulichen Städtchen wie dem schwäbischen Sachsenheim, Isny im Allgäu oder Schneeberg im Erzgebirge rüsten sich Wutbürger gegen den Flüchtlingszustrom. Doch in den überregionalen Medien, abgesehen von der taz, ist davon nur wenig wahrzunehmen.
Wer nach "Asylbewerber Gegner" googelt, findet noch immer mehr Treffer für den Berliner "Problembezirk" Marzahn-Hellersdorf als für den Rest der Republik. Wie ist das zu erklären? Eine mögliche Antwort liefert ein ZEIT-Artikel: "Das Wort Asylbewerberheim reimt sich seit 1992 auf Lichtenhagen, auf steinewerfende Neonazis und johlende Zuschauer. Und der Schauplatz, an dem man sich so etwas ausmalt, sieht immer aus wie Hellersdorf ...".
Wieder dieses verräterische "man". "Man", das sind sicher nicht nur Journalisten. Denn die Prämisse, dass dumpfe Vorurteile nur dort zu Hause sind, wo der Pöbel wohnt, erspart es den Wutbürgern allerorten, über ihre eigenen Ressentiments zu reflektieren. Unabdingbar ist es nur, in der öffentlichen Auseinandersetzung die Regeln der Political Correctness einzuhalten.
In den "bürgerlichen" Vierteln sammelt man Unterschriften, gründet Bürgerinitiativen und nimmt sich einen Anwalt. Neben der Sorge um das Wohlergehen der Asylbewerber, die in ihren Heimen beengte Wohnverhältnisse oder Straßenlärm ertragen müssten, wird gerne die Parkplatzsituation oder der Verlust von Grünflächen und Spielplätzen thematisiert. Viel hilft viel, was die Argumente betrifft. Es gilt nur peinlichst darauf zu achten, den Migrationshintergrund der ungeliebten Zuzügler nicht allzu sehr in den Vordergrund zu rücken. So verliert "man" nicht das Verständnis der Lokalpolitiker, die landauf, landab Verständnis für die Sorgen und Nöte der Anwohner von Flüchtlingsheimen äußern.
Ganz ähnliche Sorgen hat "man" in Köln. Dort spielt sich derzeit eine Lokalposse ab, die außerhalb der Domstadt bislang kaum Beachtung gefunden hat. Doch lohnt ein Blick darauf, weil sie symptomatisch ist für einen deutlich breiter angelegten sozialen Konflikt. Zeigt die Debatte in Köln doch, dass Fremdenfeindlichkeit nicht nur gegen Migranten, sondern auch gegen Biodeutsche gerichtet sein kann.
Bewohner von Sozialwohnungen würden sich in einem Kölner Villenviertel sowieso nur "deklassiert" fühlen
Es begann im Sommer dieses Jahres, als die Stadtverwaltung diverse Ideen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Diskussion stellte. Kritik ziehen besonders die Pläne auf sich, die auf eine stärkere soziale Durchmischung der Stadt abzielen. So sollen etwa Bauherren, die Wohnungen in besonders teuren Vierteln wie Lindenthal, Sülz, Marienburg, Junkersdorf oder Hahnwald errichten, pro Wohnung eine Prämie von 10.000 Euro erhalten. "Der wichtigste Beitrag zum sozialen Frieden ist die Mischung unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen und Schichten in den Vierteln", sagte Oberbürgermeister Jürgen Roters (SPD) dazu dem Kölner Stadt-Anzeiger.
Darum ist es in seiner Stadt nicht gut bestellt. In keiner der 15 größten deutschen Städte ist die soziale Segregation, das heißt die räumliche Trennung von Arm und Reich, stärker ausgeprägt als in Köln, wie der Stadtsoziologe Jürgen Friedrichs in einer Studie "Gespaltene Städte: Soziale und ethnische Segregation in deutschen Großstädten" ermittelt hat. Die ethnische Segregation ist dagegen vergleichsweise gering.
Doch manche finden das ganz gut so. Roters schärfste Widersacher sind der Vorsitzende des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins, Konrad Adenauer, ein Enkel des gleichnamigen ersten Bundeskanzlers, sowie Thomas Tewes, der Geschäftsführer des Vereins. Vor kurzem noch erklärte Tewes, in Köln gebe es keine Wohnungsnot und die Mieten seien hier vergleichsweise günstig. Tatsächlich gibt es laut Mietspiegelindex mit München und Stuttgart nur zwei teurere Großstädte in Deutschland. Den rund 270.000 Haushalten mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein stehen in der Domstadt nur 41.600 öffentlich geförderte Wohnungen gegenüber.
Jetzt sagte Tewes dem Kölner Stadt-Anzeiger: "Wir sind nicht gegen sozialen Wohnungsbau, aber das Baulandmodell verschreckt Investoren." Das kooperative Baulandmodell sieht vor, dass Bauherren 30 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen errichten müssen. Adenauer ergänzte, es sei niemandem damit gedient, wenn in Marienburg – einem Villenviertel im Kölner Süden – Sozialwohnungen gebaut würden, da die Bewohner von Sozialwohnungen sich dort "deklassiert fühlen" würden.
Doch Tewes und Adenauer kritisieren nicht nur, sie haben auch einen Alternativvorschlag: Entlang der Bahndämme in der Stadt gebe es noch viele freie Flächen, die bislang aufgrund von Lärmschutzauflagen nicht genutzt werden konnten. Heutzutage gebe es ja "sehr gute Lärmschutzmaßnahmen", meint Adenauer.
Der Kanzler-Enkel kämpft derweil auch an der Basis für seine Ziele. Im gutbürgerlichen Lindenthal haben die in einer Bürgerinitiative organisierten Anwohner in ihm einen prominenten Fürsprecher. Die nahe des Stadtwalds geplanten Einfamilienhäuser sind Adenauer zu klein, die Mehrfamilienhäuser zu groß. Mit den Aussagen "Das passt hier nicht hin" und "Lindenthal sei 'gemischt genug'" zitiert ihn der Stadt-Anzeiger. Köln brauche "für seine Entwicklung gute Wohngegenden".
Eine eigenwillige Interpretation. In Lindenthal liegt der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen unter 2 Prozent, in Chorweiler, einer Plattenbausiedlung im Kölner Norden, bei über 80 Prozent. In einem Beitrag des Fernsehmagazins Panorama erklärte Adenauer: "Es ist ein Villenviertel hier, und kein Industrieviertel."
Die Gegner der sozialen Durchmischung in Köln sind ebenso wie die Gegner von Asylbewerberheimen anderswo ähnlich flexibel in ihrer Argumentation. Und sie sind vorgeblich ebenso besorgt um das Wohlergehen der Menschen, denen sie gerne eine Unterkunft bieten möchten, nur möglichst nicht im eigenen Wohnumfeld. Im Hannoveraner Stadtteil Bothfeld, wo es gegen ein Asylbewerberheim geht, sagte einer der Wortführer: "Zu große Nähe kann auch Distanz mit sich bringen." Adenauer und Tewes hätten es nicht besser ausdrücken können.
"Blast dem Prekariat Zucker in den Hintern"
Auch in Köln stehen die beiden mit ihrer Meinung nicht allein. An einer Online-Umfrage des Stadt-Anzeigers zu diesem Thema haben sich mittlerweile mehr als 7.000 Menschen beteiligt. 57 Prozent befürworten eine stärkere soziale Durchmischung der Stadt, 41 Prozent wollen den Status quo erhalten, da Köln "auch gute Gegenden" brauche.
Wie letztere ticken, lässt sich den Leserkommentaren in der Lokalpresse entnehmen. Mieter von Sozialwohnungen "fahren in der Regel mehrere Autos – die können sie sich ja aufgrund der geringen Miete leisten. Leidtragende sind die alteingesessenen Anwohner", heißt es dort.
Auch Adenauers Argument, die soziale Spaltung in Arm und Reich sei schon okay, solange die Armen nichts davon merken, wird aufgegriffen: "Leid tun mir dann die Sozialwohnungsbewohner, denen ein Reichtum vorgeführt wird, der sie selbst nur unzufrieden machen kann." Andere flüchten sich in Ironie: "Klaar, hofiert den sozialen Bodensatz, blast dem Prekariat Zucker in den Hintern" oder apokalyptische Visionen: "Die irren Politverbrecher wollen Deutschland eben einfach brennen sehen! Hoffentlich werden sie dann auch von den Flammen nicht verschont!" Wieder andere wünschen sich das Mittelalter zurück: "Warum gab es nochmal Burgen und Stadtmauern? Den Kommunismus vor Augen, in den Untergang." Ja, einige drohen sogar mit Wegzug in die Kölner Feindstadt Düsseldorf.
Doch es soll auch nicht verschwiegen werden, dass selbst führende Vertreter der Kölner CDU Adenauers Vorstellungen als rückwärtsgewandt bezeichneten. So meldete sich der Kölner SPD-Vorsitzende Jochen Ott zu Wort. In seinem Brandbrief macht er am Rande auf ein anderes, doch verwandtes Problem aufmerksam: Asylbewerberheime werden vorzugsweise in ärmeren Stadtteilen errichtet, die damit an die Grenzen ihrer "Integrationsfähigkeit" gebracht würden.
Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb "man" fälschlicherweise annimmt, ärmere Menschen würden sich in stärkerem Maße gegen Asylbewerber wenden: Sie begegnen ihnen täglich in ihrem Wohnumfeld, während die Bewohner der "guten" Viertel sie meist nur aus dem Fernsehen kennen. Was aber bedeuten würde, dass "man" entweder davon ausgeht, die Bewohner der "schlechten" Viertel seien per se rassistisch veranlagt oder aber, sie könnten möglicherweise gute Gründe für ihre ablehnende Haltung haben. So wie so mancher Bewohner der "besseren" Viertel glaubt, gute Gründe gegen Sozialwohnungen in seiner Nachbarschaft zu haben. Doch ist es stets bequemer, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als sich den eigenen Ressentiments zu stellen.