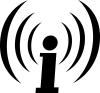Knapp ein Jahr nach ihrem Tod ist das letzte Buch der Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich erschienen. Das Thema der Nazi-Vergangenheit und ihrer Verdrängung durch die Deutschen ist darin zentral. Von Detlef zum Winkel.
Den erstaunlichen Titel Eine Liebe zu sich selbst, die glücklich macht hat Margarete Mitscherlich, wie die Herausgeberin Karola Brede in einer Nachbemerkung berichtet, selbst gewählt. Die Autorin nahm auch die Auswahl der Texte vor, die großenteils schon an anderer Stelle publiziert waren, wo sie aber keine größere Öffentlichkeit erreichten. Zur Erläuterung des Titels hatte sie einen zusätzlichen zusammenfassenden Text geplant, den sie nicht mehr realisieren konnte. So bleibt es den Leserinnen und Lesern überlassen, den Sinn der Überschrift zu entschlüsseln oder sich zu eigenen Gedanken darüber inspirieren zu lassen.
Das Buch ist hier und dort besprochen worden, am ausführlichsten und besten von Anja Hirsch für den WDR. Auch konservative Medien würdigten noch einmal die im Juni 2012 verstorbene »Grande Dame der Psychoanalyse in Deutschland«, wobei sie gelegentlich anklingen ließen, manches sei doch arg überholt, etwa daß der Mann die Frau untergründig hasse und zu unterwerfen versuche. Solchen Meinungen wollte Margarete Mitscherlich offensichtlich noch einmal deutlich widersprechen. Sie geht das Thema historisch, psychoanalytisch, politisch an und setzt sich auch mit Mißverständnissen bei der Rezeption ihres früheren Buchs Die friedfertige Frau auseinander. Frauen seien keine besseren Menschen. Vielmehr gehörten Friedfertigkeit, Hingabe, Unterwerfung, Opferbereitschaft zu dem jahrtausendealten System von Werten und Normen, das das Patriarchat zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft geschaffen hat. In diesem System werde von Frauen nicht erwartet, daß sie die Männer am Kriegführen hindern, sondern daß sie für ein harmonisches Familienleben sorgen, die Krieger anhimmeln und ihnen den Rücken stärken. Ebensowenig akzeptiert Mitscherlich die männlichen Werte wie Stärke, Leistung, Durchsetzungsvermögen, Rationalität und Erfolg um ihrer selbst willen: »Diese ›Werte‹ unterstützen das narzißtische Männlichkeitsgehabe, hinter dem die Impotenzangst des Mannes lauert.«
Was unter »männlich« und »weiblich« verstanden werde, habe nichts mit biologischen Gegebenheiten zu tun, sondern sei historisch bedingt und veränderlich. In dieser Hinsicht distanziert sich Mitscherlich von Teilen der Frauenbewegung und deren Berufung auf Sigmund Freud. Ebenso kritisiert sie die Zurückhaltung und Angst von Frauen gegenüber der Einnahme von Machtpositionen, hält nichts von linken, basisdemokratischen Begründungen für diese Scheu und ist da ganz Realpolitikerin. »Ich behaupte immer, ich war von Geburt an Feministin«, schreibt sie, wobei man, wie bei vielen ihrer Äußerungen, Ironie und Selbstironie nicht überhören sollte. Für schulterklopfende Vereinnahmungsversuche (»unsere Grande Dame«) eignet sich das schlecht.
Solche Denkansätze galten in der Linken bis weit in die Siebziger des letzten Jahrhunderts als subjektivistisch oder psychologistisch, also unpolitisch. Wie viele Kontroversen wurden, wenn es ans Eingemachte ging, mit dem Spruch »Jetzt werd’ mal nicht psychologisch« beendet! Dabei ist Mitscherlichs Verständnis von Psychoanalyse immer politischer Natur. Individuelle psychische Störungen und Erkrankungen setzt die Autorin durchweg in Beziehung zu gesellschaftlichen Entwicklungen, historischen Gegebenheiten, politischen Verhältnissen. Wie das konkret aussieht, findet sich exemplarisch in dem kurzen Text »Gretchen gestern und heute« über Margaretha Brandt, die sogenannte Kindsmörderin, die 1772 in Frankfurt öffentlich hingerichtet wurde und die Goethe als Vorlage für seine Gretchen-Figur in Faust diente. Der Text ist nicht nur brillantes Sittengemälde einer dumpfdeutschen Männerkommune, die zur Zeit der Aufklärung noch dem tiefsten Mittelalter verhaftet ist, sondern auch eine flammende Anklage der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen die niederen Stände leben mußten. Um einen Bezug zur Gegenwart herzustellen, behandelt Mitscherlich den Fall einer 15jährigen Türkin, die 1994 heimlich ein Kind zur Welt brachte und es in seelischer Not aus Angst vor der »Schande« und der »Entehrung der Familie« aus dem Fenster warf. Heute gebe es zwar keine Todesstrafe mehr, trotzdem habe auch dieser Richter ein abstoßendes Beispiel für fehlendes Mitgefühl, Rassismus und Frauenverachtung gegeben, als er einen Antrag der Verteidigung auf psychologische Betreuung mit den Worten kommentierte: »Wir können nicht jedem Türken eine Therapie bezahlen.«
Männern gehe es da besser, stellt Mitscherlich fest und verweist auf ein Urteil des Landgerichts Mannheim 1992 gegen den aus Weinheim stammenden Nazi Günter Deckert. »Mehr Einfühlung, als ihm von seinen Richtern zuteil wurde, kann sich niemand wünschen.« Im gleichen Atemzug mit seiner Verurteilung wurde Deckert nämlich bescheinigt, daß sein Bekenntnis zu rassistischen Ansichten »im Grunde Ausdruck einer charakterstarken, verantwortungsbewußten Persönlichkeit mit klaren Grundsätzen sei. Deutlicher kann sich wohl kaum ein Richter für die ›moralische‹ Berechtigung des Antisemitismus – und damit auch für deren Folge: den Holocaust – aussprechen.« Die Mannheimer Richter würden sich von jenen Frankfurter Kollegen, die Margaretha Brandt hinrichten ließen, im wesentlichen kaum unterscheiden. »Einfühlung gibt es für Täter, niemals für die Opfer.« Für Mitscherlich gehen Frauenverachtung und Rassismus immer Hand in Hand. Übrigens ist Deckert nicht irgendeine Figur, die irgendwann mal Schlagzeilen gemacht hat, sondern einer der Ziehväter der heutigen Nazi-Szene und unermüdlich in Thüringen und Sachsen unterwegs.
Das Thema der Nazi-Vergangenheit und ihrer Verdrängung durch die Deutschen zieht sich durch das ganze Buch. Es gibt hier keine Altersmilde der über 90jährigen Autorin und auch keine Ermüdung der Argumente. Sie hat die Überlegungen aus dem mit Alexander Mitscherlich gemeinsam verfaßten Buch Die Unfähigkeit zu trauern wieder aufgenommen und versucht, sie auf die schockierende Sympathie für rechte oder rechtsradikale Ideen in Ostdeutschland anzuwenden. Auch in diesem Kontext gibt sie Erläuterungen und bemüht sich, Mißverständnisse auszuräumen. Das Psychoanalytikerpaar hat 20 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus konstatiert, daß die Deutschen in ihrer großen Mehrheit Hitler verehrt und geliebt hätten, und gefragt, wieso dann eigentlich niemand um ihn trauern würde. Das wurde (und wird) von vielen als provozierende Forderung verstanden, Hitler nachzutrauern und den Verlust einer Person als schmerzlich zu empfinden, die man gerade als Bestie ausgemacht hat. Deshalb weist die Autorin darauf hin, daß es ihrem Mann und ihr um »eine deutsche Art zu lieben« gegangen sei. Der Deutsche könne nur lieben, wen er idealisiert, aber nicht jemanden, der real ist, Vorzüge und Nachteile, Schwächen und Charme hat und übrigens auch älter wird. Da er sich selbst schlecht mit dem Helden und Übermenschen identifizieren kann, den er allein für liebenswert hält, projiziert er die gewünschten Eigenschaften auf eine über allen stehende Führerfigur, deren angeblicher Glanz ihm als getreuem Anhänger und Verehrer ein wenig Selbstachtung übertragen soll. So kann er sich als »Herrenrasse« fühlen, symbolisiert im Führer, und wird befähigt, alle, die diese Konstruktion anzweifeln, stören, bedrohen oder einfach nicht dazugehören, gnadenlos zu verfolgen und zu vernichten. Die Unfähigkeit zu trauern meine, daß sich die Deutschen der Frage, wie das geschehen konnte, nicht oder höchstens oberflächlich gestellt hätten. Das gelte im Grunde immer noch. Als Beispiel nennt Mitscherlich Äußerungen von Helmut Schmidt über »die anständige Wehrmacht«. Dieses Problem anzugehen, bedeute vor allem Erinnerungsarbeit: Wie habe ich mehr oder weniger aktiv, mehr oder weniger passiv an dem Geschehen teilgenommen? Was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich gefühlt? Warum war die Welt – oder die Wehrmacht – für mich in Ordnung? Warum war ich begeistert? Wie konnte ich dermaßen verrohen? Den nachkommenden Generationen sagt Margarete Mitscherlich freundlich, aber bestimmt: »Wenn ihr euch mit dieser Geschichte nicht auseinandersetzt, kann sie sich wiederholen, sie ist eine Realität, diese Geschichte, an der auch die Menschen nach Hitler schwer tragen. Ihr seid nicht schuld an dieser Geschichte, aber ihr gehört zu dieser Geschichte.« Ohne diese Fragen zu bearbeiten, kollektiv wie individuell, gebe es keine vernünftige Selbstachtung, und es bestehe nach wie vor die Gefahr, eine perverse »Selbstachtung« aus der Verachtung der anderen zu beziehen. Die deutsche Art zu lieben hat überlebt.
Das zeige sich auch in der Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit. Mitscherlich bemüht sich, einen Zugang zu diesem Thema zu finden, der ihr nicht leicht fällt. Sie behandelt es gewissermaßen elliptisch, kommt von der Selbstverleugnung, die den Ostdeutschen nach der Wende aufgenötigt worden sei, zur Überheblichkeit der Westdeutschen, die an ihren Landsleuten exerzieren wollten, was sie selbst versäumt hätten, zur »Gesinnungssäuberung«, die eine Aufarbeitung verhindere, und schließlich zu den Versuchen, ein neues deutsches Nationalgefühl zu etablieren. Dann beginnt sie die Umlaufbahn von neuem.
Unmittelbar nach der Wiedervereinigung brachte der Reclam-Verlag, Leipzig, eine Taschenbuchausgabe der Unfähigkeit zu trauern heraus. Mitscherlich berichtet von ihrem Entsetzen, als sie Leserbriefe erhielt, in denen sich Bürger der ehemaligen DDR darüber beklagten, daß sie nicht trauern könnten, weil es ihnen im Sozialismus verboten war, ihre Liebe zu Hitler und seiner Gefolgschaft zu bekennen. Da war sie wieder, jene Lesart von Trauer, die den Intentionen des Buchs diametral entgegensteht, aber viel schlimmer: Was geht in den Köpfen dieser Leute, junger Leute, vor? Diejenigen ehemaligen DDR-Bürger, mit denen Mitscherlich damals Gespräche führte, seien zwar nicht so weit gegangen, »fanden es aber absurd, sich noch an etwas erinnern zu sollen, was 50 Jahre zurücklag. Es gebe andere Sorgen. Die Nazi-Zeit hätten sie ein für allemal hinter sich gebracht, auch hätte es damals manches Gute gegeben.« Das Kapitel basiert auf einer Publikation Mitscherlichs, die 1992 erschienen ist. Die Gespräche müssen also etwa zu der Zeit stattgefunden haben, als der Mob in Hoyerswerda tobte.
Die Autorin wendet sich strikt gegen die im Westen beliebte Gleichsetzung von Diktaturen, von Hitler-Reich und DDR. Dies tut sie nicht aus Sympathie für die DDR, die ihr als Gefängnis »mit dem sehr realen Symbol der Mauer« erscheint, auch wenn man zum Teil »gar nicht so schlecht« in diesem Gefängnis gelebt habe. Sie versucht, sich in die Situation der Ostdeutschen hineinzudenken. »Im Osten ging nicht nur ein Gefühl von Sicherheit verloren, sondern auch das Gefühl, die Nazi-Zeit eigentlich bewältigt zu haben. Trotz der Diktatur war man der Meinung, soziale Ideale zu verwirklichen. Das Selbstwertgefühl derer im Osten baute auf der Überzeugung auf, mitmenschlicher miteinander umgegangen zu sein als die im Westen. Dieses Gefühl wurde ihnen genommen, und sie ließen es sich nehmen, denn sie sind im Grunde überzeugt, daß die Westler recht haben mit ihrem nicht besonders sozialen Kapitalismus und ihren nicht unbedingt christlichen Werten. Ein solcher Selbstwertverlust – sei es als einzelner oder als Kollektiv – in der Folge der Vereinigung mit dem westlichen Teil Deutschlands ist unübersehbar, er muß wiederum verdrängt oder projiziert werden, damit er ertragen werden kann.«
Mitscherlich bescheinigt den Ostdeutschen: »Konfrontiert mit Armut, Arbeitslosigkeit und Amtsenthebungen nach der Wende, verstärken sich ihr Ressentiment und ihr Gefühl der Minderwertigkeit… Sie fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse und werden auch so behandelt. Ein neues deutsches Nationalgefühl soll auch da die Selbstachtung wiederherstellen.«
Mitscherlichs eindringliche Warnung vor Selbstgerechtigkeit gegenüber den »Ossis« kulminiert in diesem Satz: Nicht die Nazis im Osten seien die eigentliche Gefahr, »sondern die Relativierung, Neutralisierung und Minimalisierung der nach dem Dritten Reich erfolgten offiziellen Abkehr von antisemitischen deutschen Traditionen und deren schleichende Reintegration in die politische Kultur der Bundesrepublik«. Damit will die Autorin nicht über die Defizite des sogenannten staatlich verordneten Antifaschismus der DDR hinwegsehen. Aber die von der Bundesrepublik begierig genutzte Gelegenheit, ihn zu verdammen, ist ihr das viel größere Übel.
Kein folgenloses Übel. Es ist schade, daß Mitscherlich nicht mehr die Zeit oder die Kraft hatte, auf den NSU einzugehen, der ein halbes Jahr vor ihrem Tod aufgeflogen ist. Ihren Vorgaben folgend ist zu fragen, ob das Geschehene deshalb als skandalös empfunden wird, weil etwas Unfaßbares, nie zuvor Dagewesenes, nie für möglich Gehaltenes passiert ist oder weil etwas bekannt wurde, das niemals hätte bekannt werden dürfen, obwohl man weiß, daß es existiert – und es billigend in Kauf genommen hat. Warum erzeugt die lautstarke öffentliche Erregung so wenig Trauer um die Opfer, so wenig Mitgefühl und konkrete Hilfe für ihre Hinterbliebenen und eine so sparsame, klägliche Selbstreflexion? Warum gilt sie nur zehn von mindestens 182 Menschen, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland von Nazis umgebracht worden sind (vgl. Walter Gerlach/Jürgen Roth: Schwarzbuch Rassismus. Wallstein, Göttingen 2012)?
So beschränkt der Eindruck auch ist, den die Staatsbediensteten in Uniform oder in Schlapphüten derzeit hinterlassen, so fein ist ihr Gespür dafür ausgeprägt, was der Zeitgeist von ihnen erwartet. In ihrer Optik ist ein nationalsozialistischer Untergrund der Gesellschaft vorhanden, geduldet, also auch erwünscht. Noch besser verstehen sie den Wunsch, diesen Untergrund zu verdrängen. Daher kommen die phantasiereichen Ausreden »Dönermorde«, »Istanbul« und »Ermittlungspanne«. Genauso sehen es die Nazi-Täter selber: »Wir erfüllen nur die geheimen Wünsche der schweigenden Mehrheit.« Aber sie müssen geheim bleiben, damit die Mehrheit weiter schweigen kann.
Nationalsozialistischer Untergrund ist wirklich ein treffender, ein ungeheuerlicher Begriff. Er hätte von Margarete und Alexander Mitscherlich geprägt werden können. Wer hat den Namen eigentlich erfunden? Das wäre eine interessante Frage für den Münchner Prozeß. Ich glaube nämlich nicht, daß Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt oder Wohlleben die Namensgeber gewesen sind. Oder wir unterschätzen diese Leute. Wenn wir einen nationalsozialistischen Untergrund konstatieren, dann müssen wir uns eingestehen, daß es für Warnungen vor der Gefahr eines Wiederholungszwangs zu spät ist. Er findet bereits statt. Je mehr Zeit verstrichen ist, desto weniger läßt sich sagen: Wir haben andere Sorgen. Der Band schließt mit einem Interview aus dem Jahr 2010, in dem Margarete Mitscherlich alle an sie herangetragenen Fragen, auch indiskrete, peinliche, in der ihr eigenen Art beantwortet: offen, präzise, hellwach, humorvoll, selbstkritisch, souverän. Nicht zuletzt zeugt das Buch davon, daß sie, schriftlich wie mündlich, eine Meisterin der Sprache gewesen ist.
Margarete Mitscherlich: Eine Liebe zu sich selbst, die glücklich macht. Fischer, Frankfurt a. M. 2013, 272 Seiten, 18,99 Euro
Detlef zum Winkel schrieb in KONKRET 9/13 über den neuen iranischen Präsidenten Rohani