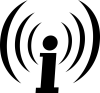Dies ist eine Bilanz des 89 Tage langen Streikes der Beschäftigten bei der Charité Facility Management GmbH (CFM). Die CFM ist eine Tochtergesellschaft der Charité, an der auch private Unternehmen beteiligt sind. Die Beschäftigten kämpften für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.
Weitere Infos unter: klassenkampfblock.de
Belegschaft wehrt sich gegen Privatisierung im Gesundheitswesen | Streik bei CFM nach drei Monaten ausgesetzt
»Ich hatte einen Traum, es war kein schöner Traum. Es war ein Albtraum.
Mir träumte, unser Streik sei komplett sinnlos gewesen. […] Wir hatten
unseren Streik verloren und die Jahre gingen ins Land. Wir waren mutlos
geworden und unsere Bosse ließen sich immer mehr einfallen, um uns
auszunehmen. Die wirtschaftliche Situation hatte sich verschlechtert und
uns wurde gesagt, dass wir für das große Ganze Opfer zu bringen hätten.
Den Gürtel enger schnallen, hieß es. Einige von uns überlegten sich,
den Gürtel anders zu gebrauchen. […] Menschen, die dem Arbeitstempo
nicht mehr folgen konnten, wurden einfach gefeuert. Denn der
Kündigungsschutz hatte sich in Rauch aufgelöst. […] Es gab zwar noch
Gewerkschaften, aber sie hatten kaum noch Mitglieder, weil die Kollegen
einfach zu große Angst hatten, sich zu organisieren. […]
Wir brauchen nicht viel Fantasie um uns vorzustellen, was mit uns
geschehen wird, wenn wir uns nicht weiter wehren. Die Löhne werden immer
weiter sinken, wir werden Jahr um Jahr ärmer. Die Arbeit wird uns kaum
noch Kraft fürs Leben lassen. […] Wenn das in diesem Tempo weitergeht,
nagen bald alle – die arbeiten müssen, um zu überleben – am Hungertuch.
Eine kleine Schicht hingegen weiß bald nicht mehr, wohin mit dem vielen
Geld. Eine Schicht, die sich immer ungenierter bereichert. […]
Wir haben beinahe ein Vierteljahr gestreikt. […] Wir haben nicht nur gestreikt, damit wir endlich einen Tarifvertrag unterschreiben können. Wir haben für unsere Würde gestreikt. Wir haben gegen die große Angst gestreikt […]. Wir haben gestreikt, weil wir begriffen haben, dass wir uns nur selber helfen können. Wir waren solidarisch untereinander, wir sind solidarisch mit den Kollegen, die noch Angst haben – auch für sie haben wir gestreikt. Etwas haben wir dazugelernt. Mut ist ansteckend und, hat er sich einmal festgesetzt, so wird man ihn nicht mehr los. […]
Wir gehen wieder an die Arbeit und werden unseren Kolleginnen und Kollegen erklären, wie das so ist mit einem Streik und dass es sich lohnt – sowohl finanziell als auch menschlich – für seine Interessen zu kämpfen. Im Januar beginnen wir mit den Verhandlungen zu einem Tarifvertrag, das ist viel Arbeit und wird ziemlich anstrengend. Gleichzeitig werden wir unsere Betriebsgruppen verstärken und die Arbeiten in den verschiedenen Bereichen intensivieren. Aus diesem Streik gehen wir gestärkt hervor. […]« (László Hubert, Tellerwäscher, Streikkurier Nr. 57)
So die Bilanz eines Kollegen nach 89 Streiktagen, in der er sich auch bei den zahlreichen UnterstützerInnen des Arbeitskampfes bedankte: beim Solidaritätskomitee, bei den zuständigen SekretärInnen von ver.di und bei den KollegInnen aus anderen Betrieben, Branchen und Gewerkschaften.
Im Arbeitskampf haben die Beteiligten eine Fülle gewerkschaftlicher Erfahrungen und politischer Erkenntnisse gewonnen. Wohl kaum jemand hatte sich zu Beginn vorstellen können, wie hartnäckig und lange sie diese Auseinandersetzung würden führen müssen. KollegInnen, die noch nie im Leben an einer Demonstration teilgenommen hatten, gingen im Verlauf des Streiks mehrmals in der Woche auf die Straße, verbündeten sich auf Kundgebungen mit der »Occupy-Bewegung«, blockierten das CFM-Lager in Siemensstadt und demonstrierten sowohl vor als auch im »Kulturkaufhaus Dussmann«.
Die Privatisierung der Krankenversorgung in Berlin
Nach der Wiedervereinigung wurden von 1998 bis 2003 die Universitätskliniken und die medizinische Forschung aus Ost- und Westberlin zur Charité zusammengefasst und in eine private Rechtsform überführt. Alleiniger Eigentümer ist das Land Berlin. Ähnlich verfuhr der Senat übrigens auch mit den acht städtischen Krankenhäusern, die er unter dem Dach eines Konzerns (Vivantes) zusammenführte. Zweck der Zusammenschlüsse: Der Senat konnte sowohl in der stationären Krankenversorgung als auch in der universitären Forschung einsparen. »Mitte 2003 wurde die Berliner Hochschulmedizin erneut umstrukturiert: Es kam zur Fusion der Charité mit der medizinischen Fakultät der Freien Universität Berlin. Die Entscheidung erwuchs hauptsächlich aus der angespannten Haushaltslage des Landes Berlin, das der fusionierten Charité eine Einsparvorgabe für das Budget für Forschung und Lehre in Höhe von 98 Mio. Euro mit auf den Weg gab.« (Wikipedia)
Mit der Charité entstand die größte europäische Universitätsklinik, ausgestattet mit modernster Technik und mit medizinischer Forschung auf Spitzenebene. Den Spitzenplatz sicherte sich die Charité angesichts der Sparmaßnahmen des Senats und der Kostenreduzierung für pflegerische und medizinische Leistungen durch die Krankenkassen zu Lasten der Beschäftigten. Mit welchen Methoden, das belegt eindrucksvoll die Geschichte der Charité Facility Management GmbH (CFM).
Im Jahre 2006 gliederte die Charité alle »nichtmedizinischen« und
»nichtpflegerischen« Leistungen in die CFM aus und machte diesen Bereich
auch für große private Investoren attraktiv. 51 Prozent der
Gesellschaftsanteile hält die Charité (also der Senat), die restlichen
49 Prozent verteilen sich auf das private Konsortium VDH (VAMED,
Dussmann und Hellmann). »Der Vertrag, der zwischen der Charité und dem
Konsortium VDH geschlossen wurde, umfasst ca. 37 Ordner und befindet
sich in einem Datenraum der CFM, mit begrenzten Zugangsberechtigungen.«
(Schwarzbuch CFM) Der 51-Prozent-Anteil der Charité soll nicht etwa den
Einfluss des Senats absichern. Er verschafft der Gesellschaft die
Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und befreit sie von
der Umsatzsteuer. Im Aufsichtsrat stellen die privaten Investoren die
Mehrheit. In den ersten fünf Jahren seit Bestehen der CFM konnte die
Charité nach Angaben des damaligen Senators Zöllner (Wissenschaft und
Bildung) 168 Millionen Euro einsparen. Auf dem Rücken der Beschäftigten
wurden nicht nur die Sparvorgaben des Senats umgesetzt, sondern auch
noch die Renditen der privaten Investoren erwirtschaftet.
Arbeitshetze und Niedriglöhne – die tariffreie Zone CFM
»Vor der Gründung der CFM hatten 2,5 Reinigungskräfte acht Stunden Zeit, um eine Station zu reinigen. Das sind 16 bis 18 Patientenzimmer inklusive Bad und Toilette, die Gänge, Treppen und Behandlungsräume. Heute muss eine einzige Kraft dieses Pensum in nur sechs bis sieben Stunden bewältigen.« (ver.di-Flugblatt)
Die Umfrageaktion der ver.di-Betriebsgruppe zu den Lohn- und
Arbeitsbedingungen (abgedruckt im Schwarzbuch über CFM) ergab folgendes
Bild: »Innerhalb desselben Tätigkeitsbereiches liegen die
Lohnunterschiede immerhin bei bis zu 107 Prozent, so zum Beispiel
zwischen 1.450 und 2.200 Euro im RLT (Raum, Luft, Technik), zwischen
1.400 und 2.900 Euro im VT (Versorgung, Technik), zwischen 955 und 1.400
Euro im SET (Sicherheit, Empfang, Telefondienst).
Fast alle Befragten haben Probleme im Rahmen ihrer Arbeit angeführt. Dazu gehören:
- hoher Arbeitsdruck (59 Prozent)
- Personalmangel (75 Prozent)
- MitarbeiterInnen gehen krank zur Arbeit (39 Prozent)
- arbeitsbedingte gesundheitliche Probleme (42,5 Prozent)
- MitarbeiterInnen können ihre Pausen nicht nehmen (16 Prozent)
- Bossing/Mobbing (11,5 Prozent)«
Die niedrige Bezahlung vor allem im Bereich des Sicherheitsdienstes
und die Teilzeitbeschäftigung hatten zur Folge, dass zahlreiche
KollegInnen von ihrem Lohn nicht leben konnten und zu den
Hartz-IV-Aufstockern gehörten. Die Stundenlöhne lagen teilweise
erheblich unter den 7,50 Euro, die der damalige rot-rote Senat als
Vergaberichtlinie für öffentliche Aufträge beschlossen hatte.
Tarifforderungen der CFM-Beschäftigten:
- Erhöhung der individuellen Entgelte um 168 Euro/Monat als erster Schritt zu fairen Löhnen
- Einheitliche wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden (Besitzstandswahrung für Beschäftigte mit 38 bzw. 38,5 Wochenstunden)
- Einführung und Definition von Arbeitszeitmodellen, die transparent und
vor dem Hintergrund des Anspruchs »Vereinbarkeit von Beruf und Familie«
auch gelebt werden können
- 30 Tage Erholungsurlaub
- Einheitliche Regelungen für Sonderformen der Arbeit (u.a.
Schichtarbeit, Bereitschaftsdienst) und entsprechender Ausgleich in Form
von Zuschlägen, Zulagen, Freizeitausgleich
- Zusatzurlaub bei Wechselschicht- und Schichtarbeit
- Entgeltfortzahlung für alle Beschäftigten bis zum Ablauf der sechsten
Krankheitswoche sowie anschließende Zahlung von Krankengeldzuschuss
- Einheitliche Entgelttabelle
- Einführung einer Jahressonderzahlung
- Einführung von Entgeltumwandlung oder anderen betrieblichen Altersversorgungen
- Längere Kündigungsfristen für den Arbeitgeber-
- Eingruppierungs-/Entgeltordnung
Betriebliche Ausgangsbedingungen für die gewerkschaftliche Mobilisierung
Widerstand, der die Ausgliederung selbst in Frage stellen konnte, gab es in den Jahren 2005/2006 weder von der Belegschaft noch von den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ver.di, IG BAU und die dem Deutschen Beamtenbund (DBB) angehörige Gewerkschaft Kommunaler Landesdienst (GKL). Immerhin konnten die Beschäftigten der Charité, die in die CFM wechseln sollten, durchsetzen, dass ihr Beschäftigungsverhältnis bestehen blieb. Sie arbeiten seither bei der CFM als »Gestellte« (als Leiharbeiter) und werden mit den bei der Charité üblichen tariflichen Leistungen entlohnt.
Nicht nur die Spaltung zwischen der Stammbelegschaft in der Charité und den ausgegliederten CFM-Beschäftigten erschweren den gewerkschaftlichen Widerstand. Die CFM-Belegschaft ist eine bunt zusammen gewürfelte Mannschaft. So unterschiedlich wie die Entlohnung sind auch die übrigen Bedingungen in den Arbeitsverträgen geregelt. Wie schon gesagt, etwa ein Drittel der CFM-Mitarbeiter sind Gestellte, die noch nach den Bedingungen der Charité entlohnt werden und nicht unmittelbar von einem Tarifvertrag für die CFM profitieren. Nur wenige von ihnen waren bereit, dem Aufruf zum Streik bzw. Solidaritätsstreik zu folgen. Andere CFM-Beschäftigte wechselten, meist per Aufhebungsvertrag, von kleinen Dienstleistern, die bisher schon für die Charité tätig waren, in die Charité-Tochter oder wurden völlig neu eingestellt. Ein Fünftel der Beschäftigten hat ein befristetes Arbeitsverhältnis. Die Hoffnung auf eine mögliche spätere Festeinstellung hält die Mehrheit der Befristeten von der Teilnahme an gewerkschaftlichen Aktivitäten ab. Dementsprechend niedrig war der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei der CFM, er konnte im letzten Jahr vor dem Streikbeginn von 12 nur auf etwa 20 Prozent erhöht werden.
Es waren anfangs nur wenige AktivistInnen, die in den vergangenen fünf Jahren durch mühsame, tägliche Kleinarbeit gewerkschaftliche Strukturen aufbauten und damit die Voraussetzung zur Aufnahme der Tarifauseinandersetzung schufen. Im Januar 2009 wurde die Geschäftsleitung der CFM erstmals zur Aufnahme von Tarifverhandlungen aufgefordert. Sie erklärte in drei Sondierungsgesprächen, dass sie keine Notwendigkeit sehe, einen Tarifvertrag zu schließen. Nach erneuten Gesprächen im Dezember 2010/Januar 2011 übergab die Geschäftsführung eine schriftliche Stellungnahme zum Forderungspaket. Aussage: Es werde kein großer Handlungsbedarf in Sachen Tarifvertrag gesehen, da der größte Teil individualrechtlich oder in Betriebsvereinbarungen geregelt sei.
Gemeinsame Streikaktionen bei Charité und CFM
Zu Beginn des Jahres 2011 standen auch für die Pflegekräfte der Charité Tarifverhandlungen an. Ver.di forderte eine Erhöhung des Lohnes um 300 Euro. Damit sollten die Beschäftigten der Charité wieder an die nach dem Flächentarifvertrag übliche Bezahlung herangeführt werden und die Lohnverluste der vergangenen Jahre ausgeglichen werden. Der Tarifkonflikt an der Charité bildete neben der jahrelangen gewerkschaftlichen Kleinarbeit bei CFM eine weitere Voraussetzung, um aktiv in die Auseinandersetzung gehen zu können.
Am 15. März 2011 gab es einen gemeinsamen Warnstreik. 2.000 KollegInnen an den drei Charité-Standorten nahmen daran teil. Jeweils über 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder sprachen sich in den folgenden Urabstimmungen für Kampfmaßnahmen aus. Ab dem 2. Mai gingen beide Belegschaften in den Ausstand. Die zeitgleiche Aufnahme von Kampfmaßnahmen in zwei formal getrennten Tarifrunden verlieh dem Streik die nötige Anschubkraft und machte vor allem den CFM-Beschäftigten Mut, da sie nicht allein standen.
Die Auswirkungen auf den Klinikbetrieb waren rasch zu spüren. Operationen mussten abgesagt, Betten konnten nicht mehr belegt werden. Nach fünf Tagen reagierte die Geschäftsführung. Sie unterbreitete den Charité-Beschäftigten ein Angebot, mit dem sie den Forderungen weitgehend entgegenkam, beispielsweise eine stufenweise Erhöhung der Löhne um 300 Euro. Neben den betrieblichen und finanziellen Wirkungen des Streiks dürfte eine weitere Überlegung die Geschäftsführung zum Nachgeben veranlasst haben. Es kann nicht in ihrem Interesse liegen, die Verbundenheit zwischen den ausgegliederten und den Stammbeschäftigten durch einen länger dauernden, gemeinsamen Streik zu stärken. Die Vorstände von CFM und Charité hatten wohl auch die Einschätzung, dass die Beschäftigten der CFM auf sich allein gestellt ihren Arbeitskampf nicht lange durchhalten würden.
Ähnliche Überlegungen – aber aus entgegengesetzter Interessenlage – flossen in die Diskussion über das Für und Wider des Angebots auf der Streikversammlung ein. Lassen wir die CFM-KollegInnen nicht im Regen stehen, wenn wir annehmen und den Streik beenden? Die Tarifkommission an der Charité und eine breite Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder stimmten schließlich für eine Annahme und die Beendigung des Arbeitskampfes. Die CFM-Belegschaft musste die Auseinandersetzung alleine fortführen. Doch das Kalkül der Geschäftsleitung ging nicht auf. Die Woche des gemeinsamen Kampfes, die täglich zunehmenden Einschränkungen im Klinikbetrieb hatten die Streikbeteiligung bei der CFM kontinuierlich anwachsen lassen. Die Streikfront konnte auch in der kommenden Woche aufrechterhalten werden. Dennoch, es blieb eine Minderheit der Belegschaft, zwischen 250 und 300 KollegInnen, die sich an dem monatelangen Arbeitskampf beteiligen sollten.
Am 14. Mai wurde der Streik zunächst beendet. Auf einer Kundgebung
vor dem SPD-Parteitag hatte der Bildungssenator Zöllner den Streikenden
die Zusicherung gegeben, sich für die Aufnahme von Tarifverhandlungen
einzusetzen. Dies war offensichtlich mit der CFM-Leitung abgestimmt, die
sich der Aufnahme von Tarifverhandlungen nicht mehr verweigerte. Die
Verhandlungen begannen am 31. Mai und zogen sich bis zum 31. August hin.
Wie sich herausstellte, war die Verhandlungsbereitschaft nur die
übliche Hinhaltetaktik. Ernsthafte Angebote wurden seitens der
Geschäftsführung nicht gemacht. »Vor allem sieht das Angebot in nur vier
von 18 Leistungsbereichen überhaupt gewisse Verbesserungen vor. Die
Tarifkommission von ver.di und dbb/gkl bezeichnet das als
‚Rosinenpickerei’.« (Schwarzbuch CFM) Die CFM-Leitung hatte die Zeit
genutzt, um sich auf die kommende Auseinandersetzung vorzubereiten, wie
sich nach Wiederaufnahme des Arbeitskampfes herausstellen sollte. Die
Verhandlungen wurden von den Gewerkschaften am 31. August für
gescheitert erklärt und eine erneute Urabstimmung vom 5. bis 7.
September zur Einleitung des Erzwingungsstreiks eingeleitet.
Solidaritätskomitee und Gewerkschaften im CFM-Streik – die IG BAU propagiert den Streikbruch
Neben der Spaltung zwischen Stamm- und ausgegliederter Belegschaft und der Zersplitterung innerhalb der CFM – in Gestellte, in Beschäftigte mit befristeter und fester Einstellung etc. – erwies sich die Haltung der IG BAU als ein weiteres Hindernis bei der Organisierung der Streikfront. Sie lehnte nicht nur eine Beteiligung am Arbeitskampf ab, sondern rief ihre Mitglieder zum Streikruch auf. Der Arbeitskampf sei illegal, so ihre Begründung. Hinter dieser Behauptung verbergen sich organisationspolitische Eigeninteressen. Die IG BAU strebt gar keinen einheitlichen Tarifvertrag für die CFM an. Sie will nur ihre Klientel, die CFM-Reinigungskräfte, unter den entsprechenden Flächentarif der IG BAU bringen.
Auf Kosten eines einheitlichen Tarifes für die Belegschaft und in Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften soll so der eigene Mitgliederbestand als finanzielle Basis des Gewerkschaftsapparates gesichert werden. Für die IG BAU zahlte sich der Streikbruch nicht aus. Zahlreiche Mitglieder traten zu ver.di oder zur GKL über. Trotzdem trug das Verhalten zu zusätzlichen Unsicherheiten und Ängsten in der Belegschaft bei.
Zusammen mit der GKL bildete ver.di eine Tarifunion. Dabei zogen die KollegInnen und die für den Streik zuständigen Gewerkschaftssekretäre an einem Strang. Vor allem die ver.di-Verhandlungsführerin, Sylvi Krisch, fand durch ihr unermüdliches Engagement viel Anerkennung bei den Beschäftigten. Offene Widersprüche zu den gewerkschaftlichen Vorständen und Apparaten traten im Verlauf der Auseinandersetzung nicht zu Tage. Die CFM-Beschäftigten kämpften und kämpfen für eine spürbare Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, für die Gewerkschaften geht es um die Anerkennung als Sozialpartner durch den Abschluss eines Tarifvertrages. Die Interessen der Streikenden und der gewerkschaftlichen Vorstände und Apparate deckten sich an diesem Punkt.
Trotz des persönlichen Engagements der zuständigen Funktionäre wurden im Verlauf des Arbeitskampfes die personellen und inhaltlichen Schwächen der Gewerkschaften sichtbar. Der dreimonatige Streik wäre ohne das Engagement des Solikomitees kaum so zu organisieren gewesen. Zahlreiche SAV-Mitglieder, die sich dort zusammengefunden hatten, waren im Streik täglich vor Ort. Sie packten praktisch mit an, brachten ihre organisatorischen Erfahrungen und Fähigkeiten ein und beteiligten sich an den gewerkschaftlichen und politischen Diskussionen. Kurz gesagt, sie nahmen auch gewerkschaftliche Aufgaben wahr, denen die Gewerkschaften selbst nicht nachkommen konnten. Drei Mitglieder des Komitees wurden deshalb in die Streikleitung aufgenommen.
Die ver.di-Strukturen gleichen eher einem Beamtenapparat zur Betreuung und Verwaltung einer überwiegend (noch) passiven Mitgliedschaft – gegliedert in 13 zuständige Fachbereiche und noch mehr Fachgruppen. Eine Vermittlung oder Diskussion der gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung des CFM-Streiks gab es in ver.di offensichtlich nicht. Eine gewerkschaftliche Strategie oder Taktik, wie der Arbeitskampf erfolgreich geführt werden könne, war weder auf der Fachbereichs-, Landes- oder Bundesebene erkennbar. Alle Anregungen und Vorschläge, die dem Arbeitskampf mehr Schwung und Durchschlagskraft verleihen sollten, kamen von unten: aus den Streikversammlungen, der Streikleitung oder dem Solikomitee. Sie wurden, trafen sie die Stimmung und das Bedürfnis, von den CFM-KollegInnen aufgegriffen und umgesetzt.
Gleiches gilt für die überbetriebliche Unterstützung und Mobilisierung. Es waren die wenigen kritischen KollegInnen an der Basis anderer Fachbereiche und in anderen Gewerkschaften, die dafür sorgten, dass entsprechende Bitten und Anfragen der CFM-Streikleitung oder des Solidaritätskomitees auch umgesetzt wurden. Oder sie brachten selbst Vorschläge für eine gewerkschaftsübergreifende Diskussion und Mobilisierung ein.
Gewerkschaftliche Perspektiven
Auch wenn es in den Verhandlungen zunächst um den Abschluss eines Tarifvertrages ging, die Ausgliederung wurde zu einem wichtigen Thema sowohl im Arbeitskampf als auch in der öffentlichen Darstellung und Mobilisierung. Die ver.di-Betriebsgruppen an der Charité und bei CFM, die Streikleitung und das Solikomitee wiesen immer wieder auf die Ausgliederung als eine Ursache für Niedriglöhne und Arbeitshetze hin. Sie verknüpften den aktuellen Tarifkonflikt mit der politischen Forderung nach einer Wiedereingliederung der CFM in die Charité. Die Durchsetzung eines Tarifvertrages soll ein erster Schritt auf dem Weg dahin sein. Die Betriebsgruppenarbeit erhält mit dieser Zielsetzung eine gewerkschaftspolitische Perspektive, die über die Regelung von Sozial-, Tarif- und Arbeitsrechtsfragen und über die übliche Routine der Arbeit in den Betriebsräten hinausweist.
Auch an diesem Punkt unterschied sich der Arbeitskampf bei CFM deutlich von der Haltung, mit der die deutschen Gewerkschaften ihr Tagesgeschäft betreiben. Auch wenn die Gewerkschaftsvorstände in der Öffentlichkeit politische und unternehmerische Entscheidungen moralisch anklagen, deren Legitimität selbst stellen sie nicht in Frage. Sie beschränken sich in der Regel darauf, die Folgen politischer und/oder unternehmerischer Entscheidungen tariflich zu regeln – mit immer weniger Erfolg und sinkendem gesellschaftlichen Einfluss.
Wie schwierig es werden würde, auch nur dem Etappenziel, einem Tarifvertrag, näher zu kommen, sollte sich in den kommenden Monaten des Arbeitskampfes herausstellen. Das traditionelle gewerkschaftliche Mittel, die Verweigerung der Arbeitskraft, reichte allein nicht, um einen Durchbruch zu erzwingen.
Der CFM-Streik – ein politischer Lernprozess
Am 12. September begann der Erzwingungsstreik unter denkbar schweren Ausgangsbedingungen. Die streikenden CFM’ler – wie gesagt, eine Minderheit in der Belegschaft – hatten nicht nur drei international agierende Konzerne zum Gegner, sondern auch den Berliner Senat. Die Geschäftsführung von CFM hatte die dreimonatige Verhandlungspause genutzt, um sich auf den Arbeitskampf vorzubereiten. Leiharbeiter, manchmal zwei oder drei für eine ausfallende Arbeitskraft, sollten als Streikbrecher die Auswirkungen des Ausstandes auffangen. So gelang es der CFM den Krankenhaus- und Klinikbetrieb an der Charité ohne gravierende Störungen aufrecht zu erhalten. Über den Druck der Vorgesetzten sollten die CFM-MitarbeiterInnen von einer Streikbeteiligung abgehalten und die Streikenden an der Kontaktaufnahme mit ihren arbeitenden KollegInnen gehindert werden. Dem diente auch der Einsatz einer privaten Sicherheitsfirma. Ihre Aufgabe: die Beseitigung/der Abriss von Streikaufrufen, Plakaten, Gewerkschaftsfahnen und die Einschüchterung von Streikteilnehmern.
Die wurden, sobald sie das Gelände der Charité betraten, vom privaten Wachpersonal auf Schritt und Tritt begleitet.
Die Wachschützer erweckten den Eindruck, als wären sie von der Disco-
und Türsteherszene angeheuert. Zum Bumerang für die Geschäftsführung
wurde deren Einsatz, als sich herausstellte, dass sich unter ihnen
tatsächlich Mitglieder der »Hells Angels« befanden. Das sorgte für
Schlagzeilen in den Lokalmedien. »Echt krank! Die Charité nimmt Hells
Angels als Streikbrecher«, titelte der »Berliner Kurier«.
Neben diesen Einschüchterungsversuchen setzte der CFM-Vorstand darauf, den Streik aushungern zu können. Über zehn Wochen lang gab es kein Signal des Einlenkens. Mit einer Vielzahl von Aktionen, die im Verlauf des Arbeitskampfes ständig zunahmen, versuchten die KollegInnen die Öffentlichkeit zu informieren und zu mobilisieren. Es würde den Rahmen eines Artikels sprengen, alle Aktionen zu beschreiben. (Wer sich ausführlicher informieren will, dem sei die Internetseite des CFM-Solikomitees empfohlen. Dort findet ihr alle Flugblätter, Streikkuriere etc. unter www.cfmsolikomitee.wordpress.com) Im Folgenden werden nur die wichtigsten Aktionen benannt.
Für alle Beschäftigten präsent bleiben und Sand ins Getriebe streuen
Die Bedingungen an der Charité stellten an die Organisation des Arbeitskampfes besondere Anforderungen. Ein Krankenhaus mit Patienten- und Publikumsverkehr lässt sich nicht wie ein Betrieb mit Streikposten quasi abriegeln. Zudem gibt es drei Standorte. Um den Zusammenhalt der 300 Streikenden zu stärken und trotzdem überall präsent zu sein, rotierte das Streiklokal zwischen den einzelnen Standorten. Das war auch deshalb wichtig, um für die arbeitenden Beschäftigten bei der CFM und an der Charité präsent zu bleiben. Es gelang durch den Besuch und durch Gespräche in den Abteilungen, einzelne Kolleginnen und Kollegen noch zur Teilnahme am Streik zu bewegen. Zu den betrieblichen Aktivitäten gehörten auch kurze Blockaden des CFM-Lagers (bis zu vier Stunden). Es befindet sich auf dem Siemens-Firmengelände in Siemensstadt. Ergänzt wurden diese Blockadeaktionen durch die kurzfristige Sperrung von Zufahrten für Lieferfahrzeuge an den Charité-Standorten. Es gelang zwar nicht, den Betriebsablauf entscheidend zu behindern, aber doch »Sand ins Getriebe zu streuen«. Die kleinen Störungen im Betriebsablauf – seien es sich stapelnde Müllsäcke oder der Ausfall von Besuchertoiletten – hoben die Moral der im Ausstand stehenden Beschäftigten und zeigten den Weiterarbeitenden: Die Streikfront steht noch.
Die Streikenden ließen es sich nicht nehmen, das jährlich stattfindende Mitarbeiter-Fest der Charité auf dem Campus Virchow zu besuchen. Durch Redebeiträge, Sprechchöre und Trillerpfeifen machten sie dem Veranstalter und den Besuchern deutlich: Der Tarifkonflikt ist nicht beigelegt. Dem diente auch die Mahnwache vor dem Büro der Geschäftsführung. Auch der Streikbruch blieb nicht unbeantwortet. Die Leiharbeitsfirmen, die ihre Arbeitskräfte der CFM zum Unterlaufen des Ausstandes zu Verfügung stellten, bekamen Besuch. Auf Kundgebungen vor deren Firmensitzen wurde darauf hingewiesen, dass nach dem geltenden Tarifvertrag zwischen Leiharbeitsfirmen und dem DGB die Bereitstellung von Streikbrechern nicht zulässig ist.
Gegenseitige Unterstützung im Arbeitskampf
Ein fester Verbündeter im Arbeitskampf waren die KollegInnen der Alpenland-Altenpflegeheime aus dem Ostteil Berlins. Sie waren schon zwei Wochen im Ausstand, als der CFM-Streik begann. Ihre Forderung: eine Angleichung der Löhne auf das im Westen der Stadt gezahlte Niveau. Gemeinsam wollten beide Belegschaften Tarifmauern niederreißen – die zwischen Ost und West und die innerhalb der Charité. 90 Tage dauerte der Ausstand bei Alpenland. Die gemeinsame Streikzeit führte zu einer engen Kooperation: durch die Teilnahme am Solikomitee, durch gegenseitige Besuche, durch gemeinsam organisierte Versammlungen und Demonstrationen.
Als die streikenden KollegInnen der Prinovis-Druckerei aus Nürnberg eine Demonstration in Berlin mit abschließender Kundgebung vor der Bertelsmann-Konzenzentrale ankündigten war für die CFM- und Alpenland-Beschäftigten klar: Daran werden wir uns beteiligen. So können wir die Drucker aus Nürnberg unterstützen und unser eigenes Anliegen vortragen. Eines wurde durch die Redebeiträge auf der Kundgebung deutlich: Die Methoden der Konzernleitungen zur Schaffung eines Niedriglohnsektors und zur Abwehr tariflicher Standards gleichen sich, ob nun im Krankenhaus oder in der Medien- und Druckbranche. Wir haben gemeinsame Interessen über betriebliche und Branchegrenzen hinaus.
Auf einer Kundgebung vor der Charité-Aufsichtsratssitzung beteiligten sich neben den CFM-Beschäftigten auch einige dutzend PsychologInnen in Ausbildung (PiA). Die hatten zum ersten Mal zu einer bundesweiten Streikwoche aufgerufen. Die PsychologInnen müssen zum Abschluss ihres Studiums ein 18-monatiges Praktikum absolvieren. Die Bezahlung ist weder gesetzlich noch tariflich geregelt. Das nutzen die »Arbeitgeber« aus. Durch die Beschäftigung von PiA-Kräften werden reguläre Stellen und immense Lohnkosten eingespart. Teilweise wird ein Taschengeld bezahlt (in den Krankenhäusern von Vivantes 200 Euro), die Charité zahlt den PsychologInnen überhaupt nichts.
Die überbetriebliche Solidarität
Nach Anlaufschwierigkeiten kam auch die betriebsübergreifende gewerkschaftliche Solidarität in Schwung. Dazu zählten zwei Demonstrationen, zu denen das Solikomitee und der ver.di-Fachbereich aufgerufen und an denen sich jeweils mehrere hundert Teilnehmer aus weiteren Fachbereichen und aus anderen Gewerkschaften beteiligten.
Bisher einmalig war die Flugblattaktion bei der BVG. Die gewerkschaftlichen Vertrauenslaute des Berliner Nahverkehrs verteilten Zehntausende von Flugblättern an ihre KollegInnen und an die Fahrgäste in Bussen, Straßen- und U-Bahnen. Einen solchen Einsatz für kämpfende Beschäftigte aus anderen Fachbereichen hat es bei der BVG noch nie gegeben. Die sozialpartnerschaftlichen Strukturen waren und sind bei der BVG besonders stark ausgeprägt. Sie entstammen den Zeiten der engen Verfilzung zwischen Senat, Management der Nahverkehrsbetriebe und alter ÖTV. Auch bei der S-Bahn verbreiteten Lokführer an ihren Meldestellen und in den Zügen die Informationen über den Arbeitskampf an der Charité.
Nach zwei Monaten im Arbeitskampf organisierten das Solikomitee und die Streikleitung eine offene Streikversammlung. Das Ziel: Der Durchhaltewille sollte gestärkt werden. »Über 350 Kolleginnen und Kollegen waren gekommen. Neben uns Streikenden von der CFM waren darunter streikende Alpenland-KollegInnen, über 30 IG-Metall-Mitglieder, GewerkschafterInnen von der Charité, der Telekom, der S-Bahn, den Bosch-Siemens-Hausgeräten, von Otis, Siemens, CNH (ehemals O&K), der BVG, der Post, der Landesverwaltung Berlin, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Studierende und SchülerInnen.« (Streikkurier Nr. 37) Das Ziel wurde erreicht. Eingerahmt von einem politischen Kulturprogramm wurden zahlreiche Solidaritätsbotschaften aus anderen Belegschaften verlesen und über Ausbeutungsmethoden und Arbeitsbedingungen dort berichtet. Besonders beeindruckend war es, wenn über die eigenen Erfahrungen aus Arbeitskämpfen berichtet wurde, beispielsweise durch zwei Kollegen von Orenstein & Koppel. Das regte an und machte Mut.
Die Praktiken der privater Investoren öffentlich machen
Für öffentlichkeitswirksame Aktionen bot sich in Berlin der CFM-Investor Dussmann an. Der Konzern betreibt in der Friedrichstraße ein »Kulturkaufhaus« und pflegt sein Image als künstlerisch und sozial engagiertes Unternehmen. Oft mehrmals in der Woche besuchten Streikende, SympathisantInnen und UnterstützerInnen das Kaufhaus: um Flugblätter zu verteilen, um auf Kundgebungen zur Solidarität aufzurufen oder um mit Flashmobaktionen auf die Dussmann-Praktiken aufmerksam zu machen . Die Geschäftsleitung reagierte zunehmend genervt – mit Hausverboten und Polizeischutz.
Neben Dussmann wurden auch die Firmensitze der beiden anderen CFM-Investoren aufgesucht. Die KollegInnen organisierten beispielsweise eine Fahrt nach Hamburg. Dort blockierten sie für kurze Zeit die Zufahrt zum Hellmann-Firmengelände im Hafen. Anschließendend informierten sie auf einer Kundgebung vor dem Universitätsklinikum Eppendorf deren Beschäftigte über den Arbeitskampf an der Berliner Universitätsklinik.
Den Politikern auf die Pelle rücken
Der Ausstand begann in der Endphase des Berliner Wahlkampfes. Es lag also nahe, ihn zu nutzen um politischen Druck auf die parlamentarischen Parteien auszuüben.
Der Wirtschaftssenator Wolf nahm auf einer Wahlkundgebung der Linkspartei geschickt das Anliegen der anwesenden CFM-Beschäftigten auf. Die SPD sei verantwortlich für die Missstände an der Charité. Ihre Initiativen zu Verbesserungen der Arbeitsbedingungen hätte der große Koalitionspartner stets abgeblockt. Warum die Linkspartei dabei mitgespielt hatte, fragten sich dabei viele der anwesenden Streikteilnehmer. Darauf ging der Wirtschaftssenator nicht ein.
Der große Koalitionspartner, der Regierende Bürgermeister, zeigte
sich wenig beeindruckt von den Protesten. Von Streikenden bei einem
Besuch an der Charité gestellt ließ sich Wowereit auf keine lange
Debatte ein. Er bestritt, dass bei CFM Löhne von unter 7,50 Euro bezahlt
werden und entschwand in das Gebäude der Charité.
Während der Koalitionsverhandlungen zur Senatsbildung gab es zwei Demonstrationen zum Roten Rathaus.
Auch die Berliner SPD-Zentrale in der Weddinger Müllerstraße besuchten die CFM’ler und hielten sie kurzzeitig besetzt. Eine rund um die Uhr besetzte Mahnwache wurde später vor dem SPD-Sitz eingerichtet und zum Anlaufpunkt für interessierte Bürger aus dem Wedding.
Der Streik wird mit einem Zwischenergebnis beendet
Ende November/Anfang Dezember trat der Arbeitskampf in die entscheidende Phase. Für den 5. Dezember 2011 war eine Aufsichtsratssitzung der Charité angesetzt. Auf ihr sollte über die weitere Vergabe der Dienstleistungen, also auch über die Zukunft der CFM, entschieden werden. Sowohl der Vorstand der Charité als auch die neue Senatskoalition von SPD und CDU wollten vorher offensichtlich »Druck aus dem Kessel lassen« und den Arbeitskampf beenden. Die CFM-Geschäftsführung signalisierte Verhandlungsbereitschaft und zwei Tage vor der Aufsichtsratssitzung einigten sich die Geschäftsführung und die Tarifkommission auf ein Eckpunktepapier .
Der andauernde Ausstand, auch wenn er den Klinikbetrieb nicht lahm legen konnte, sorgte doch für beständige Unruhe an den Charité-Standorten. Die vielfältigen Aktionen auf der Straße steigerten den politischen Druck – auf die privaten Investoren und vor allem auf die Parteien der Senatskoalition. Die bundesweite, öffentliche Debatte über den Pflegenotstand, über miese Arbeitsbedingungen und Niedriglöhne verstärkte diesen Druck. Selbst CDU und FDP gaben angesichts der öffentlichen Stimmung ihr striktes »Nein« gegenüber einem Mindestlohn auf. Die Regierungsparteien streben eine Lösung an, bei der sich die Tarifparteien, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, über einen verbindlichen Mindestlohn einigen. Die SPD will dagegen auf parlamentarischer Ebene einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro verabschieden. Bei den Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge hat sich in der großen Senatskoalition in Berlin die SPD mit den 8,50 Euro durchgesetzt.
Mit dieser Kehrtwende wollen die Partein der schwarz-gelben Bundesregierung und des Berliner Senats vorbeugen. Über einen Mindestlohn soll im Einvernehmen mit den »Sozialpartnern« auf parlamentarischer Ebene entschieden werden. Dabei stören die Aktionen der streikenden CFM-MitarbeiterInnen, mit denen sie auf miese Arbeitsbedingungen und Niedriglöhne an den Krankenhäusern hinweisen. Dem Druck der Straße soll vorgebeugt werden.
Auch auf Seiten der CFM-Beschäftigten bestand die Bereitschaft das Eckpunktepapier anzunehmen. Sie hatten in den drei Monaten des Arbeitskampfe eine Beharrlichkeit und Kraft entwickelt, mit der niemand gerechnet hatte – die Gegner im Senat und an der Charité ebenso wenig wie sie selbst und ihre Unterstützer. Dennoch, die Streikenden stießen an eine Grenze, die sie aus eigener Kraft wohl nicht hätten überwinden können. Die Streikbeteiligung konnte nicht mehr ausgeweitet werden; die Organisierung überbetrieblicher Solidarität und begleitender Aktivitäten ließ sich kaum noch steigern. Auch materiell wirkte sich der Arbeitskampf aus, vor allem für die KollegInnen aus dem Niedriglohnsektor. Drei Monate statt des üblichen Lohnes die gewerkschaftliche Streikunterstützung – das hatte große Löcher in den privaten Haushaltskassen hinterlassen. Und Weihnachten stand vor der Tür, mit den entsprechenden Erwartungen von Ehepartnern und Kindern.
Auf höchster Ebene hatte sich zuletzt ver.di in den Tarifkonflikt eingeschaltet. Die Landesbezirksvorsitzende, Susanne Stumpenhusen, drängte in Vorgesprächen die verantwortlichen Politiker und Manager zur Aufnahme von Verhandlungen. Ellen Paschke (Bundesvorstand ver.di) und Frank Stöhr (Vorsitzender der DBB Tarifunion) übernahmen die Verhandlungsführung. Auch die Gewerkschaftsvorstände hatten ein Interesse, den Arbeitskampf beizulegen. Mit der Verpflichtung zur Aufnahme von Manteltarifverhandlungen wurde ihnen die Anerkennung als Tarifpartner in Aussicht gestellt. Ein erfolgloser Arbeitskampf hätte die gewerkschaftliche Stellung nicht nur bei der CFM und an der Charité untergraben; er wäre zu einem schweren Rückschlag für den gesamten Fachbereich auf Landes- und Bundesebene geworden.
Nicht nur die Angst vor den Konsequenzen einer Streikniederlage, sondern auch politische Befürchtungen dürften ein Grund für die Intervention der ver.di-Spitze gewesen sein.
Hinter vorgehaltener Hand wurde aus dem Berliner ver.di-Vorstand der Einfluss der SAV im Arbeitskampf kritisiert. Nicht allein die »Einmischung« ungeliebter linker Gruppierungen wird von den Gewerkschaftsvorständen mit Argwohn betrachtet. Die Mittel und Methoden der Streikführung und seine politische Ausrichtung drohten den sozialpartnerschaftlichen Rahmen gewerkschaftlicher Tarifpolitik zu überschreiten. Die Intensivierung und Politisierung des Streiks war eine Antwort auf die Kampfmethoden der CFM-Leitung und die monatelange Blockade einer Verhandlungslösung. Diese Blockade musste aufgelöst werden, damit die Gewerkschaft ihrer sozialpartnerschaftlichen Aufgabe nachkommen und den Konflikt entschärfen/befrieden konnte.
Ob mit dem erzielten Kompromiss ein Durchbruch gelungen ist, wird die Zukunft zeigen. Die Charité kann kein Interesse daran haben, dass ihr Spielraum zur Kostenreduzierung durch einen guten Tarifvertrag für die CFM allzu stark beschnitten wird. Und die Manager der CFM haben nie gelernt, ihre Überheblichkeit gegenüber den »normalen Mitarbeitern« unter einem sozialpartnerschaftlichen Mantel zu verbergen. Allerdings sind die KollegInnen – gestärkt durch ihren gewerkschaftlichen Kampf und mit neuen politischen Erkenntnissen – an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Die ver.di-Betriebsgruppe hat durch den Streik Zulauf erhalten. Der »Streikkurier« soll als regelmäßige Publikation der Betriebsgruppe fortgeführt werden. Das sind gute Voraussetzungen für die anstehenden Tarifverhandlungen bei CFM und mögliche Verhandlungen an der Charité selbst. Ver.di strebt an, im Rahmen der Kampagne »Der Druck muss raus« die Arbeitsbedingungen an den Krankenhäusern tarifvertraglich zu regeln. Die gewerkschaftlichen Betriebsgruppen bei CFM und an der Charité wollen in enger Abstimmung in kommende Auseinandersetzungen gehen.
23. Februar 2012 | Dieser Text wurde in der Zeitung Arbeiterpolitik Nr.1/2012 abgedruckt.