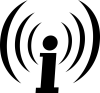Daniel Atzori
Das Interesse arabischer und muslimischer Intellektueller an Gramscis Denken ist kein neues Phänomen. In der Tat hat Gramsci einige Grundbegriffe geliefert, um die dramatischen politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte in arabischen Gesellschaften, zumal in Ägypten, zu analysieren. Gerade heute ermöglicht uns Gramsci, die Aufstände in der arabischen Welt mit anderen Augen zu sehen.
In seiner klassischen Studie Overstating the Arab State (1996) erklärte der Ägypter Nazih Ayubi die Fragilität der arabischen Regime damit, dass sie zwar fein verästelte Strukturen zur systematischen Unterdrückung des Dissenses entwickelt hätten, nicht jedoch in der Lage waren, wirksame Instrumente zur Produktion des Konsenses zu schaffen – was Althusser ideologische Staatsapparate nannte. Anknüpfend an Gramsci war Ayubi der Meinung, die Elite an der Macht hätte zwar die Dimension der Herrschaft ausgebaut, ohne indes eine wirkliche intellektuelle und moralische Führung auszuüben. Diese strukturelle Schwäche der arabischen Regime hatte islamistischen Bewegungen wie den Muslimbrüdern erlaubt, gegenhegemoniale Projekte zu initiieren, etwa in Ländern wie Ägypten und Jordanien, und dabei Sprache und Symbole des Islam zu benützen, um den Islamismus als politische Ideologie zu artikulieren.
In seinem Buch Making Islam Democratic (2007) hatte der Iraner Asef Bayat, gefolgt von dem Ägypter Hazem Kandil, die Strategien der ägyptischen Muslimbrüder als einen auf die Eroberung der »Kasematten« der Zivilgesellschaft gerichteten »Stellungskrieg« interpretiert. Tatsächlich hatten die Muslimbrüder es geschafft, nicht nur ein Netz von Krankenhäusern, Schulen und gemeinnützigen Aktivitäten zu knüpfen und so zugleich eine moralische und ideologische Gemeinschaft aufzubauen, sondern auch einen privaten islamistischen Sektor zu begründen. In den letzten Jahrzehnten waren die islamistischen Bewegungen in der Lage, nachhaltige Prozesse einer Re-Islamisierung auch in vielen islamischen Ländern außerhalb der arabischen Welt, wie der Türkei, Malaysien und Pakistan, einzuleiten.
In einigen arabischen Gesellschaften, wie der ägyptischen und jordanischen, ist es den Muslimbrüdern darüber hinaus gelungen, einen »geschichtlichen Block« zu konstruieren, indem sie sich an zwei sozial grundlegend unterschiedliche, hinsichtlich des Regimes jedoch gleichermaßen enttäuschte Schichten wandten: die neue islamistische Bourgeoisie und das städtische »Lumpenproletariat«. Die Führung der Muslimbrüder, die Ausdruck einer islamistischen Bourgeoisie ist, deren Aufstieg im Zusammenhang der neoliberalen Veränderungen innerhalb der vergangenen dreißig Jahre zu sehen ist, hat mit dem städtischen Subproletariat eine Manövriermasse entdeckt.
Auf der Grundlage von Gramscis Überlegungen zu Parteimodellen erscheinen die Islamisten als diejenigen, die den Massen ein goldenes Zeitalter vor Augen halten, in dem alle Spannungen und Widersprüche ihre Lösung gefunden haben werden – dank des Islam. Indem die Islamisten sich den Mythos (im Sinne Sorels) von der zu schaffenden islamischen Gesellschaft auf die Fahne hefteten, haben sie die geschichtliche Wirklichkeit der Produktionsverhältnisse verdunkelt und dadurch den Konflikt vom Feld der sozioökonomischen Ausstattung auf das der Kultur im weiten Sinne verschoben.
Das islamistische gegenhegemoniale Projekt hat also keineswegs die sozioökonomischen Verhältnisse in Frage gestellt, auf denen die arabischen Gesellschaften beruhen. Das Ziel der Muslimbrüder und der neuen und dynamischen Mittelklassen, deren Ausdruck sie sind, besteht darin, die führende Klasse zu werden, nicht darin, die Produktionsverhältnisse zu verändern, trotz der populistischen Appelle an die soziale Gerechtigkeit.
Nach Ayubi reagierte Mubarak auf die Herausforderung durch die islamistische Bewegung mit einer »passiven Revolution«. Das Regime hat in der Tat eine umfassende Strategie der Kooptation und Repression praktiziert und dabei den Islamisierungsprozess unterstützt unter der Voraussetzung, dass dieser zu keiner wirklichen Veränderung des Status quo führte. Insofern kam es zu Übereinstimmungen zwischen dem Stellungskrieg der Muslimbrüder und der vom Regime verfolgten passiven Revolution; Samir Amin hat daher Recht, wenn er die Muslimbrüder als eine tendenziell reaktionäre Kraft einschätzt. In den letzten Monaten haben die arabischen Revolten zum Fall Ben Alis in Tunesien und von Mubarak in Ägypten geführt, außerdem zu einer Reihe von Volksaufständen; doch kann man, zumindest bislang, von Revolutionen sprechen?
Ben Alis und Mubaraks Entmachtung ähneln eher Staatsstreichen, die von Regimen durchgeführt werden, um Revolution zu verhindern, nicht zu ermöglichen. In Ägypten scheinen die Militärs verstanden zu haben, dass – um eine wirkliche Veränderung der sozio-ökonomischen Grundlagen zu verhindern – es jetzt darauf ankommt, sich mit den Muslimbrüdern zu verbünden und so einen Ordnungsblock zu bilden. Die Militärs und die Muslimbrüder repräsentieren verschiedene Sektoren der ägyptischen Bourgeoisie, sind sich jedoch darin einig, eine wirkliche Teilhabe der Volksmassen an der Verwaltung des Gemeinwesens verhindern zu wollen. Die Muslimbrüder haben seit Jahren lautstark Demokratie gefordert. Tatsächlich hätte die Demokratie ihnen erlaubt, den Stellungskrieg innerhalb des demokratischen Prozesses umfassend zu führen.
Jetzt aber können sie direkt mit dem alten Regime verhandeln, und es ist nicht gesagt, dass die Demokratisierung für sie weiterhin Vorrang hat. Obwohl der islamistischen Bewegung keine tragende Rolle in der Mobilisierung gegen Mubarak zukam, kann sie noch immer auf ein dicht geknüpftes Netz von Institutionen zählen. Die Muslimbrüder stellen sich darauf ein, dass sie in nächster Zukunft eine bedeutendere Rolle spielen werden, doch sie sind selbst tief gespalten: Während die einen mit Interesse auf die türkische AKP schauen, pflegen die anderen eine unnachgiebigere und radikalere Auffassung.
Die Protestbewegungen in Ägypten und anderswo bezahlen jetzt ihre mangelnde organisatorische und ideologische Vorbereitung. Ihr flüssiger und spontaner Charakter droht sich in dem Moment in einen Nachteil zu verwandeln, in dem es darum geht, eine neue gegenhegemoniale Herausforderung zu artikulieren und eine wirkliche Alternative vorzuschlagen.
Im 18. Brumaire analysiert Marx, wie die großartigen Volksrevolutionen von 1848, die die Hoffnungen der Demokraten und Sozialisten in ganz Europa angefacht hatten, dem Autoritarismus des Louis Bonaparte, der sich dann Napoleon III. nannte, den Weg geebnet haben. Die Absetzung Louis-Philippes, des Königs der Franzosen, hatte einen erbitterten Kampf zwischen den verschiedenen Interessengruppen der französischen Bourgeoisie ausgelöst. Die pariser Volksmassen, die zunächst eine bedeutende Rolle im Aufstand gegen die orleanistische Monarchie gespielt hatten, wurden in der Folge an den Rand gedrängt. Die brüchige Zweite Republik, die von der Februarrevolution bis Dezember 1851 bestand, hat lediglich dem Bonapartismus Napoleons III. das Feld bereitet.
Entsprechend ist das Hauptproblem der arabischen Aufstände das Fehlen eines »modernen Fürsten« (vgl. Gramsci, Gefängnishefte, H. 8, §21), d.h. eines politischen Subjekts, das in der Lage wäre, einen neuen Kollektivwillen zu schmieden und dem Versuch des Ordnungsblocks entgegenzutreten, die Massen zu entpolitisieren, die sich in den vergangenen Monaten erhoben haben.
Viele der jungen Leute des Tahrir-Platzes leiden – wie die Intellektuellen des italienischen Risorgimento, von denen Gramsci spricht – an einem oberflächlichen Kosmopolitismus, der ihnen jede Möglichkeit nimmt, auf authentische Weise »popular-national« zu werden. Diese jungen Leute haben oft in prestigereichen Universitäten, wie der Amerikanischen Universität Kairo, studiert und verfügen über ein erträgliches Auskommen, unterhalten aber kaum Beziehungen zum »Lumpenproletariat « der Kairoer Elendsviertel (ashawwiyyat) oder zur Landbevölkerung.
Die Islamisierung des »Lumpenproletariats« in den vergangenen Jahrzehnten ist auch wegen der Distanz möglich geworden, die sich zwischen der laizistischen, liberalen oder sozialistischen bzw. kommunistischen Elite und der Masse der Entrechteten aufgetan hat. Um zu einem authentischen popular-nationalen Willen zu kommen, hielt Gramsci es dagegen für grundlegend, dass die Massen, dank der intellektuellen und moralischen Führungsrolle des modernen Fürsten, ins politische Leben eintreten. Eine gramscianische Analyse legt also die Hegemoniekrise offen, die sowohl die Regime wie die islamistische Bewegung betrifft, aber auch die Schwierigkeiten, die sich der Artikulation neuer Projekte in den Weg stellen.
»Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.« (H. 3, §34, 354)
Die Gewalt der Militärs, die Spannungen zwischen den Religionen und die von den Salafiten ausgelösten Wellen der Gewalt gehören zu den Krankheitserscheinungen dieses heiklen Interregnums.
Gramscis Hauptbeitrag zum Marxismus und, allgemeiner, zur politischen Theorie besteht in der Dekonstruktion der Interpretationen, die den Marxismus auf einen positivistischen Mechanizismus reduzierten. Nach Gramsci kommt es nicht wegen der unheilbaren Widersprüche des Kapitalismus automatisch zur Revolution, sondern allein aufgrund der politischen Artikulation eines neuen hegemonialen Projekts.
Dies brachte Laclau und Mouffe dazu, in Gramscis Begriff der Hegemonie »die zentrale Kategorie der politischen Analyse« auszumachen (vgl. Hegemony and Socialist Strategy, 2001). Dass die arabischen Revolten Prozesse angestoßen hätten, die automatisch zu gerechteren und demokratischeren Gesellschaften führen – diese Annahme ist daher illusorisch. Es ist an den Arabern, durch das Schmieden neuer Hegemonien ihr eigenes Schicksal wieder in die Hände zu nehmen und so die Freiheit wiederzugewinnen, die ihnen verweigert worden ist.
Aus dem Italienischen von Peter Jehle
Die Printversion ist erschienen in: Das Argument 293 (4/2011), »Was kann Kunst?«, S. 491-93