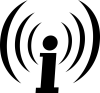Interview mit Stéphane Hessel von Roland Merk
Der Freitag: Vom Tahrir-Platz über die Wall Street, von Griechen- land über Spanien und Deutschland entrüstet man sich und geht auf die Straße. Vor einem Jahr ist Ihr kleines Buch Empört euch! erschienen. Haben Sie mit dieser Welle der Empörung in den arabischen und westlichen Ländern für das Jahr 2011 gerechnet oder sind Sie überrascht?
Stéphane Hessel: Ich bin völlig überrascht und nehme gleichzeitig zur Kenntnis, wie sehr wir in diesem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in einer unsicheren Welt leben. Wir wissen alle, dass wir uns in einer großen wirtschaftlichen Krise befinden, viele Leute fühlen sich davon bedrängt. Wenn man ihnen dann sagt, ihr sollt euch empören, weil eure Würde verletzt ist, dann horchen die Leute auf. Natürlich genügt es nicht, die Menschen aufzufordern, sich zu empören. Man muss ihnen auch sagen, welche großen Gefahren vor ihnen stehen, die es rechtfertigen, dass sie sich empören. Schließlich kam ein paar Monate, nachdem mein Büchlein veröffentlicht worden war, der Arabische Frühling. Zunächst waren es die Aufstände in Tunesien und Ägypten, dann in Libyen, dann im Jemen und in Syrien. Es gibt in einigen Ländern an der Mittelmeerküste ein großes Bedürfnis, anders regiert zu werden, als es bis jetzt der Fall war.
Erleben wir den Vorabend einer globalisierten Empörung angesichts der Zustände weltweit?
Ja, die Zustände in dieser Welt leiten sich von etwas Gemeinsamem ab. Es ist einerseits die Übermacht der Finanzmächte, andererseits auch eine Macht, die unkontrolliert ist. Viele Leute sagen sich, dass sie nicht mehr auf ihre Regierung zählen können, weil die sich nicht gegen diese Finanzmächte verteidigen und sich nicht aus der Krise manövrieren können. Das verweist auf etwas Globales. Daher ist diese Empörung nicht nur in Diktaturen wie Tunesien und Ägypten vorzufinden, sondern auch in demokratischen Ländern wie Griechenland oder Spanien.
In einer „Solidarity Letter from Cairo“ schreiben die Leute vom Tahrir-Platz an die Bewegung „Occupy Wall Street“ in den USA: „Eine ganze Generation über den Globus verstreut ist in dem Gefühl aufgewachsen, emotional wie rational keine Zukunft zu haben angesichts der aktuellen Ordnung der Dinge.“ Eine Realität, die mit der Krise in Europa sowie einer vorherrschenden Sparpolitik nun auch im Westen ankommt. Was denken Sie darüber?
Ich denke, das ist das Wesentliche. Unsere Probleme sind nicht mehr national zu lösen, weder in Tunesien und Ägypten noch in Europa. Selbst die Hoffnung, dass die EU stark genug sein würde, die Probleme ihrer Mitgliedsstaaten zu lösen, schwindet weiter. Was in Griechenland geschieht, was in Italien oder Spanien passieren kann, hängt von einer Weltordnung ab. Die beiden großen Gefahren, die diese Weltordnung untergraben, sind der zu große Reichtum und eine unerhört große Armut. Der Slogan „We are the 99 percent“ der Demonstranten auf der Wall Street in New York spielt darauf ja an. #
Aber ist es nicht erstaunlich, dass die Leute vom Tahrir-Platz mit denen von der Wall Street kommunizieren, während der Westen bis jetzt nur vom „Clash of Civilizations“ sprach und scheinbar aufgeklärte und doch so islamophobe Kreise eine ganze Weltreligion in Verruf gebrachten haben?
Aber das verändert sich jetzt – der „Clash of Civilizations“ ist nicht mehr aktuell. Nehmen Sie das Beispiel der bei den Wahlen siegreichen Ennahda-Partei in Tunesien. Sie will keinen Islamismus, sondern eine islamische Demokratie.
2011 brachte insofern zwei große Widerlegungen des Westens mit sich. Zunächst widerlegten die tunesische und die ägyptische Revolution Vorurteile gegenüber dem Islam, die seit 9/11 kursierten. Dann wurde mit Fukushima auch unser technischer Machbarkeitswahn widerlegt. Wird der Westen aus seiner Selbstgerechtigkeit gerissen?
Er muss sich jedenfalls darauf vorbereiten, im Konzert der großen Spieler einer unter anderen zu sein. Das bringt auch eine neue Perspektive für die westlichen Werte, die wir verteidigen müssen, aber dies nur können, wenn wir sie mit anderen Kulturen zusammenbringen. Das Gute am Arabischen Frühling ist, dass er sich nicht auf eine rein islamische Zukunft stützen, sondern Islam und Demokratie vereinen will. Das bedeutet für uns – falls wir gut zuhören können, was sich die islamische Welt wünscht –, dass wir gemeinsam den demokratischen Weg einschlagen können.
Noch Tage vor dem Umbruch hieß der tunesische Diktator in Frankreich „Mon Ami Ben Ali“! Man fragt sich, wie glaubwürdig das Verhalten des Westens für die Araber insgesamt ist?
Wir müssen von der Angst wegkommen. Wir haben seit 9/11 in einer Welt gelebt, in der wir vor dem Islamismus und vor al-Qaida Angst hatten. Die islamischen Länder erschienen für uns gefährlich, weil wir uns sagten, sie könnten sich ja al-Qaida zuwenden. Die Devise war: Es ist schon besser, wir haben da Tyrannen, mit denen wir uns gut verständigen können, wenn wir sie auch nicht besonders lieben. Aber sie sind allemal besser als dieser Sturm des Islamismus.
Das ist die fürchterliche Angst, der wir jetzt entkommen müssen. Sie ist nicht mehr gerechtfertigt. Wir haben leider noch zwei Länder, die uns Angst machen: Iran und Syrien. Bei denen sagen wir noch: Gegen die müssen wir kämpfen. Gott sei Dank haben wir Israel als ein starkes Land, das uns dabei hilft – aber diese Überzeugung hat sich erschöpft. Wir müssen verstehen, dass die Gefahr nicht darin besteht, dass im Iran immer noch die Gefolgschaft des einstigen Revolutionsführers Khomeini an der Macht ist, sondern dass wir keine richtigen Beziehungen mit islamischen Länder haben können, solange wir nicht einräumen, dass sie islamisch, aber dennoch demokratisch sein können.
Frankreichs Außenminister Juppé hat erklärt, nun sei es an der Zeit, einen „komplexfreien Dialog mit den islamischen Strömungen zu führen“. Kam diese Einsicht zu spät? Französische Soziologen haben schon lange darauf verwiesen, dass im moderaten Islam ein wirtschaftlicher Faktor auszumachen ist, der mit dem vergleichbar sei, was einst der Protestantismus für den europäischen Kapitalismus war.
Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir haben Indonesien und die Türkei als gute Bespiele für islamische Länder, in denen man bestrebt ist, sich demokratisch zu entwickeln. Das ist es, was wir verstehen müssen. Da hat Juppé ganz recht! Aber man muss auch sagen, dass der Islamismus sehr gefährlich werden kann, solange Armut mit im Spiel ist. Wir haben eine große Verantwortung, aber wir sind nicht mehr die allein Verantwortlichen. Auch China und Indien sind mitverantwortlich. Und wir haben eine Institution, wo alle diese Verantwortungen gebündelt werden und zur Sprache kommen können – das sind die Vereinten Nationen. Das setzt ein Verständnis der verschiedenen Kulturen voraus und Respekt, um die Werte in Einklang bringen zu können.
Während des Kalten Krieges waren wir alle Berliner und nach dem 11. September 2001 alle Amerikaner. Werden wir wegen des Arabischen Frühlings jemals alle Araber sein, wenn wir zugleich in einer Zeit der Islamophobie leben? Nehmen wir nur das Verhalten der Schweizerischen Volkspartei, die Minarette zu bedrohlichen Raketen erklärt hat. Sind Sie alarmiert?
Alarmiert bin ich sehr und frage mich: Wer ist schuld daran? Vielleicht das Erziehungswesen der westlichen Gesellschaften, dem viel daran gelegen ist, dass man der Bessere sein soll, dass man der Stärkere sein muss. Ich spreche immer von „Gemüt“, und es gibt ein egozentrisches Gemüt, das sich gerade in den vergangenen Jahrzehnten verbreitet hat.
Wir erleben, wie die Allgemeinheit die Finanzkrise zu tragen hat. Was würden Sie in einem solchen Moment „Occupy Wall Street“ mit auf den Weg geben?
Natürlich könnte ich ihnen sagen, dass man von der Welthandelsorganisation strukturelle Reformen fordern sollte, die darauf zielen, den ärmeren Ländern ein wirtschaftliches Vorwärtskommen zu ermöglichen. Und wenn die Aktivisten sagen, wir brauchen keine Instrumente, wir brauchen keine Parteien, wir bleiben unter uns und empören uns, dann genügt das nicht. Man muss sie überzeugen, dass sie ihre Dynamik und Energie dort einbringen sollen, wo es die Möglichkeit gibt, vorwärtszukommen.
Gleichzeitig wird jungen Menschen die Zukunft genommen, denken wir nur an Griechenland …
… deshalb brauchen wir ja eine Umverteilung der Reichtümer. In allen Ländern gibt es Leute, die einfach zu viel haben. Wir brauchen eine bessere Steuerpolitik, auch wenn es nicht nur um Steuern geht, sondern auch darum, wofür wir Geld ausgeben: für Waffen, für Drogen, für die Kernkraft. Wir brauchen so etwas wie einen wirtschaftlichen Sicherheitsrat, den sich Gorbatschow schon gewünscht hat, damit wir der jungen Generation das Gefühl geben, dass es auch anders werden kann, und die Überprivilegierten ihre Privilegien verlieren, wie es im Zuge der Französischen Revolution der Fall war.
Leben wir in einer Welt, die ihr Fortbestehen nicht mehr garantieren kann?
Mein Optimismus besagt nur eines: Unsere Menschheit hat in den vergangenen Jahrhunderten schon viele schlimme Situationen überlebt. Unsere ganze Geschichte ist voll von Kampf, Krieg und Zerstörung. Trotzdem sind wir vorwärtsgekommen und haben vieles überwunden, was schwer zu überwinden schien. Heute stehen wir vor einer besonders schwierigen Situation. Das Problem ist: Wir werden die Welt nicht weiter so bewirtschaften können. Wir werden zu viele sein, um uns noch genügend ernähren zu können. Viele Gefahren stehen uns bevor. Ich bin nicht so optimistisch, dass ich sagen würde, diese Gefahren sind leicht zu überwinden. Aber ich bin optimistisch genug zu sagen, das gerade weil sie sehr schwer zu überwinden sind, die Beteiligung aller gebraucht wird, der jüngeren und älteren Generationen. Wir müssen uns herausfordern, um zu sehen, welche neuen Möglichkeiten das Gemüt des Menschen hat, die es ihm ermöglichen, gerade solche Gefahren zu überwinden. Mein Optimismus zeigt mir an, dass es ein Potenzial in uns gibt, das wir noch nicht ausgeschöpft haben.
Sie sind Lyriker. Nach so viel Prosa in unserem Gespräch – sollte besser die Poesie an die Macht kommen?
Das klingt ein bisschen abstrakt. Aber Poesie stammt ja vom griechischen Verb poein ab, und das bedeutet schaffen. Mein Büchlein Empört euch! sagt an einer Stelle: „Neues schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues schaffen.“ Wir haben diese Möglichkeit in uns. Damit können wir neue Verhältnisse schaffen. Wir können gegen die alte Menschheit widerstehen und eine neue auf den Weg bringen, um eine neue Welt zu erschaffen.
Das hieße: Nur die, die nicht wissen, was ein Anfang ist, fürchten das Letzte?
Ja, genau.
Hintergrund
Stéphane Hessel, 94 Jahre alt, Überlebender des KZ Buchenwald, Diplomat und Lyriker, eroberte mit seinen beiden Streitschriften Empört euch! und Engagiert euch! im zurückliegenden Jahr die Herzen der Bürger weltweit. Beide Bücher verzeichnen inzwischen ein Auflage von mehr als einer Million Exemplaren. Der Autor kritisiert in seinen Pamphleten nicht nur Auswüchse des Finanzkapitalismus, sondern auch die fremdenfeindliche Stimmung in vielen Staaten Europas.
Das Gespräch führte Roland Merk.
Roland Merk ist Schweizer Schriftsteller und hat soeben das Buch "Arabesken der Revolution. Zornige Tage in Tunis und Kairo vorgelegt", das eine literarische Zusammenarbeit von tunesischen, ägyptischen und europäischen Schriftstellern zum Arabischen Frühling darstellt. Edition 8, Zürich 2011