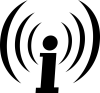"Unser größtes Schreckgespenst ist die Privatisierung": In Kopenhagen feiert die Freistadt Christiania bald 40-jähriges Bestehen – und kämpft mit sich und ihren Gegnern
Er ist damals einfach dageblieben. Klaus Naver gefiel das freie Leben – und ihm gefiel eine Frau. Die Frau war irgendwann wieder weg, aber Naver blieb trotzdem in Christiania. Vor 18 Jahren hat er als Wandergeselle aus Nürnberg im "Bananahus" Station gemacht, nun ist er dort so etwas wie der Herbergsvater. Das Bananenhaus, das wegen seiner Form diesen Namen trägt, ist heute noch immer Anlaufstelle für deutsche Handwerksgesellen auf Wanderschaft. Naver – ein kleiner Mann mit sanfter Stimme und melancholisch blickenden Augen – hat sich im Erdgeschoss in vielen Arbeitsstunden seine Wohnung ausgebaut, einen lichtdurchfluteten, gemütlichen Raum.
Christiania sei eigentlich keine Gemeinschaft, sondern ein "Minimal-Staat", sagt er. Es habe sich vor knapp 40 Jahren nicht eine Gruppe von Leuten gezielt zu einem gemeinsamen Projekt zusammengefunden, sondern ein Vakuum sei gefüllt worden. 1971 hatte ein buntes Völkchen ein verlassenes Militärgelände in Kopenhagen besetzt. Damals herrschte Wohnungsnot. Die Besetzer nannten die 34 Hektar große Fläche "Freistadt Christiania" und propagierten ein Leben nach streng basisdemokratischen Regeln. Diese gelten bis heute, auch wenn Christiania längst weniger anarchisch, dafür besser organisiert ist.
In der Freistadt gibt es überzeugte Polit-Aktivisten, Hausbesetzer, Esoterikhippies, Haschhändler, Obdachlose, Alkoholiker und eine "ganze Reihe individualistischer Handwerker", zählt Naver auf. Von Anfang an kämpfte Christiania auch mit den Widersprüchen und Konflikten, die bei so unterschiedlichen Bewohnern nicht ausbleiben. Er kenne Hausbewohner, sagt Naver, die nichts gegen einen Grundbucheintrag für ihre Immobilie hätten. Damit würden sie aber eine zentrale Regel außer Kraft setzen: Dein Haus gehört dir nur so lange, wie du es bewohnst! Wenn das nicht mehr gilt, würde Christiania den Weg vieler Hausbesetzerprojekte gehen – vom Widerstand gegen die Eigentumsverhältnisse zum Arrangieren mit den Verhältnissen.
Die Christianiter, so nennen sich die Freistadt-Bewohner selber, zahlen keine Miete an den Staat, den Grundeigentümer, sondern eine monatliche Abgabe an die Gemeinschaft. Je professioneller und komfortabler das Leben hier wurde, desto höher wurden auch die Abgaben, die jeder in die Gemeinschaftskasse zahlen soll. Derzeit sind es 2.300 dänische Kronen, etwa 300 Euro. Der Betrag enthält Strom- und Wasserkosten, nicht aber Heizung, Gas und Hausinstandhaltung. Und er ist für alle gleich hoch, Christiania fragt nicht nach dem privaten Vermögen seiner knapp 900 Bewohner. Wer wieviel bezahlt hat und wer der Gemeinschaft noch etwas schuldet, ist minutiös in einer Tabelle aufgelistet, die regelmäßig in der Postille Ugespejl veröffentlicht wird. Totale Transparenz ist das Ziel. Mit dem Geld werden etwa das Baubüro, der Kindergarten und der Jugendclub finanziert.
Karsten Schobmann, auch ein Deutscher, den Christiania angezogen hat, gehört zum fünfköpfigen „Byggekontor“. Das Baubüro plant Abwasserleitungen, repariert Dächer, stellt Recycling-Stationen auf – und gäbe es keinen Baustopp, würde es auch gern Neubauten errichten. "Wir dürfen uns nicht ausbreiten", klagt Schobmann. "Dabei zahlen wir Steuern an den Staat, haben Lokale und Betriebe hier ordnungsgemäß angemeldet und entsorgen die von den Altlasten des Militärs verseuchte Erde auf unsere Kosten."
Unter Schobmanns Baseballcap lugt ein grauer Haarschopf hervor. Der 53-Jährige erzählt gern vom rauen Charme der Gründerzeit. "Wenn ich dran denke, wie ich 1978 hier ankam: Zuerst habe ich als Klo ein Loch in die Erde gegraben und mit einem Kanister Wasser aus ein paar hundert Meter Entfernung geholt. Strom hatten wir keinen. Kerzen und Öllampenlicht – damit kommt man eine Zeit lang klar, aber ein Leben lang Campingplatz ist nicht der Hit."
Schobmann führt den Besucher auf den begrünten Wall, der die Freistadt umgibt. Man sieht das Badehaus und die Fahrradmanufaktur. Dazwischen ein paar Verbindungsstraßen und ein verwinkeltes Netz von Pfaden. Fahrradfahrer mit Kinderanhänger ziehen vorbei, Lasträder mit großer Ladefläche, zusammengeschraubt vom Betrieb Christiania Bikes. Die Fahrräder sind ein internationaler Verkaufsschlager.
Die Autos parken außerhalb
Selten sieht man hier ein Auto. Wenn, ist es meist ein Lieferant, der das Bio-Sortiment des Einkaufsladens auffüllt. Seit Kurzem hat Christiania aber auch einen eigenen Parkplatz. Denn einer dieser seltsamen Christiania-Widersprüche ist: 137 Autos sind auf die Bewohner der autofreien Freistadt zugelassen. Die meisten Autos parken in langer Reihe gleich außerhalb der Grenzen der Enklave. "Wir zahlen Steuern", so die Begründung der Autofahrer, "arbeiten oft in der Stadt – warum sollen wir keine öffentlichen Flächen benutzen?"
Auch weil die Autos draußen bleiben, wirkt Christiania zunächst wie ein grünes Idyll. Ein einmaliges Grundstück mit direktem Wasserzugang, ruhig und zentral gelegen. Manche Häuser haben sogar Architekturpreise gewonnen. Hier einen Platz zum Wohnen zu ergattern, ist nicht leicht. Mal bewerben sich 25, mal 100 Leute auf eine Wohnung. Die 26-jährige Rose hat fast ihr ganzes Leben hier verbracht. Die Dänin bewohnt mit ihrem 16 Monate alten Kind ein schmuckes Häuschen im Bezirk Löwenzahn. Sie wohne eigentlich gern hier, weil sie alle in ihrer Umgebung persönlich kenne. Dennoch denkt sie übers Wegziehen nach: "Die rauen Zustände in der Pusher Street stören mich, es gibt einen richtigen Bandenkrieg. Und ich mag nicht, dass mir Touristen zum Fenster hineinschauen."
Wenn von Christianias Problemen die Rede ist, dann wird immer die Pusher Street genannt. Den Straßenzug mit seinem offenen Drogenhandel gibt es schon seit der Gründung der Freistadt. Aber vor zehn Jahren wurde dort noch kein Krieg ums Territorium geführt. Ein Krieg, dem die Christianiter – ebenso wie die Polizei – hilflos ausgeliefert scheinen. Erst im Sommer wurde auf offener Straße auf einen Drogenhändler geschossen. Die Nervosität in der Pusher Street ist greifbar. Auf Tischchen bieten Dealer Hasch-Päckchen an. Wer sich nähert, ohne sofort etwas zu kaufen, wird feindselig angeschaut. Die No-Photo-Zeichen sind unübersehbar. Halbwüchsige Aufpasser schreiten ein, sobald sie ein Foto-Handy gezückt sehen.
Nichts für alte Leute?
Natürlich ist auch der Drogenhandel in Christiania ein Grund dafür, dass die konservative dänische Regierung an ihrem Vorhaben festhält, die Freistadt zu "normalisieren". Es geht um Privatisierung, geregelte Mietverhältnisse, Eigentumswohnungen. Zuständig ist dafür die Eigentumsverwaltung, eine Ausgliederung des dänischen Finanzministeriums. Die Agentur residiert in einem schmucken Altbau in der Nähe des Kopenhagener Rathauses. "Viele der selbst erbauten Häuser sind sehr charmant und dekorativ, aber primitiv", sagt die Juristin Charlotte Hoedt-Madsen. "Sie sind unpassend für Leute, die über 70 Jahre alt sind – was durchaus passieren kann, da Christiania bald 40 Jahre alt wird." Hoedt-Madsen gibt zu, dass es aber für viele Bewohner ein Problem sein würde, dort zu bleiben, wenn sie erst eine reguläre Miete zahlen müssten.
Klaus Naver, der ehemalige Wandergeselle, ist auch deshalb misstrauisch gegenüber Verhandlungen mit dem Staat: "Es hat etwas mit Neid zu tun. Damit, dass wir armen Arschlöcher in der ersten Reihe sitzen. Wir sollen da sitzen, wo wir hingehören." Grimmig fügt er hinzu: "Unser größtes Schreckgespenst ist die Privatisierung, dann wäre Christiania tot. Das ist das begehrteste Stückchen in ganz Kopenhagen."
Und zugleich eine der größten Touristenattraktionen Dänemarks, ein Markenzeichen für Toleranz, Graswurzelkultur und alternativen Lebensstil. So sieht es auch Knud Foldschack, der bekannteste Anwalt links-alternativer Klienten im Lande. Foldschack residiert im obersten Stock eines Altbaus in Kopenhagen. Hinter seinem Schreibtisch eine Wand mit Akten, das oberste Regal ist der Christiania-Prozess.
Foldschack passt die Richtung der Regierung nicht. "Das ist Wahnsinn", sagt er in dänisch gefärbtem Deutsch. "Der Staat will, dass jeder die Chance haben soll, in Christiania zu wohnen." Das klinge erst einmal wie ein nachvollziehbarer Anspruch. Foldschack sieht das aber anders: Um dort zu wohnen, müsse man die richtige Einstellung mitbringen. Der Anwalt hat den Prozess Christiania gegen den Staat vor dem Landgericht 2009 allerdings verloren. Die Richter urteilten, dem Staat stehe das Nutzungsrecht für Christiania zu. Foldschack ist in Berufung gegangen, das Urteil des Obersten Gerichtshofs wird im März 2011 erwartet.
Bis dahin geht das Leben in Christiania seinen geruhsamen Gang. Das könne sich aber schnell ändern, warnt Karsten Schobmann. Er werde nicht tatenlos mit Ansehen, wenn sein Lebenswerk zerstört werde: "Wenn hier ein Pfahl rausgerissen wird, brennen die Straßen."