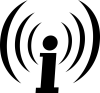Dem Staat fällt es schwer, eine klare Grenze zu Linksextremisten zu ziehen. Ihre Treffpunkte werden oft geduldet – die Szene jedoch verschließt sich jeder Kooperation mit den Behörden. Und die drücken gern ein Auge zu.
Dieser Text über gefährliche Nähe zu Gewalt beginnt nicht dort, wo gerade noch ein Steinhagel niederprasselte und Beine mit Präzisionszwillen durchlöchert wurden. Also nicht im Hamburger Schanzenviertel. Auch nicht in der Berliner Rigaer Straße, wo Pflastersteine durch Fensterscheiben in Kinderzimmer flogen. Und zu Beginn soll auch Leipzig nicht interessieren, wo im Stadtteil Connewitz innerhalb weniger Minuten eine Polizeistelle kurz und klein geschlagen wurde, weil der Staat, so die Angreifer, hier nichts zu suchen habe.
Nein, dieser Text beginnt im Hohen Haus dieser Republik. Im Bundestag. Da, wo die parlamentarische Demokratie des Landes ihre Heimat hat. Zwei Jahre ist es her, da debattierten die Abgeordneten über die „Vorkommnisse in Frankfurt anlässlich der Einweihung der EZB-Zentrale“. Kurz zuvor waren Tausende Chaoten durch die Bankenstadt gezogen. Sogar eine Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge griffen sie an. Bei der anschließenden Debatte im Bundestag bemühten sich alle um Distanzierung von der Gewalt. Und doch fiel oftmals dieses Wort, das die Verurteilung relativiert und stattdessen nach Verständnis klingt: Aber. Ein beliebter Satz lautete: Aber die meisten hätten doch gewaltfrei protestiert.
Von der Debatte im Bundestag zum Rauch in Hamburgs Straßen zieht sich ein roter Faden. Nach wie vor tolerieren Teile der Gesellschaft einen Nährboden, aus dem immer wieder pure Gewalt hervorschießt. Die Abgrenzung zur extremistischen Linken scheint, das machen diese Tage deutlich, weitaus weniger selbstverständlich als zur Rechten.
Normale Bürger laufen bei einer Demonstration mit dem eindeutigen Titel „Welcome to Hell“ mit – Willkommen in der Hölle. Die radikalen und militanten Gruppen hinter dem Protestzug erklären nach den Hamburger Chaostagen, zielgerichtete Militanz sei Option und Mittel. Die Interventionistische Linke, die laut Verfassungsschutzbericht als „Scharnier“ zwischen militanten und nicht gewaltorientierten Gruppen fungiert und deren Einstellung zur Gewalt taktisch geprägt sei, meint auch nach mehr als 500 Verletzten, im Zweifel stehe man als linksradikales Bündnis den Militanten näher als der Polizei – das ist das Gegenteil einer Distanzierung.
Und sicherlich stellt sich daher umso mehr die Frage, was der Staat dulden soll, wo er die Grenze nach Linksaußen ziehen muss und wie er verhindern kann, dass sich Szenen wie in Hamburg wiederholen.
Vor allem Vertreter der Union wollen Hotspots der linken Szene dichtmachen. Null Toleranz, lautet das Motto. Auch wenn man bislang wenig über die Täter von Hamburg weiß, wie politisch oder unpolitisch sie waren, so herrscht bei vielen die Überzeugung, dass das eine, die Krawalle, so nicht ohne das andere, die Treffs der linken Szene, möglich gewesen wäre. Jetzt soll der Staat klare Kante zeigen. Den Verdacht aus dem Weg räumen, er dulde eine Allianz zwischen Politik und Gewalt.
Und wer sich drei Hotspots des Linksextremismus anschaut, dem fällt tatsächlich auf, dass viel geduldet, manchmal auch finanziell unterstützt wird, das am Ende mit einer Eskalation verknüpft ist. „Natürlich bekommt der Schwarze Block direkt kein Staatsgeld“, sagt zum Beispiel die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder (CDU). „Aber es ist nicht auszuschließen, dass sich über die geförderten Projekte auch Initiativen über Wasser halten, die zur Sympathisantenszene der militanten Antifa und des Schwarzen Blocks gehören.“
Wenn es auf Hamburgs Straßen brennt und Barrikaden errichtet werden, dann thront im Zentrum fast immer die Rote Flora. Der ehemalige Besitzer wollte das seit 1989 besetzte Gebäude umbauen, drohte mehrmals mit Räumung. Das sorgte für Ärger, Krawalle folgten. Der Unternehmer gab schließlich auf.
Hamburg lässt die Szene gewähren
Heute könnte die Stadt vom Prinzip her durchgreifen. Das Grundstück sowie die Immobilie gehören seit November 2014 einer Stiftung, sie verwaltet die Liegenschaft als Treuhänderin der Stadt. Als Mediatorin sozusagen. Die Lage sollte nicht erneut eskalieren, gleichzeitig sollte die „kulturelle Vielfalt“ bestehen bleiben.
Wie wackelig allerdings ein solches Konstrukt ist, darauf deutete bereits 2014 ein Interview in der „Zeit“ hin. „Angenommen, die Rote Flora mobilisiert wieder zu einer militanten Demonstration, und es kommt zu Straßenschlachten – haben Sie mit der Stadt darüber gesprochen, wie Sie damit umgehen?“, fragten die Journalisten damals. Die Vertreter der Stiftung antworteten: „Es gibt eine klare Aufgabenverteilung. Wir haben das Objekt angekauft und sind Eigentümer. Aber zu unseren Aufgaben gehört es bestimmt nicht, Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Deshalb sind wir an dieser Stelle auch kein Puffer.“
Im aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes heißt es, dass sich Autonome sogenannte Freiräume schaffen. Dort versuchten sie „eine befreite Gesellschaft“ vorwegzunehmen: „Die Rote Flora gilt seit Jahren bundes- und europaweit als Symbol hierfür.“ Die Stadt duldet das noch.
Was in Hamburg die Rote Flora ist, ist in Leipzig wiederum das Conne Island. Das selbstverwaltete Jugendzentrum „von und für Linke, Jugend-, Pop- und Subkulturen“, wie es sich selbst definiert, wird von der Stadt mit etwas weniger als 200.000 Euro pro Jahr gefördert und sorgt immer wieder für hitzige Debatten. Bereits 1996 erwähnte das Landesamt für Verfassungsschutz den Treff in seinem Jahresbericht – als „Anlaufstelle der Autonomen Szene“. Getragen wird das Conne Island, über dessen Ausrichtung und Arbeit jeden Montag ein offenes Plenum basisdemokratisch berät, von einem Projekt Verein e.V. Der Versuch, ihm die Gemeinnützigkeit abzuerkennen und ihm zugleich die Förderung zu entziehen, scheiterte Anfang der Nullerjahre.
Vor wenigen Jahren tobte dann erneut die Diskussion um das Zentrum. Ein deutschlandweit aktives Komitee der 1. Liga für Autonome hatte den „Leipziger GenossInnen“ den äußerst prestigeträchtigen Titel „Randalemeister 2015“ verliehen. Doch standen die Taten, die bei der Preisverleihung angeführt wurden, in irgendeinem direkten Zusammenhang mit dem Conne Island, wie etwa die CDU vor Ort vermutete? Das Rathaus erklärte, die Verwaltung habe mehrfach mit Verfassungsschützern über das Thema geredet. Diese Gespräche hätten aber keine Anhaltspunkte oder Empfehlungen dafür geliefert, „die Förderung des Betreibervereins Projekt Verein e.V. zu überdenken oder einzustellen“.
Im aktuellen Bericht erwähnt auch der Verfassungsschutz das Zentrum nicht mehr als „Anlaufstelle“. Dafür aber mag es auch andere Gründe geben. Erst kürzlich hatte das Landesamt eine krachende Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Dresden hinnehmen müssen. Die Richter erklärten einen lange zurückliegenden Lauschangriff auf das Conne Island für rechtswidrig.
Ein bisschen mehr als 150 Kilometer nördlich liegt Berlin. Dort in der Rigaer Straße 94 befindet sich der Hort der militanten linksextremen Szene in der Hauptstadt. Die Bewohner besitzen Mietverträge. Das macht Versuche, die Lage zu entschärfen, kompliziert. Die Forderung der CDU, Innensenator Andreas Geisel (SPD) möge „dieses Nest von Linksfaschisten“ endlich „mit allen Mitteln des Rechtsstaats ausräuchern“, stößt bei Berlinern auf offene Ohren, ist aber alles andere als einfach umsetzbar.
Geisel sagt unter Verweis auf die Rechtslage: „Eine schnelle Lösung auf polizeiliche Art und Weise steht dort nicht an.“ Das Haus sei allerdings Rückzugsort der Szene. „Deshalb müssen wir darüber reden, wie wir Straftäter in die Rigaer Straße 94 verfolgen können, was uns durch das Eingangstor im Moment verwehrt ist.“ Um die Lage zu befrieden, will der Senator auf Dialog mit Anwohnern setzen, die Gewalt ablehnen. Das aber reicht selbst dem SPD-Innenexperten Tom Schreiber nicht. Er wirbt für einen „Kiez-Rat“, eine Polizeiwache vor Ort und einen extra für den Bereich zuständigen Staatsanwalt. „Es wurde viel zu viel darüber geredet. Wir müssen endlich handeln“, findet Schreiber.
Ultralinke Szene bleibt im Lehrplan ausgespart
Das will die Opposition auch. Sie zielt aber zudem auf Grundlegendes. Der Linksextremismus bleibe beim Thema Prävention zum Beispiel außen vor und die Finanzierung sei undurchschaubar. „Das ist völlig intransparent und nicht schlüssig“, sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, und kritisiert: „Es gibt in der Stadt jede Menge gewaltorientierte Linksfaschisten, aber kein einziges Präventionsprogramm gegen linke Gewalt.“
Lehrpläne beinhalteten Rechtsextremismus und Islamismus, „was völlig richtig ist“. Die ultralinke Szene werde jedoch völlig ausgespart. Scharf kritisierte er auch Geisels gerade gemachten Vorschlag, das Versammlungsrecht zu lockern und dabei das Vermummungsverbot zu überprüfen. Die Behörde wiederum wehrte sich: im Zweifel für die Versammlungsfreiheit. Doch nach Hamburg hagelt es dafür Kritik.
Nicht anders ging es in den vergangenen Tagen dem Bundesfamilienministerium. Der Nochkoalitionspartner wirft dem SPD-geführten Haus vor, die Gefahr des Linksextremismus unterschätzt zu haben. Präventionsprojekte seien zusammengestrichen worden. Das stimmt irgendwie.
Doch das Ministerium erklärt, dass die Projekte nicht neu aufgelegt wurden, weil sie sich als wirkungslos erwiesen hätten. Daher wurden neue gestartet. Statt zwei Millionen Euro wie zwischen 2010 und 2014 gebe man im neuen Förderzeitraum von 2015 bis 2019 sogar 5,3 Millionen Euro für Forschungsvorhaben und Projektförderung zum Linksextremismus aus.
Gleichwohl schränkte das Ministerium ein, dass es gar nicht leicht ist, überhaupt förderwürdige Modellprojekte gegen linke Militanz ausfindig zu machen. „Die Szene verschließt sich formalen Strukturen. Es ist sehr schwer, sie zu erreichen.“
Lediglich vier Linksextreme als Gefährder eingestuft
Es wirkt paradox: Die Zahl der linksextremistischen Gefährder liegt zwar nur bei vier – ihnen traut man jederzeit schwere Gewalttaten zu. Rund 120 weitere Linksextreme gelten als sogenannte “relevante Personen“, die innerhalb der Szene als Logistiker oder Unterstützer tätig sind. Insgesamt eine überschaubare Gruppe.
Doch insgesamt registrieren die Behörden seit Jahren enorm viele linksextremistische Straftaten. Die Zahl liegt zwischen 8000 und 9600 Taten pro Jahr, darunter mehrheitlich Propagandadelikte, Land- und Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigungen, aber eben auch Körperverletzung. Im Jahr 2014 waren sogar 25 Prozent aller politisch motivierten Straftaten dem Bereich Links zuzuordnen. Ein Blick auf die Präventions- und Aussteigerprogramme aber zeigt, dass es dort kaum Angebote gibt.
Das Bundeskriminalamt hat in einer Studie insgesamt 721 Präventionsprojekte zu den unterschiedlichen Extremismusbereichen untersucht. Das Ergebnis: Rund 75 Prozent beschäftigen sich mit Rechtsextremismus, bei 20 Prozent geht es um Extremismus allgemein, bei 14 Prozent um Islamismus und bei nur vier Prozent um Linksextremismus. „Dies entspricht 25 Projekten, 19 davon in staatlicher und sechs in zivilgesellschaftlicher Trägerschaft“, schreiben die Wissenschaftler. Es handelt sich dabei um zwei Aussteigerprogramme, es geht viel um Vorträge oder Flyer. Viele Projekte seien zudem noch nicht in die Praxis umgesetzt worden – mangels Nachfrage.