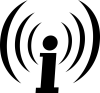Warum häuft sich rechte Gewalt besonders in Ostdeutschland? Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, hat die Ursachen erforschen lassen.
von Frank Jansen und Matthias Meisner
Der Rechtsextremismus ist in Ostdeutschland eben doch ein besonders großes Problem - das ist jetzt regierungsamtlich bestätigt. Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, die thüringische SPD-Politikerin Iris Gleicke, hat dazu beim Göttinger Institut für Demokratieforschung eine Studie in Auftrag gegeben, die an diesem Donnerstag in Berlin vorgestellt wird.
Die Wissenschaftler des Göttinger Instituts unter Prof. Franz Walter sehen ein ganzes Bündel von Ursachen dafür, dass die ostdeutschen Bundesländer bei den rechts motivierten Gewalttaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl, aber auch in absoluten Zahlen herausstechen und dass Fremdenhass grassiert. Zu diesen Ursachen gehören Nachwirkungen der DDR-Sozialisation: Völkerfreundschaft ja, aber die Migranten waren eben doch immer nur Gäste.
Entscheidend für die Entwicklung waren aber auch Enttäuschungen und Ängste in den ersten Jahren nach 1989, die bei manchen in Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und fremdenfeindliche Gewalt umschlugen. In ihrer Analyse weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass die Ostdeutschen generell weit weniger Erfahrungen mit Ausländern gemacht haben – während im Westen auch viele Kinder aus Arbeiterfamilien zusammen mit Kindern von Gastarbeitern aufwuchsen und feststellten, dass diese eben keineswegs stets privilegierte „Sozialschmarotzer“ sind. Die wenigen bestehenden Kontakte vor 1989, etwa im Betrieb und Kombinat, hätten vielfach mit der Deindustrialisierung der DDR geendet.
Daneben gibt es der Göttinger Analyse zufolge auch regionale Spezifika, die erst ein Klima schaffen, in dem Rechtsextremismus und Fremdenhass gedeihen können. Dabei spielt die politische Kultur eine Rolle – die Autoren der Studie beobachteten oft ein Kleinreden der Probleme. Rechtsextremismus werde von Lokalpolitikern und Polizei als unpolitische Jugendgewalt, als eine Sache von „Chaoten“ verharmlost. Das führe dann erst recht dazu, dass die Neigung zu autoritärem und rechtem Denken „eruptiv eskaliert“. Gerade im ländlichen Raum seien die zivilgesellschaftlichen Strukturen schwach. Gar nicht selten seien die Kirchgemeinden mit ihren wenigen Gläubigen die einzigen Akteure, die sich dem Rechtsextremismus entgegenstellen würden.
Die Wissenschaftler beobachten generell eine „Entpolitisierung“ in Ostdeutschland. Sie warnen davor, die Ostdeutschen unter Generalverdacht zu stellen. Selbst in den Regionen, in denen sich Neonazis und Fremdenfeinde geballt breit gemacht haben, gäbe es engagierte Leute, die die Zustände vor Ort nicht hinnehmen wollen.
In Sachsen gibt es besondere Probleme. Warum?
Der Freistaat nimmt einen Schwerpunkt in der Analyse ein. Speziell in Sachsen führe der „defizitäre Demokratisierungsprozess“ dazu, dass sich Bewegungen wie Pegida ausbreiten konnten und sich eine „autoritäre, ressentimentgeladene Minderheit zunehmend radikalisiert“. Wenn dann in bestimmten Orten – beispielhaft genannt und untersucht werden die Kleinstädte Freital und Heidenau bei Dresden – Migranten kaum Anreize haben, sich anzusiedeln, gebe es auch kaum „moralische Fortschritte“, wie die Autoren es formulieren. In sächsischen Regionen, wo die NPD die meisten Mitglieder habe, sei auch die Zahl gewaltbereiter Rechtsextremisten am größten.
Schon der im vergangenen Jahr von der sächsischen Landesregierung veröffentlichte „Sachsen-Monitor“ hatte ergeben, dass 58 Prozent der Einwohner des Freistaats meinen, die Bundesrepublik sei „durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet“ – bundesweit glaubt das nur jeder Dritte. Der Politologe Walter und seine Kollegen beobachten, wie sich der Konflikt hochschaukelt: Von Bundespolitikern und Medien wird benannt, dass insbesondere Sachsen ein Problem mit Fremdenfeindlichkeit hat. Die Sachsen selber würden im Gegenzug ihre eigene regionale oder ostdeutsche Identität romantisieren, die Probleme ausblenden oder sogar als „fischelant“ heroisieren, also selbst als Ausdruck einer genuin sächsischen Widerständigkeit und Streitlust deuten. Wer auf Probleme hinweise, werde als „Nestbeschmutzer“ verunglimpft.
Thematisiert wird auch die Rolle der CDU – angefangen mit dem ersten Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf und seinem geflügelten Wort, die Sachsen seien „immun“ gegen Rechtsextremismus. Nur eine Auswahl von Kritikpunkten: ein CDU-Landtagsabgeordneter, der einen NSU-Untersuchungsausschuss als „Beschäftigungstherapie“ ansieht, ein Patriotismusbeauftragter der Landespartei (der heutige Landtagspräsident Matthias Rößler), der schon vor Jahren Thesen formuliert habe, die in nichts der Kulturkritik der Neuen Rechten nachstehen würden.
Besonders lehrreich in der Studie ist die Beobachtung der Verhältnisse in Freital – neben unter anderem Bautzen und Heidenau einer der Brennpunkte rechter Gewalt. Die Autoren berichten, dass sich heute niemand mehr an pogromartige Angriffe auf ein dortiges Gastarbeiterwohnheim 1991 erinnern wolle. Sie beschreiben, dass der CDU-Oberbürgermeister sich dem Diskurs verweigert und vor „Pauschalurteilen“ über seine Stadt warnt, wie die Freitaler CDU mit Politikern sogar des rechten AfD-Flügels gemeinsame Sache macht. „Dialog und öffentliche Kritik sind demnach nur solange legitim, wie sie dem Image der Stadt nicht schaden“, heißt es.
Von einer Gewöhnung, ja von einem Abstumpfen der Freitaler Einwohnerschaft gegenüber alltagsrassistischen Übergriffen auf Flüchtlinge hätten Aktivisten in Interviews berichtet. Mit den Folgen befasst sich jetzt das Oberlandesgericht Dresden im Prozess gegen die mutmaßlich rechtsterroristische „Gruppe Freital“. Bewusst schreiben die Göttinger Wissenschaftler die Anschläge gegen Flüchtlinge der Bürgerwehr zu, die sich 2015 aus den Anti-Asyl-Protesten heraus gebildet hat.
Wie ist die Lage in den anderen neuen Ländern?
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie ist die Situation in Thüringen, speziell im Erfurter Plattenbauviertel Herrenberg. Hier ist es Neonazis gelungen, sich als Teil der Alltagskultur zu etablieren. „Auf dem Herrenberg weitet die rechte Szene ihren Einfluss auf zweierlei Weise aus: Zum einen hat sie die Kümmerer-Taktik deutlich und erfolgreich intensiviert, zum anderen ihre Präsenz in der Öffentlichkeit deutlich erhöht, um nicht zuletzt einen Normalisierungseffekt zu erreichen“, steht in der Studie.
Als zentraler Akteur der Doppelstrategie gilt der Verein „Volksgemeinschaft e.V.“, der eine Art braunes Stadtteilzentrum betreibt. Das vor allem für Jugendliche attraktiv scheinende Angebot reicht von Hausaufgabenhilfe über Unterricht an E-Gitarre und Schlagzeug bis hin zum Kickerturnier. Die Neonazis hätten eine „rechte Erlebniswelt als lokal nahezu alternativloses Angebot für die Jugend“ erschaffen, warnt die Studie.
Ein Blick über die Studie hinaus lässt zudem erkennen, dass Rechtsextremismus auch in anderen östlichen Ländern (mit Berlin) ein akutes Problem bleibt. In Brandenburg beispielsweise, vor allem im Süden des Bundeslandes, ist es trotz des Verbots rechtsextremer Vereinigungen nicht gelungen, die Szene zurückzudrängen. Vor allem die Schlägertruppe „Inferno Cottbus“ verbreitet Angst und Schrecken. Bei der Gruppierung, die sich jetzt angeblich aufgelöst hat, machen Neonazis, Kampfsportler, Hooligans und Rocker mit. Im Januar marschierten 120 maskierte Inferno-Leute und weitere Rechtsextremisten mit Fackeln durch Cottbus, im April randalierten Inferno-Fans von Energie Cottbus beim Spiel des Vereins in Potsdam-Babelsberg und stürmten das Spielfeld. Im gesamten Bundesland stieg zudem 2016 die Zahl rechter Angriffe auf Flüchtlinge, Linke und weitere Personen, die zum Feindbild der Szene zählen. Der Verein Opferperspektive berichtete von 221 Attacken (2015: 203) mit 335 Opfern.
In Sachsen-Anhalt zählte die Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt im vergangenen Jahr 265 rechte Angriffe mit 401 Opfern, darunter 45 Flüchtlingskinder. In Mecklenburg-Vorpommern meldete der Verein „Lobbi“, der sich auch um Opfer rechter Gewalt kümmert, 149 Attacken. Davon seien 248 Menschen „direkt betroffen“ gewesen. In Berlin berichtete der Verein „Reach Out“ von 380 rechten Angriffen mit 553 Opfern.
Dass in der Studie Sachsen hervorgehoben wird, passt allerdings auch zu der dort besonders hohen Zahl rechter Attacken. Die die dortige „Opferberatung für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt“ zählte 437 Angriffe mit 685 Betroffenen. Aus Thüringen meldete die Beratungsstelle „Ezra“ 160 Fälle, bei denen mindestens 277 Menschen betroffen waren.
Wie hat sich die Situation im Westen entwickelt?
Dort hat bislang nur eine Opferberatungsstelle in Nordrhein-Westfalen eine Zahl vorgelegt. Demnach gab es im vergangenen Jahr 335 rechte Angriffe. Da in NRW ungefähr so viele Menschen leben wie in den fünf neuen Ländern zusammen, ist die Zahl ein Hinweis, dass rechte Gewalt Ostdeutschland überproportional hoch ist. Weitere Indikatoren sind Wahlergebnisse rechter Parteien. Die NPD schneidet im Westen weit schlechter ab als im Osten. Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag in Nordrhein-Westfalen scheiterte die NPD mit gerade einmal 0,3 Prozent. Damit hat die Partei auch deutlich die Ein-Prozent-Marke verfehlt, die für die staatliche Teilfinanzierung von Wahlkampfkosten erreicht werden muss.
Und das Debakel ist nur die vorerst letzte Folge einer Serie. Außer in NRW hat die NPD auch bei den letzten Wahlen in sieben weiteren westdeutschen Ländern weniger als ein Prozent erreicht. In Sachsen hingegen kam sie 2014 auf 4,9 Prozent und in Thüringen auf 3,6 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern waren es 2016 noch drei Prozent. Auch diese Resultate waren für die NPD bitter, weil sie in Dresden und Schwerin aus dem Landtag flog. Aber immerhin sind die Wahlergebnisse in allen fünf ostdeutschen Ländern noch gut genug, um Geld vom Staat zu kassieren.
Auch die Proportionen der Wahlerfolge der AfD sprechen für sich. In Westdeutschland erreichten die Rechtspopulisten seit 2014 Ergebnisse zwischen 5,5 Prozent (Bremen) und 15,1 Prozent (Baden-Württemberg). Im Osten ist der Sockel höher: von 9,7 Prozent in Sachsen steigerte sich die AfD auf 24,3 Prozent in Sachsen-Anhalt.
Was empfiehlt Gleicke in der Konsequenz?
Die von Iris Gleicke in Auftrag gegebene Studie hält ein ganzes Bündel an Maßnahmen für notwendig, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Dazu zählen eine bessere Sozialpolitik, mehr politische Auseinandersetzungen, die Stärkung von Positivbeispielen, auch der Kampf gegen eine Romantisierung der DDR. Die Autoren warnen vor einem „als westdeutsch empfundenen Zeigefinger“. Sie geben zu, dass der Kampf noch lange nicht gewonnen ist – vor allem in jenen Gegenden nicht, in denen die rechtsextreme Szene bereits ein Maximum an Geländegewinnen erzielt habe.