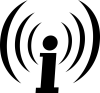"Belastetes Staatsverständnis" und "verfehlte Erinnerungs- und Sozialpolitik" - das sind laut einer Studie im Auftrag der Ostbeauftragten der Bundesregierung Gründe für die Häufung rechter Gewalt in den neuen Ländern. Und sie kritisiert die Sachsen-CDU.
Von Julian Heißler, tagesschau.de
Es waren besorgniserregende Zahlen, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor ziemlich genau einem Jahr vorstellte: Um ganze 44,3 Prozent waren die politisch rechtsmotivierten Gewalttaten im Jahr 2015 in die Höhe geschnellt. Insgesamt wurden fast 23.000 Straftaten mit einem rechten Hintergrund verübt. So steht es in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik des Jahres. Von einer "bedrohlichen gesellschaftlichen Entwicklung" sprach der Minister damals - und verwies darauf, dass sich etwa die Zahl der Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte im Vergleich zum Vorjahr "mehr als verfünffacht" habe.
Bereits damals fiel auf, dass bei der regionalen Verteilung der Straftaten bestimmte Gebiete in Ostdeutschland herausstachen. Grund genug für Iris Gleicke, die im Wirtschaftsministerium angesiedelte Bundesbeauftragte für die neuen Bundesländer, eine Studie in Auftrag zu geben, die das Phänomen genauer ergründen sollte. Heute wird sie in Berlin vorgestellt. Die zentralen Erkenntnisse und die Handlungsempfehlungen liegen tagesschau.de vor.
Das Göttinger Institut für Demokratieforschung
"Ein Ursachenbündel"
"Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland" lautet der Titel der Analyse, die das Göttinger Institut für Demokratieforschung erstellte. Für ihre Studie untersuchten sie insbesondere zwei Regionen: Die Metropolregion Dresden, konkret die Städte Freital und Heidenau, in denen es im Sommer 2015 "asylfeindliche Proteste" gegeben hatte, sowie den Erfurter Stadtteil Herrenberg, "der seit langem für seine rechtsextreme Szene bekannt ist".
Unter anderem kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass in gewissen Regionen Ostdeutschlands und in politisch-kulturellen Umfeldern eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremem Denken existiere. Dafür gebe es nicht einen einzigen Auslöser. Man könne es nur mit einem Ursachenbündel aus erinnerungs- und sozialpolitischen Faktoren erklären. Festzustellen sei "eine unglückliche Verquickung von Dispositionen, von historischer Belastung im Umgang mit dem Fremden und auch, aber nicht nur, historisch vorbelasteten, negativ konnotierten bis gar nicht vorhandenen Einstellungen zu Staat und Politik", heißt es im Text.
"Spezifische politische Kultur"
Die Politik halten die Studienautoren für diese Entwicklung zumindest mitverantwortlich. So schreiben sie etwa mit Blick auf die Stadt Heidenau, dass die dortige Ablehnung von Antifa-Demonstrationen sich wohl nicht nur aus der Wut über "linke KrawallmacherInnen" speise, sondern auch daraus schöpfe, dass jemand "von außen" komme, der ihnen sage, wie sie sich zu verhalten haben. Dies rege "Phantasien von der Fremdbestimmung" an.
Dies sei nicht zuletzt deshalb so, "weil insbesondere in Sachsen eine spezifische, von den dortigen Vertretern der CDU dominierte politische Kultur wirkt, die das Eigene überhöht und Abwehrreflexe gegen das Fremde, Andere und Äußere kultiviert". Auch werfen sie der sächsischen Politik vor, Konflikte zu verdrängen und deshalb "klare Worte gegenüber der rechten Bedrohung" zu vermeiden.
Keine Ratschläge aus dem Westen
In ihren Handlungsempfehlungen fordern die Autoren einen Bruch mit dieser Politik. Insbesondere in Sachsen habe man gesehen, dass die "Entpolitisierung des Politischen ein politisches Klima bereiten kann, in dem Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit weiter erstarken". In Thüringen könne man hingegen beobachten, dass die "Landes- und in Teilen auch die Kommunalpolitik deutlich andere Akzente setzt". Ein Umsteuern sei demnach ebenso "möglich wie notwendig". Und weiter: "Eine offene Auseinandersetzung über die Diagnose ,sächsische Demokratie' (…) und eine Regierungspartei, die Probleme nicht (mit Sachsenstolz) übertüncht, sondern sich ihrer annimmt, wäre ein erster Schritt."
Die Studie warnt zudem davor, ganz Ostdeutschland über einen Kamm zu scheren. So gebe es Städte und Regionen, die einen Weg eingeschlagen hätten, "an dessen Ende auch Erfolge im ostdeutschen Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit stehen dürften". Als Beispiele nennen die Autoren etwa Jena, Leipzig und Hoyerswerda. Gut gemeinte Ratschläge aus den alten Bundesländern seien hingegen nicht hilfreich. "Zeigefinger-Lösungsvorschläge aus dem vermeintlich weltoffeneren Westen der Republik sollten (…) unterbleiben", heißt es.
Gleicke lobt die Studie
Auftraggeberin Gleicke betont, dass es eine einfache Erklärung für Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland nicht gibt und auch nicht geben kann. Es gelte, mögliche Ursachen aufzudecken und offenzulegen, um so zu verstehen, was in Ostdeutschland geschieht, und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.
"Ich bleibe dabei: Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sind eine ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland. Die Ursachen müssen schonungslos und ohne Tabus aufgedeckt und offengelegt werden", sagt sie. Sie habe die Autoren der Studie gebeten, basierend auf den Ergebnissen ihrer Untersuchung in einer Art von "Best Practice" positive Beispiele für einen erfolgreichen Kampf gegen Rechtsextremismus in Ostdeutschland aufzuzeigen und darzulegen, was dabei jeweils die Erfolgsfaktoren sind.
Es ist nicht das erste Mal, dass SPD-Politikerin Gleicke sich dem Thema Rechtsextremismus annimmt. Im vergangenen Herbst hatte sie im Jahresbericht zur Deutschen Einheit erklärt, Fremdenfeindlichkeit stelle eine große Gefahr für die gesellschaftliche, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder dar. Auch im vergangenen Frühjahr warf sie ostdeutschen Politikern und Behörden vor, Rechtsextremismus zum Teil "systematisch runtergespielt" zu haben.