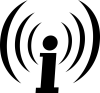Seit der Ermordung der Freiburger Studentin Maria L. im Jahr 2016 wird darüber diskutiert, die Ermittlung von biogeografischer Herkunft aus DNA-Spuren des Täters zu erlauben. Doch manche Experten sind skeptisch.
Von Norbert Lossau
Die Analyse von DNA-Spuren, die ein Verbrecher am Tatort hinterlassen hat, ist seit Jahren der heilige Gral der Forensik. Ist das identische Erbgutmuster bereits in einer Kriminaldatenbank gespeichert, lässt sich der Täter mit einer simplen Computerabfrage ermitteln – ohne dass die Kommissare noch aufwendige Recherchen vornehmen müssen.
Auch wenn es sich um einen Ersttäter handelt, dessen DNA-Daten noch nicht archiviert sind, lässt sich in vielen Fällen aus mehreren Tatverdächtigen eindeutig der Richtige ermitteln. Die Aussagekraft eines DNA-Vergleichs ist schließlich überwältigend groß.
Jede dritte DNA-Spur, die mit der Datenbank abgeglichen wird, führe hierzulande sofort zu einem Treffer, sagt Professor Peter Schneider, Vorsitzender der gemeinsamen Spurenkommission der rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Institute. In den Folgejahren könnten überdies noch viele weitere Täter nachträglich überführt werden, wenn sie der Polizei bei einer anderen Straftat ins Netz gehen und dann bei ihnen ein DNA-Test vorgenommen wird. Bisweilen werden auf diese Weise sogar Verbrechen aufgeklärt, die bereits Jahrzehnte zurückliegen.
Das Geschlecht lässt sich 100-prozentig sicher bestimmen
Außer dem direkten Abgleich von DNA-Material zur Identifizierung von Straftätern darf hierzulande im Rahmen von forensischen Ermittlungen lediglich eine konkrete Eigenschaft des Verdächtigten aus vorliegenden Tatortspuren herausgelesen werden: das Geschlecht. Ob ein Täter männlich oder weiblich ist, lässt sich aus einer DNA mit 100-prozentiger Gewissheit bestimmen.
Die Wissenschaft kann jedoch weit mehr, als der gesetzliche Rahmen (Paragraf 81 der Strafprozessordnung) bislang erlaubt. Auch die Farbe von Haaren, Augen und der Haut, die biogeografische Herkunft und das Alter einer unbekannten Person lassen sich mit hoher Präzision aus einer DNA-Probe ermitteln. Manche Rechtsmediziner und Politiker wünschen sich deshalb, dass bei der Analyse von DNA-Spuren künftig auch diese Informationen ermittelt werden, um ein besseres Täterprofil zu haben.
Der Mord an der Studentin Maria L. im vergangenen Jahr in Freiburg im Breisgau hat die Rufe nach einem „DNA-Profiling“ lauter werden lassen. Das hat schließlich dazu geführt, dass das Bundesland Baden-Württemberg im Februar 2017 einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht hat. Darin ist allerdings nicht vorgesehen, auch die biogeografische Herkunft zu bestimmen. Unterstützt wird die Initiative vom Land Bayern, wobei der bayerische Justizminister Winfried Bausback gern auch die biogeografische Herkunft ermitteln lassen möchte.
Zahlreiche Experten beraten Bundesjustizminister Maas
In der vergangenen Woche hatte in dieser Sache Bundesjustizminister Heiko Maas Wissenschaftler und Experten aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien zur einer Anhörung in die Bundeshauptstadt Berlin geladen. Zu ihnen gehörte auch die in Tunesien geborene Anthropologin Amade M’charek von der Universität Amsterdam. In den Niederlanden gibt es bereits seit 2003 ein Gesetz, das es Kriminologen erlaubt, aus DNA-Spuren auch äußere Merkmale des Täters sowie seine biogeografische Herkunft zu ermitteln.
Die Gesetzesänderung in den Niederlanden war die Folge eines spektakulären Mordfalls im Jahr 1999. Damals wurde in Friesland eine junge Frau mit durchgeschnittener Kehle auf einem Acker aufgefunden. Schnell stand der Verdacht im Raum, dass es sich bei dem Täter wohl um einen Bewohner eines benachbarten Flüchtlingsheims handeln müsse.
In dieser Situation entschloss sich der ermittelnde Staatsanwalt zu einem ungewöhnlichen Schritt. Er ordnete ohne Rechtsgrundlage an, die DNA-Spuren vom Tatort auf die biogeografische Herkunft untersuchen zu lassen.
In den Niederlanden ist Genprofiling seit 2003 erlaubt
Das Ergebnis: Der Tatverdächtige war von nordeuropäischer Herkunft. Die Flüchtlinge, die allesamt aus dem asiatischen Raum stammten, waren damit entlastet. Dieser Ermittlungserfolg stand am Anfang jener Entwicklung, die schließlich zu der gesetzlichen Regelung von 2003 führte. Der Mörder konnte übrigens Jahre später ermittelt werden – es war ein niederländischer Landwirt.
Die Niederlande haben also bereits 14 Jahre Erfahrung mit einer Gesetzeslage, deren mögliche Einführung hierzulande diskutiert wird. Amade M’charek berichtet, dass DNA-Profiling in den Niederlanden nur sehr selten und überaus diskret genutzt wird.
Von den 50.000 forensischen DNA-Analysen, die seitdem in Holland durchgeführt worden sind, wurde das Erbgut nur in zehn Fällen im Hinblick auf äußere Merkmale analysiert. Infrage kämen dafür nur ganz spezielle Fälle, bei denen es ermittlungstechnisch tatsächlich sinnvoll ist, diese Informationen abzuleiten. Ohnehin werden die Analysen nur bei erheblichen Straftaten wie Mord, Totschlag oder Sexualdelikten angeordnet.
Täter legen bisweilen falsche Spuren
Auch in Schweden, Spanien und Frankreich wird Gen-Profiling nach Einzelfallentscheidungen in seltenen Fällen genutzt. Das könnten sich wohl auch viele Experten hierzulande vorstellen. Es gibt jedoch Bedenken, diese Analysen flächendeckend und routinemäßig vorzunehmen.
„Die Ermittlung der Herkunft ist für die Polizei wichtiger als die Kenntnis der Haar- oder Augenfarben“, weiß aus eigener Erfahrung Professor Lutz Roewer, der die Abteilung Forensische Genetik am Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité leitet. Roewer hatte DNA-Material eines Täters analysiert, das 2004 unter den Fingernägeln eines Mordopfers entdeckt worden war.
Der Täter hatte mit Lippenstift auf die Beine der Ermordeten geschrieben „Respectez Asia“ und wollte damit wohl eine falsche Spur legen. Vor einem Nebenergebnis der Untersuchung konnte der Wissenschaftler die Augen nicht verschließen: Diese DNA konnte nicht einem Asiaten gehören, der Täter war vielmehr afrikanischer Abstammung.
Die Genauigkeit einer biogeografischen Bestimmung ist bei solchen Extremen besonders groß. Doch selbst dann kann es noch Irrtümer geben. Die Genanalyse kann immer nur regionale Cluster ermitteln. Durch die genetische Vermischung kann es im Einzelfall immer wieder zu groben Fehleinschätzungen kommen.
„Es gibt keinen Gentest auf Rasse“
Ein DNA-Test auf Herkunft ist niemals so präzise wie die etablierte Methode zur Identifizierung von Individuen durch DNA-Abgleich. „Es gibt keinen Gentest für Rasse“, stellt denn auch die Bioethikerin Professor Barbara Prainsack vom King’s College in London fest.
Die Bestimmung von Haar-, Haut- und Augenfarben ist mit noch größeren Fehlern behaftet als die Bestimmung der Herkunft. „Die Genetik äußerer Merkmale ist viel komplexer, als man gemeinhin denkt“, sagt Peter Schneider. Die Zusammenhänge sind eben nicht monokausal. Und weil sich deshalb immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen lassen, wird man mit einem DNA-Steckbrief des möglichen Täteraussehens immer viele Unschuldige zu Verdächtigen machen.
Die Problematik lässt sich mit einem konstruierten Fallbeispiel und etwas Wahrscheinlichkeitsrechnung illustrieren. Angenommen, in einem Ort leben 1000 hellhäutige und 20 dunkelhäutige Menschen. Nach einem Mord deutet die Analyse der Täter-DNA darauf hin, dass der Mörder dunkelhäutig ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aussage richtig ist, beträgt aber maximal 98 Prozent.
Oft gibt es nicht genügend DNA-Material
Da zwei Prozent von 1000 Hellhäutigen eine ebenso große Gruppe von „Tatverdächtigen“ ergeben wie die Zahl der Dunkelhäutigen, wäre also am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter tatsächlich dunkelhäutig ist 50:50. Man hätte also mit der Analyse nichts gewonnen, lediglich einen Teil der Bevölkerung diskriminiert. Dieses Beispiel zeigt, dass man immer nur im Einzelfall entscheiden kann, welche Analysen sinnvoll sind und welche nicht.
Es gibt eine weitere Einschränkung: Es ist nicht immer ausreichend viel DNA-Material verfügbar, sodass man sich sehr gut überlegen muss, für welche Untersuchungen man es verbraucht. „Nicht alles, was man machen möchte, kann man auch machen“, sagt Schneider. Vielleicht könnten die vorhandenen Proben in der Zukunft für aussichtsreichere Ermittlungen verwendet werden.
Bei der DNA-Analyse zur Bestimmung der Identität werden nur solche Regionen des Erbgutmoleküls untersucht, die von den Fachleuten als „nicht codierend“ bezeichnet werden. Damit ist gemeint, dass hier keine Informationen gespeichert sind, aus denen individuelle Eigenschaften der betreffenden Person abgeleitet werden können. Wenn man die Farbe von Augen oder Haaren bestimmen will, muss man die „codierenden“ Bereiche der DNA analysieren.
Wann sind Persönlichkeitsrechte gefährdet?
Hier sind aber zahlreiche Informationen über das betreffende Individuum gespeichert – von Hinweisen auf die Intelligenz eines Menschen bis hin zu den Wahrscheinlichkeiten, im Laufe des Lebens von bestimmten Krankheiten heimgesucht zu werden. Außerdem wird den Wissenschaftlern immer klarer, dass es keine präzisen Grenzen zwischen codierenden und nicht codierenden Bereichen der DNA gibt.
Solange die durch eine forensische DNA-Analyse gewonnenen Erkenntnisse nur zur Aufklärung eines aktuellen Falls genutzt werden, mag der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Verdächtigen überschaubar sein. Doch wenn solche Informationen dauerhaft in einer Datenbank gespeichert werden, stellt sich die Frage mit größerer Brisanz.
Der wissenschaftliche Fortschritt ist hier überdies schnell und nicht vorhersagbar. Was sich in zehn oder 20 Jahren aus solchen Datensätzen alles herauslesen lassen wird, ist heute eine nicht zu beantwortende Frage.
Anspruchsvolle DNA-Analysen sind nicht preiswert
Nicht zuletzt deshalb warnt Professor Schneider vor übereilten Entscheidungen. Er empfiehlt dem Gesetzgeber, sich Zeit zu lassen und die Grenzen des DNA-Profilings mit großer Sorgfalt zu definieren. Am Ende wäre niemandem gedient, wenn die Qualität der wissenschaftlich sehr anspruchsvollen Analysen nicht so gut wäre, wie es für eine verantwortungsvolle Anwendung in der Forensik erforderlich ist.
Ein limitierender Faktor beim DNA-Profiling ist schließlich auch das Geld. Weil die Analysen aufwendig und teuer sind, wird man sie allein schon deshalb nicht flächendeckend, sondern nur mit Sinn und Verstand einsetzen. Roewer erklärt, dass die Analyse einer Spur rund 700 Euro kostet. Dazu käme dann noch eine Auswertung, die zwei Arbeitstage erfordere. Am Ende müsse man für ein Gutachten mit Kosten von rund 1000 Euro rechnen.
Natürlich geht es immer auch billiger. Weil die DNA-Analysen im Rahmen des europäischen Vergaberechts von den einzelnen Bundesländern ausgeschrieben werden müssen, sind beispielsweise in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zehn Jahren die Preise für DNA-Analytik um 50 Prozent gesunken. „Zu diesen Preisen können wir die nötige Qualität nicht mehr liefern“, sagt Schneider, der an der Universitätsklinik Köln die Abteilung Forensische Molekulargenetik leitet. „Wir beteiligen uns an den Ausschreibungen nicht mehr.“