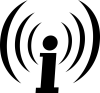Bei der Suche nach jüdischem Leben im Kyffhäuserkreis trifft man bis heute auf offenen Hass
Juden haben wir nie gerne gehabt. Die wurden eben vernichtet. Und aus.
Da hatte niemand großes Interesse daran, dass die weiterlebten.« Das
sagt ein Thüringer 2016. Er sagt es unumwunden, bei zugesicherter
Anonymität.
Der Mann ist nicht der Einzige, der zur Nazizeit
noch Kind war, ein politisch hellwacher Heranwachsender, der einer
Familie mit NS-Funktionsträgern angehörte, und der heute unter vier oder
sechs Augen Klartext redet.
Buchenwald
»Die Vernichtung der Juden hat den Leuten nichts ausgemacht – nee, das
hat keinen interessiert«, bekräftigt ein anderer Mann bei dieser
Spurensuche in Thüringen. »Aber was im KZ Buchenwald passierte, wussten
alle hier in der Gegend, auf den Dörfern.« Am detailliertesten wissen es
die Leute in Weimar selbst. »Beim Thema Juden ging in der Stadt der
Riss durch die Familien«, erinnert sich eine betagte Bewohnerin. »Da
mochte die Mutter die Juden – und der Sohn war ein hohes Tier bei den
Nazis, so was gab’s«, sagt sie und fügt hinzu: »Komisch. Über die Juden
haben die sich aber nicht gestritten.«
Als jüdische Kaufhäuser
und Geschäfte in Weimar geschlossen, Juden immer brutaler traktiert
wurden, hatte keiner protestiert, sagt ein Rentner auf dem Markt mit den
vielen Bratwurstständen. Auf der einen Seite steht das nach Hitlers
Vorstellungen errichtete Hotel »Elephant«, auf der anderen befand sich
einst das jüdische Tietz-Kaufhaus. »Die Leute dachten damals, na,
irgendwie haben die Juden ja auch Dreck am Stecken. In den Kirchen
predigten das sogar die Pfarrer.«
Zurück in die Provinz, in ein
Dorf bei Mühlhausen, zur weiterhin vergeblichen Suche nach Zeitzeugen,
die persönliche Erfahrungen mit Juden hatten, die welche kannten. »Nein,
das wollte ich nie, ich habe niemals mit einem Juden gesprochen, nie
einen getroffen. Ich will das bis heute nicht«, sagt 2016 beim
Nachmittagskaffee mit Thüringer Kuchen eine 89-Jährige, die ihre
damalige NS-Eliteschule über alle Maßen lobt: »Wunderbare Zeiten,
Tanzstunde mit den Pimpfenführern, sogar ein Osteinsatz. Theaterspielen
und Volkstänze bei den Frontsoldaten in der Ukraine.«
Lodz
Damals, in Lodz, sieht sie wenigstens einmal im Leben viele Juden ganz
aus der Nähe: »Zum Stadtzentrum ging’s mit der Straßenbahn immer durchs
Ghetto. Da waren rechts und links Gitterzäune, da liefen die Juden rum.«
So
viele Jahre nach Kriegsende und Entnazifizierung sind vergangen. Haben
sie und manche ihrer Bekannten und Freunde inzwischen ein anderes
Verhältnis zu Juden? »Nein, bei dieser Erziehung steckt das einfach noch
so drin. Juden mag ich auch heute nicht! Wir dachten eben damals, Juden
sind Verbrecher, wenn wir welche unter SS-Bewachung mal in Weimar auf
dem Bahnhof sahen.« Ein Verwandter war im thüringischen Kranichfeld bei
der SS, trieb jüdische Häftlinge aus dem KZ Buchenwald auf den
Todesmärschen durch Felder und Dörfer. Die 89-Jährige erwähnt beiläufig,
dass da viele Juden umkamen.
Dann entrüstet sie sich: »Die
Russen haben mitten im Winter einen Verwandten von mir gezwungen, tote,
verscharrte Juden wieder auszugraben und in einen eigens angelegten
Friedhof nach Kranichfeld zu bringen.« Dann leuchten ihre Augen wieder:
»Ja, ich war stolzes NSDAP-Mitglied, bin mit den anderen durch die
Dörfer gezogen und habe gerne gesungen: ›Wir werden weitermarschieren,
bis alles in Scherben fällt.‹«
Zu Führers Geburtstag wurde auch
in den Zuckerfabriken der Kyffhäusergegend die Produktion gestoppt,
mussten alle Arbeiter zum Appell antreten, strammstehen, »Heil Hitler«
brüllen. So gut wie alle hatten es gerne getan. Ein Mann aus einem
winzigen Dorf Thüringens, er war kein Kommunist, nicht einmal links
angehaucht, machte laut Gestapo »Äußerungen gegen Hitler«. Er wurde
verhaftet und sah tagtäglich aus nächster Nähe, wie Tausende von Juden
endeten. Erst auf dem Totenbett gestand er einem Freund: »Ich war in
Auschwitz, musste nach den Erschießungen an der Schwarzen Wand immer das
Blut zusammenkehren.«
Brasilien
Max L. gehörte zu Hitlers Pilotenelite. Für ihn ist das Liquidieren von
Juden Kriegsnormalität, nichts Besonderes. Wenige Monate, bevor er
starb, war er zu einem Interview bereit. »Der Jude ist der Todfeind
aller Nichtjuden!«, rief er aus. Das gab er sogar schriftlich: In einem
kopierten Brief an seinen engsten Fliegerkumpan, der sich sofort nach
dem Krieg nach Brasilien abgesetzt hatte, schrieb er das. »Später erfuhr
ich, dass mein Schwager mal eine jüdische Frau hatte, die nach
Argentinien gegangen war«, erzählte er im Interview. »Sein Schulfreund
war Bertolt Brecht. Sie kamen alle zwei aus Augsburg. Der Schwager wurde
von der Gestapo überwacht. Er hatte auch Brecht zur Emigration
verholfen.«
Max L., der im Zweiten Weltkrieg zahlreiche britische
Kampfflugzeuge abschoss, verlor zu DDR-Zeiten kein Wort über die
Kriegszeit, über seine engen Kontakte zur SS und zum
Reichsluftfahrtministerium in Berlin. Er hing an der Gegend, wollte
nicht nach Brasilien zu seinem Freund, spazierte gerne über die einstige
Piste des damaligen Militärflugplatzes von Esperstedt, wo er Piloten
auf einer von Hitlers scheiternden »Wunderwaffen«, der Messerschmitt ME
163 mit Raketenantrieb, ausgebildet hatte, die als erstes Flugzeug der
Welt die Schallgeschwindigkeit erreichte. Im nahen Bad Frankenhausen
logierte er mit den anderen Piloten luxuriös im Schloss »Hoheneck«.
Es
gab Juden in diesen Thüringer Dörfern. Aus Bad Frankenhausen wurden
mindestens fünf andere jüdische Bürger in Vernichtungslager deportiert
und ermordet, oder sie kamen in Theresienstadt um.
Interessant
ist, dass der einstige Kampfflieger Max L. nicht den berühmtesten
jüdischen Bürger Bad Frankenhausens erwähnt hat, den Luftfahrtpionier
Sigmund Israel Huppert. Der hatte 1902 das dortige private
Kyffhäuser-Technikum als Direktor übernommen und zu Weltruhm geführt.
Luftfahrtgeschichte schrieb Huppert, indem er 1908 Deutschlands ersten
Studiengang für Flugzeugbau nebst Flugbetrieb startete und
Propellermaschinen mitentwickelte. Studenten aus aller Welt kamen zu
ihm, sogar aus dem fernen China.
Emigration
Am Technikum widerstand Huppert jahrelang heftigen antisemitischen
Anfeindungen, bis ihn die 1931 gewählte NSDAP-Landesregierung Thüringens
aus dem Amt drängte – er konnte noch rechtzeitig nach Schweden
emigrieren. 1945 starb er in Stockholm. Hitlers
Reichsluftfahrtministerium nutzte Hupperts Pionierarbeit maximal – nicht
wenige große Namen von Militär und Rüstung wirkten nach seiner
Emigration im Technikum.
Ulrich Hahnemann ist Direktor des
Regionalmuseums in Bad Frankenhausen, und er hat eine Biografie über
Sigmund Huppert geschrieben. Besonders verweist Hahnemann auf »die
beiden Steinhoffs«. Einer, Johannes Steinhoff, wurde hochdekorierter
Nazi-Jagdflieger, nach 1945 Bundeswehrgeneral, Vorsitzender des
NATO-Militärausschusses. Den anderen, Ernst Steinhoff, machten die Nazis
nach Hupperts Abgang zum Chef der Luftfahrttechnikabteilung. Die
Amerikaner setzten ihn nach 1945 auf einen Chefposten im
Air-Force-Raketenentwicklungszentrum.
Ein weiterer
Technikum-Absolvent, Bernhard Hohmann, arbeitete gar als »Chief« in den
US-Raumfahrtprogrammen, darunter an den Mondlandefähren, mit. »Viele
weltbekannte Flugzeug- und Raketenkonstrukteure bauten auf dem
Lebenswerk des Juden Huppert auf«, sagt sein Biograf Hahnemann.
Auf
das Kyffhäuser-Technikum ist man in Bad Frankenhausen bis heute stolz.
Dass es ein Jude war, der es groß gemacht hatte, haben die meisten
vergessen. Und das Vergessen ist nicht einmal die schlimmste Form, mit
dem Erbe umzugehen.