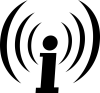Nach dem Aus der rechten Moblisierung beraten Leipziger Antifa-Aktivisten, wie es weiter gehen soll
Am Sonntag haben sie sich wieder einmal getroffen, die Linken aus Leipzig. Allerdings nicht zu einer Demo oder Kundgebung: Im »Haus der Demokratie« im Szene-Stadtteil Connewitz fand unter dem Titel »Argumente gegen Rechts« ein Workshop statt. Die Teilnehmer diskutierten über Strategien, dem Rechtsruck nicht nur auf der Straße zu begegnen – sondern auch am Stammtisch. Dort also, wo die Parolen im geschlossenen Raum verbleiben, wo Rassismus nicht so offensichtlich zu Tage tritt und bisher häufig widerspruchsfrei blieb.
Zugegeben, viele waren nicht gekommen, aber der Raum war auch recht klein. Etwa 20 Teilnehmer saßen an runden Tischen, schrieben ihre Ideen auf kleine Zettel und spielten Alltagssituationen nach: Wie reagieren, wenn man in der eigenen Familie, auf Arbeit oder in der Kneipe einem Menschen begegnet, der rassistische Bemerkungen von sich gibt? »Oft ist es nicht so, dass man diese Menschen sofort als Rassisten ausmachen kann. Denn Rassismus tritt auch dort auf, wo man ihn nicht direkt vermutet«, sagte Dominik Piétron aus dem Organisationsteam, das aus Vertretern von Attac und dem Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« bestand.
Zweifelsohne eine wichtige Veranstaltung, trotz der geringen Teilnehmerzahl. Denn genau darum geht es, gerade in Leipzig, gerade jetzt, nach dem Aus von Legida. Vor zwei Wochen, nach den Demonstrationen zum zweiten Jahrestag der rassistischen Bewegung, erklärten die Legida-Organisatoren ihren Rückzug von der Straße. Ein Erfolg massiver Gegenproteste, doch verbunden mit einer umso schwierigeren Aufgabe. Denn der Rassismus hat sich dadurch ja nicht von selbst aufgelöst. Er hat sich nur von der Straße zurückgezogen, zurück in die Küchen und Kneipen.
Das war bisher ganz anders. In den letzten zwei Jahren stand vor allem der Kampf um die Straße im Fokus der Aufmerksamkeit: auf der einen Seite die Legida-Anhänger, auf der anderen Seite ein massiver zivilgesellschaftlicher Protest, der – zumindest in Ostdeutschland – seinesgleichen suchte. Gerade zu Beginn, als bis zu 30.000 Menschen gegen Legida protestierten, herrschte Ausnahmezustand. Im Laufe der Zeit ist dann die Zahl der Legida-Anhänger immer weiter geschrumpft. Die weltoffene Seite der Stadt hat ihre Hoheit erfolgreich verteidigt.
Gleichzeitig wurde Leipzig seinem Ruf als linke Hochburg wieder einmal voll und ganz gerecht. Denn neben der breiten Masse der Bevölkerung war auch die berühmt-berüchtigte Szene, die ihr Zentrum im Stadtteil Connewitz hat, immer da, immer präsent. Sie machte das, was sie am besten kann: dagegenhalten, Schilder hochhalten, herumbrüllen gegen Nazis, bürgerliche Rassisten, die Polizei und den Staat. Sie kramte die alten Demo-Sprüche wieder aus der Mottenkiste und interpretierte sie neu: »Legida, Rassistenpack, wir haben euch zum Kotzen satt!« Und: Sie ließ sich nicht einschüchtern, auch nicht, als Connewitz vor einem Jahr, nach dem ersten Legida-Jahrestag, von Neonazis angegriffen und verwüstet wurde.
Aufgrund ihres energischen, hartnäckigen Auftretens gerät die Leipziger linke Szene immer wieder in Verruf, die sächsischen Konservativen sehen in ihr den Teufel schlechthin. Mit dem Zurückdrängen von Legida hat sie jedoch ihre Existenzberichtigung bewiesen. Mehr noch: Sie hat gezeigt, dass Leipzig ein Vorbild ist, wenn es um antifaschistisches Engagement geht.
Doch nun, nachdem der Feind vorerst verdrängt, nicht aber geschlagen wurde, steht die Szene – wie die gesamte Zivilgesellschaft – vor neuen Aufgaben: Brüllen allein wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, Demos werden nicht mehr genügen. Die Auseinandersetzung mit Rassismus muss stattdessen auf völlig neuen Ebenen stattfinden – zum Beispiel an den Stammtischen.
Von einer anderen Ebene erzählt Juliane Nagel. Die Linken-Politikerin ist Ur-Leipzigerin, seit vielen Jahren Teil der linken Szene und seit 2014 Abgeordnete im sächsischen Landtag – und als solche quasi die parlamentarische Stimme der Szene. Sie hat schon viele Demos angemeldet und mitgemacht – wohl wissend, dass Demonstrieren tatsächlich etwas bewirken kann. Nun aber, glaubt sie, müsse man neue Wege beschreiten: »Die eigentliche Auseinandersetzung mit Ressentiments muss anders funktionieren: mit Gesprächen und Veranstaltungen, nicht nur mit diesem Protestgeschehen.«
Was ist also konkret zu tun? Nagel erzählt: »Vor einigen Jahren, als der Asylprotest aufkam, haben wir bereits angefangen, Veranstaltungsreihen ins Leben zu rufen. Das waren Vorträge, um Asyl zu verstehen, Begegnungsabende mit Geflüchteten.« Damit habe sie gute Erfahrungen gesammelt. Denn »all das hat schon dazu beigetragen, dass manche Menschen ihre Position nachhaltig geändert haben«. Genau solche Begegnungsräume brauche man deshalb jetzt umso dringender. Und Menschen, die sich darin engagieren.
Aber Leipzig wäre nicht Leipzig, wenn sich so etwas nicht organisieren ließe. Ja, andere Städte könnten sogar etwas von dieser antifaschistischen Trutzburg lernen, meint Juliane Nagel – insbesondere Dresden, wo Pegida nach wie vor auf die Straße geht und der Gegenprotest stets deutlich kleiner ausfällt. Eine funktionierende Zivilgesellschaft falle nämlich nicht einfach vom Himmel, sie sei Ausdruck der herrschenden Politik. Beispiel: Dass Leipzig »schon immer etwas bewegter« sei, habe etwas mit der langjährigen SPD-Regierung zu tun – im Gegensatz zum CDU-geführten Bundesland.
Nagel blättert ein wenig im Geschichtsbuch und landet bei Wolfgang Tiefensee, dem ehemaligen Bundesverkehrsminister, der von 1998 bis 2005 Oberbürgermeister von Leipzig war. Und zwar einer, der nicht herumschwadronierte wie andere sächsische Politiker, sondern der klar Position bezog: »Er hat sich auch mit in Blockaden gesetzt und bürgerschaftliches Engagement immer sehr unterstützt.« Damit habe er sich »klar abgehoben von den Positionen in Dresden. Dort färbt die CDU- und FDP-Regierung auch auf die Stadtgesellschaft ab.«
Anders ausgedrückt: Parlament und Mehrheitsgesellschaft passen sich gegenseitig an, und im schlimmsten Falle wird dadurch Rassismus immer weiter verstärkt. Umso dringender fordert Juliane Nagel deshalb, dass auch die Bürgermeister anderer Städte »immer eine offene Front gegen Rechts an den Tag legen, um gesellschaftliches Engagement zu stimulieren«. Vorausgesetzt, sie meinen es ernst mit dem Kampf gegen Rassismus.
Demnächst steht aber erst noch einmal Straßenkampf auf dem Terminkalender: Die neonazistische Kleinpartei »Die Rechte« will am 18. März in Connewitz aufmarschieren. Ob die rechte Demo wirklich stattfindet, oder ob es sich dabei bloß um eine Provokation handelt, ist zwar noch offen. Doch Leipzig ist alarmiert, mehrere Gegendemos sind bereits angemeldet. Denn eines ist klar: Die Leipziger Antifa-Geschichte, die bisher doch recht erfolgreich verlaufen war, soll fortgeschrieben werden.