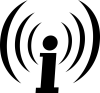Europa will mit mehr Hilfe in Afrika „Fluchtursachen bekämpfen“. Ein zynisches Spiel: Es wird bezahlt, wenn Menschen festgehalten werden.
BERLIN taz | Gut 700.000 Menschen kamen zwischen 2010 und 2015 aus Afrika als Asylbewerber in Länder der Europäischen Union. Die Zahlen pro Jahr steigen rapide: Zwischen 2010 und 2015 um 260 Prozent. Für 2016 schreibt die Internationale Organisation für Migration in ihrem jüngsten Bericht über Trends der Zuwanderung nach Europa: „Die Zahl der Migranten aus Syrien, Irak und Afghanistan geht zurück; die derer aus Afrika nimmt zu.“
Bis 2050 wird sich die Bevölkerung Afrikas mehr als verdoppeln. „Dramatisch zunehmen“ könnte die Migration aus Afrika, sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kürzlich.
Auf dem EU-Gipfel diese Woche war Migration aus Afrika Thema Nummer eins. Eine neue „Flüchtlingskrise“ wie im Jahr 2015 will die EU unbedingt vermeiden, allein schon um des eigenen Zusammenhalts willen und um dem Druck der Rechtspopulisten zu begegnen. Eine Situation wie 2015 „kann, soll und darf“ sich nicht wiederholen, sagte Merkel kürzlich auf dem CDU-Parteitag.
Bei der Formulierung der neuen EU-Afrikapolitik steht Deutschland an vorderster Front. Im vergangenen Oktober reiste Merkel zum ersten Mal seit 2011 wieder nach Afrika, danach kamen eine ganze Reihe von afrikanischen Staatschefs und Delegationen nach Berlin. Ähnliches spielte sich in Brüssel ab. So viel Aufmerksamkeit bekam der Kontinent nicht mal während der Ebola-Krise. Und in der am 1. Dezember begonnenen deutschen Präsidentschaft der G-20-Staatengruppe heißt eine Säule des Programms der Bundesregierung: „Verantwortung übernehmen – besonders für Afrika.“
Die neue Afrika-Politik der EU nahm ihren Anfang auf dem Höhepunkt der Syrien-Flüchtlingskrise. Am 11. und 12. November 2015 lud die EU die Afrikanische Union (AU) zum Migrationsgipfel nach Valletta auf der Mittelmeerinsel Malta. Sie legte einen 1,8 Milliarden Euro schweren „Nothilfe-Treuhandfond für Afrika“ auf. Der EU-Fonds werde die Ursachen von „Destabilisierung, Zwangsvertreibung und irregulärer Migration“ angehen, indem er Wirtschaft und Entwicklung Afrikas stärke, steht im Valletta-Aktionsplan.
Ein Etikettenschwindel
Afrikas Regierungen gelobten in Valletta „gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen die irreguläre Migration“. Den Milliardenfonds indes hielten sie zurecht für Etikettenschwindel: Der Löwenanteil der Gelder war längst als Entwicklungshilfe im EU-Haushalt eingestellt. Allzu bereitwillig auf die Wünsche der EU einzugehen, kam ohnehin nicht in Frage: Rücküberweisungen von Migranten aus Europa nach Afrika sind zu wichtig, Abschiebungen beim eigenen Volk unbeliebt.
So geschah zunächst wenig. Nach einem halben Jahr setzte die EU den afrikanischen „Partnern“ die Pistole auf die Brust. „Sämtliche Politikmaßnahmen- und Instrumente, die der EU zur Verfügung stehen“, hieß es in einem Papier der EU-Kommission vom 7. Juni 2016, sollten genutzt werden, um „konkrete Ergebnisse“ in der „Migrationssteuerung“ zu erzielen.
Der sozialdemokratische EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans aus den Niederlanden beschrieb an diesem Tag dem EU-Parlament die Linie der neuen Afrikapolitik: Eine „Mischung aus positiven und negativen Anreizen“. Drittländer, die „effektiv“ mit der EU zusammenarbeiten, seien zu „belohnen“, für die anderen solle es „Konsequenzen geben“. Zuckerbrot und Peitsche also. Jenen, die mitmachen, stellte die EU insgesamt acht Milliarden Euro bis Ende des Jahrzehnts in Aussicht. Das Ziel: „Ordnung in die Migrationsströme“ bringen.
Negative Anreize
Die EU will zweierlei: Es sollen weniger Migranten ankommen. Und wer ankommt, soll schneller wieder abgeschoben werden. „Konkrete und messbare Ergebnisse bei der zügigen Rückführung irregulärer Migranten“ verlangte der EU-Rat am 28. Juni, als diese neue Politik formell beschlossen wurde, und noch einmal am 21. Oktober. Liefern afrikanische Länder keine „konkreten Ergebnisse bei einer besseren Steuerung der Migration“, werden „Engagement und Hilfe angepasst“.
Wer nicht liefert, soll nicht nur Hilfszahlungen, sondern auch Marktzugänge verlieren. „Erzeugung und Nutzung der erforderlichen Hebelwirkung unter Einsatz aller einschlägigen – auch entwicklungs- und handelspolitischen – Maßnahmen, Instrumente und Hilfsmittel der EU“ wird das genannt.
Ein Instrument ist die Stimulation von Privatinvestitionen. Aus ihrem Entwicklungsbudget will die EU drei Milliarden Euro abzweigen, die Mitgliedsstaaten sollen dasselbe drauflegen. Europäische Unternehmen sollen dadurch in die Lage versetzt werden, bis 2020 sagenhafte 62 Milliarden Euro zusätzlich in Afrika zu investieren – jedenfalls in den Ländern, die beim Grenzschutz mitmachen. „Eine ambitionierte Investitionsoffensive für Drittländer, die dazu beitragen wird, Chancen zu eröffnen und die Migrationsursachen zu bekämpfen“, nannte dies Timmermans im Juni. Die Investitionen sollen Jobs schaffen und Menschen in Afrika halten.
„Das sind Gelder der Entwicklungszusammenarbeit, die jetzt für Wirtschaftsförderung hergenommen werden“, kritisiert Inge Brees von der NGO CARE in Brüssel. Es werde nicht überprüft, ob diese Projekte der Entwicklung dienen – etwa ob Arbeitnehmer- und Menschenrechte gewahrt werden. Vor allem aber konzentriert sich die Hilfe auf Länder, die für die Migrationskontrolle interessant sind – und fehlt entsprechend woanders. „Das Geld ist nicht vom Himmel gefallen“, sagt Brees. „Das hätte sonst auch für andere Krisen zur Verfügung gestanden.“
Vorbild Türkei-Deal
Das Gleiche gilt für den mittlerweile auf 2,5 Milliarden Euro angewachsenen Treuhandfonds für Afrika (EUTF). Auch darin stecken vor allem noch nicht verplante Mittel des EU-Entwicklungsbudgets. Jetzt will der Rat den Fonds noch aufstocken.
Geld gegen Flüchtlingsstopp – der milliardenschwere „EU-Türkei-Deal“ steht für diese Praxis Modell. Dass die meisten Afrikaner, die sich auf den Weg nach Europa machen, vor ihren eigenen Regimen fliehen – vor dieser Erkenntnis drückt Brüssel beide Augen zu, im Gegenteil: Die EU reicht nicht nur demokratischen Regierungen, sondern auch Diktatoren die Hand, damit sie die Flüchtlingsströme unterbinden.
Nach Zählung der taz haben die EU und deren Mitgliedsstaaten zwischen 2000 und 2015 mindestens 1,913 Milliarden Euro an Länder in Afrika gezahlt, damit sie Flüchtlinge aufhalten. Nicht eingerechnet ist der Berlusconi-Gaddafi-Flüchtlingsdeal aus dem Jahr 2008, in dem Italien Libyen fünf Milliarden Euro zusagte – es flossen wohl nur 250 Millionen.
Vermutlich liegt die tatsächliche Gesamtsumme weit höher, denn fast nie steht auf den entsprechenden Abkommen das Wort „Flüchtlingsstopp“. Meist läuft es so wie im Januar 2007, als Spaniens König Juan Carlos den Präsidenten von Mali, Amadou Toumani Touré, zum Mittagessen bat. Spanien hatte den Sahelstaat bis dahin weitgehend ignoriert. Doch als immer mehr Westafrikaner über Mali in Richtung der spanischen Afrika-Exklaven Ceuta und Melilla sowie der Kanarischen Inseln zogen, unterschrieb Touré nach dem Mittagessen zwei Abkommen. Das erste bescherte Mali bis Ende 2011 103 Millionen Euro Entwicklungshilfe. Mit dem zweiten gelobte Touré „effektive Zusammenarbeit“ bei der Grenzkontrolle – und keine Schwierigkeiten zu machen, wenn Spanien Malier abschieben will.
EU-weit harmonisierte Erpressung
So kaufte Spaniens Regierung seinerzeit halb Westafrika ein. Mit Erfolg: In den Jahren danach kamen kaum noch afrikanische Flüchtlinge auf den Kanaren an. Andere Länder guckten sich das ab. Die Niederlande strichen Ghana 2007 rund 10 Millionen Euro Entwicklungshilfe, weil die Regierung Abzuschiebende nicht zurücknehmen wollte.
Das waren nur punktuelle Maßnahmen. 2010 aber gründete die EU ihren „Auswärtigen Dienst“ (EAD). Sie eröffnete Vertretung um Vertretung, selbst in der abgeschotteten Diktatur Eritrea, das Hauptherkunftsland afrikanischer Flüchtlinge in Europa. Die selbstbewusste Außenbeauftragte Federica Mogherini, die aus dem von der Migration aus Afrika am stärksten betroffenen Italien kommt, will Außenpolitik machen, als sei die EU selbst ein Staat. Migrationskontrolle ist dabei eines der wichtigsten Ziele.
Seit Monaten verhandelt die EU mit Hochdruck über „Compacts“ genannte „maßgeschneiderte“ Länderpakete – bislang mit Libanon, Jordanien sowie fünf „Prioritätsstaaten“ in Afrika: Senegal, Mali, Nigeria, Niger und Äthiopien. Was da genau passiert, ist unklar. So wurde am 11. Dezember gemeldet, dass der niederländische Außenminister Bert Koenders im EU-Auftrag und sein Amtskollege Abdoulaye Diop aus Mali ein Rücknahmeabkommen für abgelehnte malische Asylbewerber unterzeichnet hätten. Mali wäre der erste Staat auf dem afrikanischen Festland, der sich auf einen solchen Vertrag mit der EU einlässt – bisher gibt es nur eines mit Kap Verde.
Malis Außenminister Diop dementierte umgehend: es sei kein Rücknahmeabkommen unterzeichnet worden, entsprechende Meldungen seien „Lüge“. Es seien lediglich im Rahmen des Migrationsdialoges mit der EU neun Projekte im Umfang von 145 Millionen Euro für Mali vereinbart worden. Der Dialog werde im kommenden September fortgesetzt. Bereits im Februar hatte der Auswärtige Dienst der EU in einem als „geheim“ eingestuften Strategiepapier zu Mali notiert: „Die Regierung ist gegen Rücknahmeabkommen.“
Gespräche „mit Preisschild“
Verhandlungen über weitere Abkommen laufen mit Nigeria und Tunesien sowie Äthiopien, Niger und Senegal. Ob noch zusätzliche Länder dazukommen und zu welchen Bedingungen, ist umstritten. Laut einem internen Papier der deutschen Bundesregierung im Vorlauf des EU-Gipfels dieser Woche, das der taz vorliegt, ist der Auswärtige Dienst der EU der Auffassung, „in jedem Fall müsse die Aufnahme weiterer Partnerschaftsländer mit der Zurverfügungstellung zusätzlicher Finanzmittel einhergehen“. Aber Berlin sei da skeptisch: Eine „zwingende Verknüpfung“ dieser Art halte man für „zu weitgehend“; man solle „Verhandlungen mit Drittstaaten“ nicht von vornherein „mit Preisschild versehen“.
Erst mal geht es darum, was die EU von den afrikanischen Staaten will. In einem Strategiepapier vom März 2016 zu Äthiopien verlangt die EU, dass die Regierung in Addis Abeba die „Sekundärbewegung aus Flüchtlingslagern in Äthiopien in Richtung Europa“ drückt. Nigeria, bislang Hauptumschlagplatz für Passfälscher, soll stärker gegen Schlepper und Dokumentenfälscher vorgehen und die stockende Einführung biometrischer Ausweise vorantreiben, so ein Kommissionspapier vom Februar 2016.
Als Nigerias Präsident Muhammadu Buhari im Oktober 2016 nach Berlin kam, betonte Bundeskanzlerin Merkel: „Wer kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat – das sind 92 Prozent der Menschen aus Nigeria, die zu uns kommen –, muss wieder zurückkehren.“
Abschiebungen sind immer das wichtigste Thema. Aus europäischer Sicht geschehen sie viel zu selten. 470.000 Menschen wurden 2014 aus der EU ausgewiesen – aber abgeschoben wurden im selben Zeitraum nur 169.000; neuere Gesamtzahlen liegen nicht vor.
An Parlamenten vorbei
Der Grund für die große Differenz: Meist fehlt ein Reisepass. Fehlende Dokumente seien „nach wie vor das quantitativ bedeutendste Problem“ bei Abschiebungen, heißt es in einer Evaluation der Bund-Länder-AG Rückführungen. Dann müssen Ausländerbehörden die Staatsangehörigkeit ermitteln und bei der Botschaft einen Pass besorgen. Aber die Botschaften spielen oft nicht mit.
Die bisherigen bilateralen Rücknahmeabkommen mit einigen afrikanischen Ländern haben da nicht viel gebracht. Die neuen Verträge sollen das ändern. Damit das in Menschenrechtsfragen etwas sensiblere EU-Parlament nicht dazwischenfunkt, will die EU am liebsten informelle Vereinbarungen, denen das Parlament nicht zustimmen muss.
Schon von den 60 Abkommen zu Abschiebefragen, die Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien mit afrikanischen Ländern abgeschlossen haben, sind nur acht formale Rücknahmeabkommen. Beim Rest handelt es sich um undurchsichtige Absprachen, oft zwischen Polizeibehörden, etwa Italiens nicht einmal dem eigenen Parlament offengelegte „Memoranden“ mit Senegal, der Elfenbeinküste, Nigeria oder Niger.
Eine Allzweckwaffe will die EU in die Compacts hineinverhandeln: die sogenannten Laissez-Passers. Die „Passierscheine“ sind Reisedokumente, gültig nur für eine Abschiebung. Der Clou: Nicht die Botschaft des mutmaßlichen Herkunftslandes stellt ihn aus, sondern der EU-Staat, der abschieben will. Als „Empfehlung“ kennt die EU die Laissez-Passers seit 1994, aber bislang hat kaum ein afrikanisches Land sie regulär anerkannt. Das will die Kommission jetzt erzwingen. Sie fordert damit von den afrikanischen Ländern einen Verzicht auf die Prüfung der Staatsbürgerschaft – und somit die Aufgabe eines Teils staatlicher Souveränität.
Für die Partnerstaaten ist das nicht ohne Risiko. Leicht können abgelehnte Flüchtlinge irgendwo in Europa zu Bürgern eines Landes erklärt werden, das solche Papiere akzeptiert – egal wo die Leute wirklich herkommen. Ende Oktober beschloss das EU-Parlament per Verordnung die verbindliche Einführung der Laissez-Passers. Am 8. April 2017 tritt diese in Kraft.
Kontrolle statt Schließung
Die Frage, welche Menschen wo hingehören, wird damit heikel. Innerhalb weiter Teile Afrikas sind Reisen zwischen Nachbarländern bislang vergleichsweise einfach, die „afrikanische Integration“ ist erklärtes Ziel aller afrikanischen Regierungen und Regionalorganisationen. Offiziell wird das von Europa unterstützt. Aber die Politik Europas bewirkt das Gegenteil. Es entsteht nun ein immer dichteres Netz von Kontrollmechanismen, die die Bewegungsfreiheit schleichend einschränken.
Bei der EU-Kommission heißt es, sie wolle keinesfalls die inneren Grenzen Afrika schließen. Diese sollen nur besser kontrolliert werden. Wer sich ausweisen könne, werde weiter durchgelassen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.
Eine wichtige Transsahararoute verläuft durch den Nordosten Malis. An der Grenze zu Niger herrscht Freizügigkeit für Westafrikaner. Doch Nigers Polizei am Grenzposten in Yassan weist neuerdings immer mehr Reisende ab. „Dies betrifft malische Staatsbürger und in noch deutlich schärferem Ausmaß Personen aus anderen Ländern Westafrikas“, sagt Éric Alain Kamden, seit 2009 für Caritas vor Ort. Für Personen aus Staaten wie Ghana, Sierra Leone oder der Elfenbeinküste, von denen angenommen wird, sie seien unterwegs nach Europa, gibt es laut eines Kommissars in Yassan die Dienstanweisung, sie gar nicht mehr durchzulassen. Von anderen Grenzen der Region ist ähnliches zu hören. Die traditionelle, für Westafrika so wichtige Migration wird erschwert.
Keinen falschen Eindruck wecken
Wie könnte ein wohlgeordneter Migrationskorridor von Westafrika nach Europa aussehen? 2008 hat der damalige EU-Entwicklungskommissar Louis Michel es versucht. Er eröffnete ein „EU-Jobcenter“ in Malis Hauptstadt Bamako. Arbeitssuchende Malier sollten sich dort direkt auf freie Stellen in Europa bewerben können, im Erfolgsfall winkte ein Visum. Das Projekt scheiterte grandios: Die EU selbst durfte keine Arbeitsvisa erteilen – und die Mitgliedsstaaten wollten nicht.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. In allen Papieren zur neuen Afrika-Partnerschaft ist zwar die Rede von der „Schaffung legaler Wege“. Doch die fallen in den Compacts äußerst mickrig aus. Von „mehr Plätzen für Studenten, Forscher und Dozenten“ im Stipendienprogramm „Erasmus+“ ist in den Entwürfen die Rede. Mehr nicht. Der Rat will unbedingt alles vermeiden, was den Eindruck erweckt, mehr Zuwanderung sei willkommen. Wer in Europa arbeiten will, muss auch in Zukunft meist den lebensgefährlichen Weg über das Meer nehmen und sich danach als Asylsuchender ausgeben.
Sofern er überhaupt so weit kommt. Der einfachste Weg, Flüchtlinge und Migranten noch in Afrika aufzuhalten, ist, sie einzusperren. Das Genfer Global Detention Project zählt aktuell in Libyen 33 Internierungseinrichtungen für Migranten, in Marokko 16, in Senegal fünf, in Tunesien zwei, in Mauretanien eines – letzteres von Spanien errichtet.
Folter und Zwangsarbeit
In vielen Lagern Libyens herrsche „schwere Überfüllung, Mangel an Licht und an Frischluft“, heißt es in einem Mitte Dezember veröffentlichen gemeinsamen Untersuchungsbericht der UN-Menschenrechtskommission und der UN-Mission in Libyen. Oft gebe es keinerlei sanitäre Einrichtungen. Durchfall und Atemwegserkrankungen seien verbreitet, es mangele an Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung.
„Wir schwarzen Afrikaner werden Tiere genannt und auch so behandelt“, erzählte den UN-Ermittlern ein 16-jähriger Eritreer, der im Sommer 2016 sechs Wochen lang mit rund 200 anderen Migranten in einem fensterlosen Metallhangar in der libyschen Hauptstadt Tripoli saß. Andere erzählten von Folter, Zwangsarbeit und sexuellen Übergriffen.
Lösegeldforderungen steigen stetig an, berichtet Meron Estefanos, Direktorin der Eritreischen Initiative für Flüchtlingsrechte (ERRI), eine Exil-NGO in Schweden. Bis zu 15.000 Dollar verlangen die Entführer pro Person von deren Familien, bezahlt wird per mobilem Geldtransfer.
Die Praxis der Internierung stammt aus der Zeit des Deals zwischen Berlusconi und Gaddafi. Nach dessen Sturz 2011 übernahmen Milizen die Knäste. Laut dem UN-Bericht unterhält die zuständige Abteilung des libyschen Innenministeriums derzeit 24 Internierungszentren mit 4.000 bis 7.000 Insassen. Es gebe weitere Lager anderer Behörden und Milizen. Nach Schätzung der EU sind sogar sieben Prozent der über eine Millionen Migranten und Flüchtlinge in Libyen in Lagern eingesperrt – das wären rund 77.000 Personen. Die EU eruiert derzeit, welches Lager nach EU-Standards umgebaut werden kann.
Horror im Migrantenknast
Ägypten, das Deutschland als Prioritätsland für eine EU-Migrationspartnerschaft ins Spiel gebracht hat, betreibt gar 64 Migrantenknäste – und ist zugleich Partner des Projektes „Better Migration Management“ der deutschen Entwicklungsagentur GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Das Projekt soll Grenzpolizeien für eine „menschenrechtsgerechte Praxis“ beraten. Auf Ägypten einwirken, damit das Militär dort seine Flüchtlingsknäste schließt, könne die GIZ aber nicht, heißt es.
Stolz berichtet die GIZ allerdings, wie sie dem wegen mutmaßlichen Völkermordes in Sudans Westregion Darfur international per Haftbefehl gesuchten sudanesischen Präsidenten Omar Hassan al-Bashir den Wunsch nach Bau von Internierungszellen und Militärgerät abschlug. Ansonsten aber ist die EU zur Kooperation mit Bashir entschlossen. Sie erwägt für Sudan die Erlassung aller Schulden, will sich bei den USA für die Streichung des Landes von der US-Terrorliste einsetzen und bei der Welthandelsorganisation für neue Gespräche.
Sudan ist nicht die einzige Diktatur, mit der die EU sich zum Zweck der Migrationsabwehr einlässt. Äthiopien, wo seit einem Jahr Hunderte von Menschen beim Niederschlagen von Protesten getötet worden sind, konnte sich in der ersten, gerade beendeten Vergaberunde des EU-Treuhandfonds über Projekte in Höhe von 110 Millionen Euro freuen.
Eritrea, eine der schlimmsten Diktaturen der Welt, ist zwar anders als Äthiopien kein Partner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Vom „Better Migration Management“-Programm profitiert es wohl trotzdem: Die Ausbildung eritreischer Beamter komme zwar nicht im eigenen Land in Frage, heißt es bei der GIZ, aber in Nachbarstaaten. Der EU-Delegationschef in Asmara, Christian Manahl, sagt der taz, auch Ausbildung in Eritrea selbst sei in Zukunft nicht ausgeschlossen.