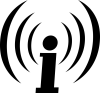Schön, dass neben der Reihe von Besetzungen der letzten Wochen nicht nur die Aktion am blühen ist, auch die Reflexion kommt in Bewegung, off-line und off-the-record sowieso, aber inzwischen auch öffentlich. Neben einer Fülle von eher programmatischen Veröffentlichungen und Berichten sind auch ein paar eher theoretische Texte im Umlauf, zum Beispiel die folgenden: "Squatting till communism", "Häuser besetzen sowieso?", "Make Squatting a Threat again!" Letzterer ist zum Teil eine Antwort auf den zweitgennanten. Zuletzt beschäftigt sich auch der Beitrag "Der Wiener Weg: Die Stadt gehört sicher nicht dir! - oder: Squat til you drop!" mit Reflexion und Perspektiven von Besetzungen in Wien. Die dringend nötige Debatte ist also schon eröffnet, steht aber noch am Anfang.
Heute daran zu glauben, dass in Wien ein Haus durch Besetzung erkämpft werden kann, scheint der Überzeugung zu gleichen, mit viel Anstrengung mitten in einem Orkan sturmfeste Seifenblasen produzieren zu können. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es natürlich möglich ist, nicht zuletzt, weil schon ganz andere Sachen durch gemeinsame Aktion entschlossener Menschen erkämpft wurden, auch gegen die organisierte bewaffnete Macht des Staates.
Wege finden im Dunkeln
Der Text "Make Squatting a Threat again" kritisiert zu Recht, dass die Frage nach dem Weg dorthin zu kurz kommt in "Häuser besetzten sowieso?". Diese Frage kommt generell zu kurz. Sie kommt auf, hier und da, immer wenn Menschen zusammen kommen, die sich für Besetzungen interessieren. Aber sie wird eigentlich nie irgendwo strukturiert diskutiert. Denn dass der Weg lang ist und sein wird, das können wir sehen, denn trotz dem nicht wenige Menschen seit Jahren bereit sind ihn zu gehen, treten wir scheinbar und zu einem gewissen Grad auch praktisch auf der Stelle.
Das ist klarerweise auch nicht ganz richtig. Es sind ja schon verschiedene Wege teilweise beschritten worden. Etwa ist von der Gruppe Hausprojekt recht ausgiebig der Versuch gemacht worden, die Stadt Wien durch lästig Sein und regelmäßiges Besetzen zu Verhandlungen zu bewegen, die dann in einer Zwischennutzungsvereinbarung münden könnten.
Bis heute scheint das einer der gangbarsten Wege für einige zu sein, das Thema kommt jedenfalls immer wieder auf. Sicher ist die Stadt Wien als Eigentümerin auch für diese Strategie am ehesten geeignet, ist es doch zumindest theoretisch machbar, die Notwendigkeit bestimmter Projekte im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, und auf diesem Weg eine für eine Räumung politisch ungünstige Situation zu schaffen. Erst wenn sich die Stadtregierung insgeheim anscheißt vor der negativen Reaktion der öffentlichen Meinung, wird sie vielleicht über ihren Schatten springen und tatsächlich so etwas wie Verhandlungen führen.
Alte Sackgassen und wohl bekannte Kreuzungen
Aber auch diesen Weg zu gehen kann selbst bei noch so großer Ausdauer in einer Sackgasse enden. Denn ehe mensch es sich versieht, ist ein Verein gegründet, Repräsentant_innen gewählt, Miete klingt auf einmal nicht mehr grundsätzlich undenkbar, wenn es zusätzlich ein wenig staatliche Förderung gibt. Bald werden dann Leute gegen Lohn beschäftigt, kommerzielle Gastronomie betrieben, und vom irgendwann einmal widerständigen Anfang, vom Antagonismus zu den herrschenden Verhältnissen, von der direkten Aneignung, die eine Besetzung sein kann, ist schnell nicht mehr viel zu sehen.
Für diesen Weg gibt es ja in Wien ein paar Beispiele, etwa WUK, Arena, indirekter auch das Flex. Deren Wegen nachzugehen, erscheint wenig sinnvoll, von ihren Geschichten zu lernen, ist deshalb trotzdem nicht ersetzbar.
In der aktuellen Bewegung in Wien gibt es, wie wahrscheinlich in unterschiedlicher Ausprägung immer, zwei Pole bei der Bewertung dieser Fragen. Es gibt Leute, die überhaupt nicht auf die Idee kommen würden, mit irgendwem zu verhandeln. Das geht oft einher mit der Ablehnung jeglicher Interaktion mit kommerziellen bzw. staatlichen Medien sowie Parteien. Das kann leicht als autonomer Purismus gesehen werden, hat aber durchaus seine Berechtigung, vor allem mit Blick auf vergangene Bewegungen und daraus entstandener Projekte. Einer Anbiederung an die etablierte Politik und die Diskursmacht der Medien kann leicht dazu führen, dass wirklich emanzipatorische Ideen schneller aus einer antagonistischen Bewegung verdrängt werden, als das jede Form der staatlichen Repression jemals zu erreichen vermag.
Der andere Pol ist zum Glück bisher keinesfalls ein angepasster Standpunkt, er ist nicht die Kapitulation vor den herrschenden Verhältnissen und ihren Akteur_innen. Es handelt sich vielmehr um den Versuch, den schmalen Grat zu überqueren zwischen den eigenen politischen Überzeugungen und einem gewissen Pragmatismus in anbetracht der aktuellen Lage. So ist es gut möglich, dass sich nicht wenige der in der aktuellen Bewegung aktiven Menschen zu einem späteren Zeitpunkt etwa auf so etwas wie Verhandlungen mit der Stadt einlassen würden, sollten diese ernst gemeint erscheinen. Dass sie dabei aber zum Beispiel auf das bisherige Konsensprinzip oder die Ablehnung jeglicher Form von Repräsentation verzichten sollten, um sich den Anforderungen der bestehenden Mächte anzupassen, ist kaum vorstellbar.
Straight bleiben oder "den Realitäten ins Auge blicken"? Am besten beides.
Und das ist auch gut so. Natürlich müssen solche Grundprinzipien immer wieder zur Diskussion stehen, mit ihrer Anwendung experimentiert werden. Aber sie einfach über Bord zu werfen, sie einem falsch verstandenen Pragmatismus zu opfern, wäre fatal. Eine Bewegung kann überhaupt nur die vorhandenen Machtstrukturen herausfordern, wenn sie sich eben nicht auf die in ihnen wirkenden Mechanismen einlässt, denn auf diesem Gebiet ist die Seite der Herrschaft immer am längeren Hebel.
Welche Kompromisse wann und wie gemacht werden könnten oder sollten, darüber gibt es viel zu wenig Diskussion. Diese Feststellung trifft leider nicht nur auf das Thema Hausbesetzung zu, sondern auf das gesamte autonome Spektrum. Wie damit umgehen etwa, wenn auf einmal Gruppen mit dem K im Namen auf die Idee kommen sollten, mitzubesetzen, weil sie trotz aller Freiraum- und Hippiekritik auf einmal den praktischen Wert in der Rückaneignung von lebenswichtigen Ressourcen sehen, auch wenn sie eigentlich lieber alles verstaatlichen würden?
Prinzipiell ist jede Verbreiterung so einer Bewegung wahrscheinlich notwendig, wenn überhaupt etwas erreicht werden soll. Ein paar hundert linksradikale allein, ob jetzt K oder A, werden wohl kaum eine Revolution machen, und wahrscheinlich auch nicht erfolgreich ein Haus besetzen. Der Anfang braucht aber trotzdem eine gute Portion autonomen Purismus, etwa was nicht-hierarchische Organisationsweisen betrifft, ansonsten reproduziert sich nur der selbe Mist wie überall sonst: Stellvertreter_innen, bürokratische Strukturen und letzten Endes die Glättung der eigenen Kanten bis zur Stromlinienförmigkeit, um als 'glaubwürdige Gesprächspartner_innen' wahrgenommen zu werden.
Was die konkrete Situation in Wien angeht, so scheint der Weg, die Stadt zu Verhandlungen zu bewegen bisher gescheitert, vielmehr behauptet die Stadt wie beim Lobmeyr-Hof, der Wahrheit widersprechend, eh verhandelt zu haben. Mensch könnte jetzt sagen: Immerhin fühlen sie sich schon genötigt, das zu verlautbaren. Aber Tatsache ist, dass ein dorniger Weg bevor steht, eh die Stadt mit den Protagonist_innen irgendeiner basisdemokratisch organisierten Besetzung Verhandlungen eingeht. Das werden sie vermutlich erst dann tun, wenn sie kaum noch anders können, zumindest das Gefühl haben müssten, aus einer Verweigerung von Verhandlungen würde ihnen letztlich ein Nachteil erwachsen, vor allem im Bezug auf ihr öffentliches 'Standing'.
Genauso ist es aber auch aus der Position der Besetzer_innen gesehen so, dass Verhandlungen nur aus einer Position der Stärke heraus Sinn machen. Wirkliche Stärke allerdings würde einen krassen Gegensatzt zum jetztigen Zustand bedeuten, auch wenn die Bewegung vielleicht heute stärker ist als seit vielen Jahren.
Bewegung oder "Aktivismus"?
Dem Text "Make Squatting a Threat again!" ist voll Recht zu geben, dass es eine soziale Bewegung brauchen wird, um ein Haus zu erkämpfen. Eine soziale Bewegung ist mehr als ein mehr oder weniger großer Haufen Leute die gerne Häuser besetzen. Soziale Bewegungen zeichnen sich dadurch aus, dass ein breiteres Spektrum an sozialen Akteur_innen auf den Plan tritt, um ihre teilweise ähnlichen oder auch deckungsgleichen Interessen durchzusetzen bzw. im besten Fall auch ihre sozialen Utopien Praxis werden zu lassen.
Potential ist dafür schon vorhanden in Wien, wenn auch nicht im Überfluss. Aber es gibt eine Vielzahl an Gruppen, die mit Selbstverwaltung, Schenkönomie und dem Aufrechterhalten herrschaftskritischer Räume experimentieren. Was bisher fehlt, sind Bindemittel, Initiativen die versuchen, die verschiedenen sozialen Blasen zusammenzufügen. Tatsächlich passiert das vielleicht einmal mehr oder weniger bei bestimmen Demos, aber eine wirklich kontinuierliche Zusammenarbeit entsteht nicht.
Der Verweis in dem Text "Make Squatting a Threat again!" auf die viel beachtete Recht-auf-Stadt – Kampagne in Hamburg ist mal ein Anfang, die Auseinandersetzung mit Bewegungen anderswo sollte dringend ausgebaut werden. Interessant genauer unter die Lupe zu nehmen ist sicher auch die vor kurzem in Israel angelaufene Bewegung, die Begann als Protest gegen hohe Mieten und Lebenshaltungskosten, deren Losung inzwischen eher die einer gerechten Gesellschaftsordung ist.
Generell fehlt in Wien bisher eine sichtbare Kampagne zum Thema Gentrifizierung. Im Kontext einer solchen Kampagne würden wohl Hausbesetzungen für viele "Außenstehende" eher verständlich werden. Schaut mensch zum Beispiel nach Spanien oder Griechenland, so wird schnell klar, dass gerade in Metropolen die Organisation in Stadtteil- bzw. Grätzel-Versammlungen zu einer recht guten Einbindung auch der Menschen führen kann, die normalerweise nicht im klassischen Aktivist_innen-Milieu herumschwirren. Wenn es vor allem mal um die eigene Wohnsituation und das eigene nahe Umfeld geht, scheint die Hemmschwelle zu politischer Aktivität geringer zu sein.
Regelmäßige Treffen zu denen im ganzen Grätzel eingeladen wird, Diskussionsrunden, kulturelles Programm wie Filme, Theater, Straßenfeste, Einmischen in Bau- und Grünflächenpolitik in einem bestimmten Gebiet: Würden sich in jedem Wiener Bezirk Gruppen finden, die sich um solcherart Aktivitäten bemühen, dann wären bald die Vorraussetzungen für die Erkämpfung selbstverwalteter Räume vermutlich wesentlich besser als Heute. Diese wäre dann logischer Ausdruck eines materiellen Bedürfnisses von vielen, und damit potentiell unaufhaltbar.
Gegen die Abkapselung, für die Autonomie!
Die/der Autor_in von "Make Squatting a Threat again!" schreibt an einer Stelle: "Wenn die Forderung nach einem autonomen Zentrum eine Solo-Stimme ist, wird sie wenig erreichen, ist sie eine Stimme in einem vielstimmigen Chor, kann sie sehr viel erreichen."
Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, wichtig ist hier nur zu unterscheiden zwischen einem autonomen (sozialen) Zentrum, und einem Zentrum für "Autonome". Letzteres ist vielleicht das, was nicht wenige Außenstehende imaginieren. Es ist aber sicher nicht das Ziel der Besetzungen der letzten Wochen gewesen. Autonom bezieht sich hier nicht vorrangig auf die soziale Bewegung oder Strömung der Autonomen, sondern meint autonom vielmehr im Sinne von die eigenen Regeln bestimmend, selbstverwaltet, unabhängig. Darüber hinaus ist ohnehin jede Form der identitären Politik höchst problematisch, sich selbst, "die Autonomen", als zentrale Akteur_innen zu sehen, wäre sicher ein Ansatz, der in einer Sackgasse endet.
Vielmehr ist autonom eben ein Attribut der Aktionsform und des angestrebten Projekts. Eine soziale Bewegung, die es schafft, das Aufbegehren gegen eine Reihe von Missständen zu kanalisieren und ihm Ausdruck zu verleihen, braucht, so die These, autonome Räume und Infrastruktur, um sich auch materiell zu manifestieren.
Dabei kommt natürlich die altbekannte Henne-Ei-Frage wieder auf, denn es eben vermutlich auch erst mal eine soziale Bewegung, um ein autonomes Zentrum zu erkämpfen. Die Antwort wird letztlich sein, dass beides eben Hand in Hand gehen muss. Beschränken sich jene, die ein autonomes Zentrum erkämpfen wollen, auf diesen Kampf zum Selbstzweck, dann wird die Situation wahrscheinlich lange so festgefahren bleiben, wie sie jetzt ist. Vielmehr muss wohl der Fokus gerade etwas verschoben werden auf den Aufbau einer Bewegung. Und die wächst nun mal nicht von allein durch eine Reihe von kurzen Besetzungen.
Zuletzt muss dann doch noch mal auf einen Punkt in "Make Squatting a Threat again!" eingegangen werden. Der Text verfällt an manchen Punkten doch wieder in eine recht flache Freiraum-Kritik:
"Aber ein Ausstieg aus der Gesellschaft, oder wie es wortwörtlich heißt, ein Ausgrenzung aus dem System ist nunmal nicht möglich, da wir alle Teile des Systems sind."
Eine wahnsinnig neue Feststellung ist das nicht. Wir sind alle Teil vom System, welche Neuigkeit. Erst mal spricht der Text "Häuser besetzen sowieso?" weder von Ausstieg noch Ausgrenzung, sondern davon, sich nicht einzugliedern, bzw. von "Ausgliederung". Der Unterschied liegt in der Nuance, aber vermutlich ist hier eben nicht ein "Ausstieg" gemeint, sondern das schrittweise, partielle Entreißen von Lebensbereichen aus dem ewigen Profitkreislauf des Systems. Und das ist sehr wohl möglich, z.B. durch Erkämpfung von mietfreiem Wohnraum und den Aufbau nicht-kommerzieller Projekte.
"Sich nicht eingliedern" ist etwas anderes als Ausstieg. Aus den gesellschaftlichen Verhältnissen als Ganzes aussteigen zu wollen ist illusionär, aber es gibt eben außer der mehr oder weniger passiven oder aktiven Hingabe eben noch den immerwährenden Versuch, einer Eingliederung zu wiederstehen bzw. widerständige Inseln der teilweisen Ausgliederung zu erschaffen.
Hier ist der Warnung des Textes "Squatting till Communism" aber prinzipiell Recht zu geben, wenn es heißt: "Auch ein alternativer Lebensstil innerhalb des Kapitalismus, wie er durch linke Wohnprojekte versucht wird, ist im Grunde immer Selbstausbeutung." Leicht kann es dazu kommen, dass gerade nicht-kommerzielle Projekte letztlich soziale Dienstleistungen bereitstellen, für die nach allgemeiner Lesart "eigentlich der Staat aufkommen müsste". Die in solchen Projekten Arbeitenden zahlen sich oft keinen oder nur einen sehr geringen Lohn aus, haben aber meist doch laufende Kosten. Das als Selbstausbeutung zu betrachten ist nicht weit hergeholt.
Aber ob es das wirklich ist, ist zum Teil eine Frage der Perspektive, aber auch und vor Allem eine Frage der konkreten Umsetzung. Wird ein Projekt angepasst, findet sich also zum Beispiel mit der bestehenden Eigentumsordnung ab, zahlt also Miete und kauft alle Ressourcen legal ein bzw. Mietes sie, anstatt sie sich anzueignen, z.B. durch Besetzung, Einsammeln von dem, was andere als Müll entsorgen, Diebstahl, Plünderung, dann sind die Beteiligten schnell auf dem Weg der Selbstausbeutung, weil sie ja auch für ihr eigenes Leben kontinuierlich Geld brauchen. Werden die Grenzen des Legalen immer eingehalten, dann ist Autonomie natürlich nicht mehr als ein Wunschtraum.
Es geht eben nicht um einen "alternativen Lebensstil", sondern um eine möglichst konsequent antagonistische Lebensweise. Und für die braucht es ein autonomes Zentrum in Wien. Vorerst wird es wohl erstmal darum gehen, diesen von vielen Gefühlten Antagonismus hervorzukitzeln, damit wir für die kommenden Auseinandersetzungen die nötige Stärke aufbauen können. Der Anfang ist gemacht.
Wichtig
ist, dass weiterhin klar ist: Ein autonomes Zentrum kann nur im Kontext
eines größeren Projekts seinen antagonistischen Charakter behalten: Der
Zersetzung und Unterwanderung des Bestehenden und der Umgestaltung der
gesellschaftlichen Verhältnisse als Ganzes. Wird es statt dessen gedacht
als ein Projekt für sich, ist es zum Scheitern verurteilt.